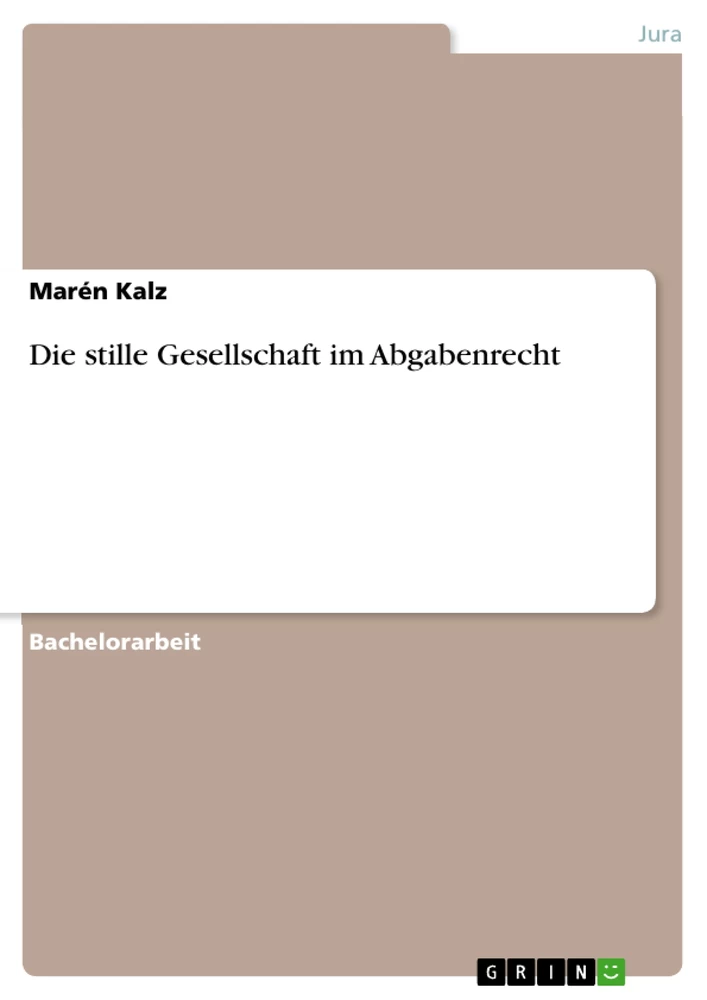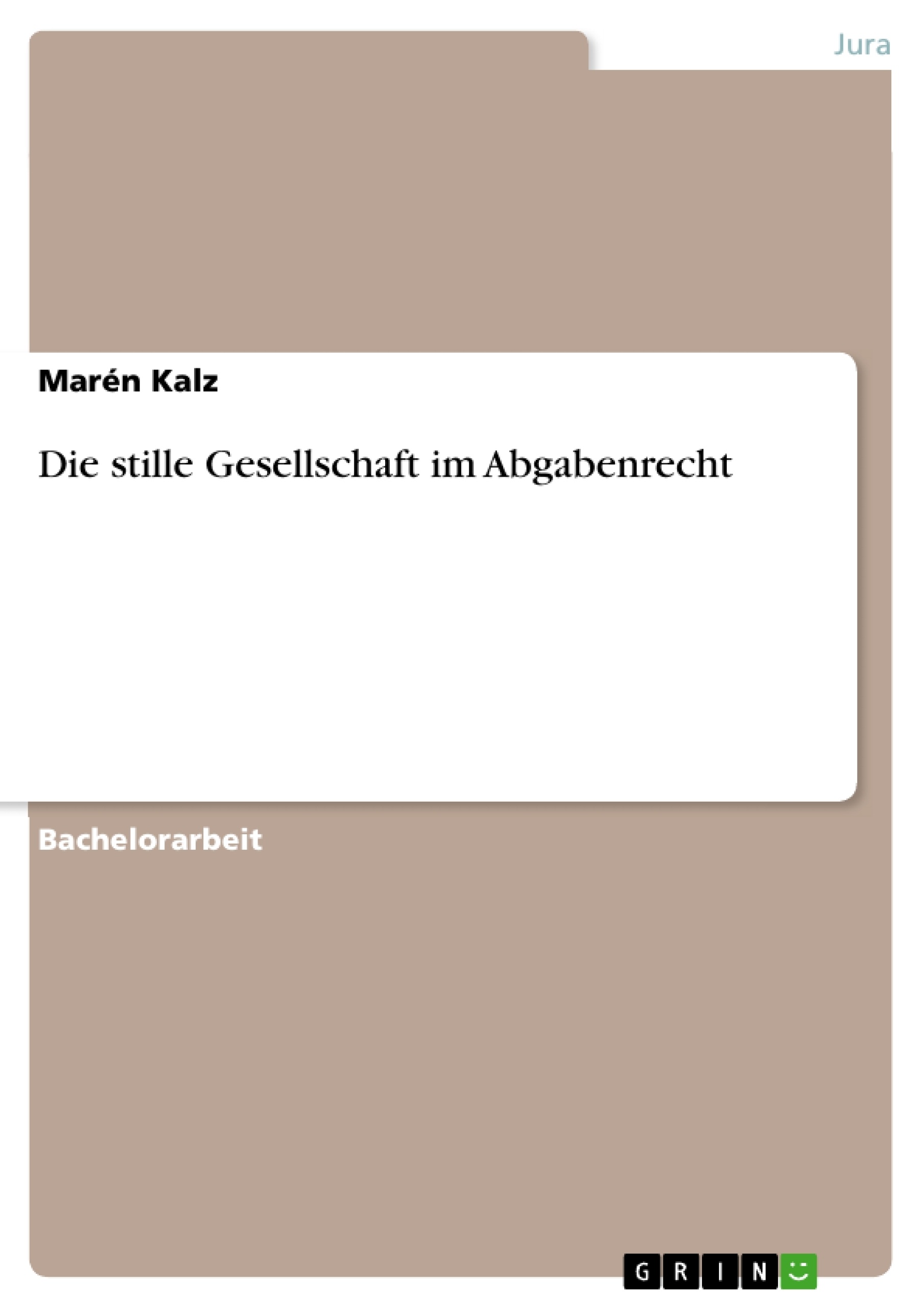Gerade in Zeiten der Finanzkrise wird es für Unternehmer immer schwieriger an Kapital zu kommen, um ihre Projekte umzusetzen.
Dabei hat ein Unternehmer die Möglichkeit sich am Markt Eigen-kapital oder Fremdkapital zu beschaffen. Wobei beide Varianten ihre Vor- und ihre Nachteile haben.
Entscheidet man sich für das Eigenkapital, dann muss man neue Gesellschafter aufnehmen, zum Beispiel durch Gründung einer Aktiengesellschaft. Der Vorteil ist, dass den Gesellschaftern eine Gewinnbeteiligung zusteht, die nur zur Auszahlung kommt, wenn auch entsprechender Gewinn vorhanden ist. Ausserdem ver-bessert der Zufluss von Eigenkapital unternehmensbezogene Kenn-zahlen, was den Banken eher eine Kreditvergabe ermöglicht. Ein riesiger Nachteil ist jedoch, dass die neuen Gesellschafter auch Mitbestimmungsrechte haben und die Machtstrukturen im Unternehmen verändert werden.
Demgegenüber hat die Beschaffung von Fremdkapital den Vorteil, dass die Kapitalgeber kein Mitbestimmungsrecht erhalten und die Machtstrukturen daher erhalten bleiben. Nachteilig kann sich die Aufnahme von Fremdkapital auswirken, wenn in finanziell schwie-rigen Zeiten die Zinsen gezahlt werden müssen, auch wenn nur sehr wenig Gewinn vorhanden ist.
Die stille Gesellschaft bietet die Möglichkeit, die Vorteile von der Eigenkapitalbeschaffung mit den Vorteilen der Fremdkapital-beschaffung zu verbinden. Das heisst, das Kapital des stillen Gesellschafters wird wie Fremdkapital betrachtet, weshalb ihm keine Mitbestimmungsrechte zustehen, außerdem erhält er eine Gewinnbeteiligung. Der Unternehmer zahlt also nur, wenn vertei-lungsfähiger Gewinn vorhanden ist.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Betrachtung der Stillen Gesellschaft (stGes). Zunächst wird die stGes allgemein betrachtet. Die Betrachtung geht dabei sowohl auf den Unternehmer als auch auf den Stillen ein. Zusätzlich wird die stGes im Unternehmens- und Steuerrecht besprochen, sowie die Bilanzierung der Stillen Gesellschaft. Im Anschluss daran erfolgt die Betrachtung der stGes im Kapitalverkehrssteuergesetz (KVG).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die stille Beteiligung im Gesellschaftsrecht
- 2.1 Aus der Sicht des Unternehmers
- 2.2 Aus der Sicht des stillen Gesellschafters
- 2.3 Abgrenzung zwischen typischer und atypischer stiller Gesellschaft
- 2.3.1 Der typisch stille Gesellschafter
- 2.3.2 Der atypisch stille Gesellschafter
- 3 Die stille Gesellschaft im Steuerrecht
- 3.1 Die steuerliche Behandlung der typischen stillen Beteiligung
- 3.1.1 Die typische stille Beteiligung im Privatvermögen
- 3.1.2 Die typisch stille Gesellschaft im Betriebsvermögen
- 3.1.3 Die Behandlung bei dem Unternehmer
- 3.2 Die steuerliche Behandlung der atypischen stillen Beteiligung
- 3.2.1 Die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung
- 3.2.2 Die Veräußerung der atypischen Beteiligung
- 3.2.3 Die Besteuerung beim atypisch stillen Gesellschafter
- 4 Die bilanzielle Behandlung der stillen Beteiligung
- 4.1 Die Bilanzierung der stillen Gesellschaft bei dem Unternehmer
- 4.1.1 Die Bilanzierung der Einlage
- 4.1.2 Die Bilanzierung der Gewinn- und Verlustbeteiligung
- 4.1.3 Die Bilanzierung der Gesellschaftsauflösung
- 4.2 Die Bilanzierung der stillen Gesellschaft bei dem Stillen
- 5 Die stille Beteiligung im KVG
- 5.1 Kapitalgesellschaften gemäß KVG
- 5.2 Gesellschaftsrechte gemäß KVG
- 5.3 Höhe und Fälligkeit der Gesellschaftssteuer
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die stille Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven, fokussiert auf die rechtlichen und steuerlichen Aspekte sowie die bilanzielle Behandlung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der stillen Gesellschaft im österreichischen Recht zu vermitteln.
- Gesellschaftsrechtliche Betrachtung der stillen Gesellschaft (typisch und atypisch)
- Steuerliche Implikationen der stillen Gesellschaft für den Unternehmer und den stillen Gesellschafter
- Bilanzielle Behandlung der stillen Gesellschaft
- Bedeutung der stillen Gesellschaft im Kapitalverkehrssteuergesetz (KVG)
- Abgrenzung der stillen Gesellschaft zu anderen Finanzierungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise und hebt die Bedeutung alternativer Finanzierungsmethoden, insbesondere der stillen Gesellschaft, hervor. Sie skizziert kurz die Struktur und den Inhalt der Arbeit.
2 Die stille Beteiligung im Gesellschaftsrecht: Dieses Kapitel analysiert die stille Gesellschaft aus der Perspektive des Unternehmers und des stillen Gesellschafters, unterscheidet zwischen typischen und atypischen stillen Gesellschaften und beleuchtet die jeweiligen rechtlichen Implikationen. Es wird die Abgrenzung zu anderen Gesellschaftsformen erörtert.
3 Die stille Gesellschaft im Steuerrecht: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der steuerlichen Behandlung sowohl der typischen als auch der atypischen stillen Beteiligung. Es werden die unterschiedlichen steuerlichen Konsequenzen für den Unternehmer und den stillen Gesellschafter je nach Art der Beteiligung detailliert beschrieben, inklusive der Gewinnfeststellung und der Besteuerung bei Veräußerung.
4 Die bilanzielle Behandlung der stillen Beteiligung: Dieses Kapitel befasst sich mit der korrekten Bilanzierung der stillen Gesellschaft sowohl aus der Sicht des Unternehmers als auch aus der Sicht des stillen Gesellschafters. Es werden die Bilanzierung der Einlage, der Gewinn- und Verlustbeteiligung und der Gesellschaftsauflösung eingehend erläutert.
5 Die stille Beteiligung im KVG: Das Kapitel untersucht die Relevanz der stillen Gesellschaft im Kontext des Kapitalverkehrssteuergesetzes (KVG), beleuchtet die spezifischen Regelungen für Kapitalgesellschaften und die damit verbundenen steuerlichen Aspekte, insbesondere bezüglich der Höhe und Fälligkeit der Gesellschaftssteuer.
Schlüsselwörter
Stille Gesellschaft, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bilanzierung, Kapitalverkehrssteuergesetz (KVG), typische stille Gesellschaft, atypische stille Gesellschaft, Unternehmer, stiller Gesellschafter, Gewinnbeteiligung, Finanzierung, Steuerliche Behandlung.
Häufig gestellte Fragen: Stille Gesellschaft im österreichischen Recht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die stille Gesellschaft im österreichischen Recht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf den gesellschaftsrechtlichen, steuerlichen und bilanziellen Aspekten sowie der Bedeutung im Kapitalverkehrssteuergesetz (KVG).
Welche Aspekte der stillen Gesellschaft werden behandelt?
Das Dokument behandelt die stille Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven: gesellschaftsrechtlich (typische und atypische stille Gesellschaft, Abgrenzung zu anderen Gesellschaftsformen), steuerrechtlich (steuerliche Behandlung für den Unternehmer und den stillen Gesellschafter, Gewinnfeststellung, Besteuerung bei Veräußerung), bilanziell (Bilanzierung der Einlage, Gewinn-/Verlustbeteiligung, Auflösung) und im Kontext des Kapitalverkehrssteuergesetzes (KVG).
Welche Arten stiller Gesellschaften werden unterschieden?
Es wird zwischen der typischen und der atypischen stillen Gesellschaft unterschieden. Die Unterschiede liegen insbesondere in den rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen für die beteiligten Parteien.
Wie wird die stille Gesellschaft steuerlich behandelt?
Die steuerliche Behandlung hängt von der Art der stillen Gesellschaft (typisch oder atypisch) ab und wird für den Unternehmer und den stillen Gesellschafter separat betrachtet. Es werden die Gewinnfeststellung und die Besteuerung bei Veräußerung der Beteiligung detailliert beschrieben.
Wie wird die stille Gesellschaft bilanziell behandelt?
Die Bilanzierung der stillen Gesellschaft wird sowohl aus der Sicht des Unternehmers als auch des stillen Gesellschafters erläutert. Die Bilanzierung der Einlage, der Gewinn- und Verlustbeteiligung sowie der Gesellschaftsauflösung wird detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielt die stille Gesellschaft im Kapitalverkehrssteuergesetz (KVG)?
Das Dokument untersucht die Relevanz der stillen Gesellschaft im Kontext des KVG, beleuchtet die spezifischen Regelungen für Kapitalgesellschaften und die damit verbundenen steuerlichen Aspekte, insbesondere bezüglich der Höhe und Fälligkeit der Gesellschaftssteuer.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende, Wissenschaftler, Steuerberater und alle, die sich mit den rechtlichen und steuerlichen Aspekten der stillen Gesellschaft im österreichischen Recht befassen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Stille Gesellschaft, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bilanzierung, Kapitalverkehrssteuergesetz (KVG), typische stille Gesellschaft, atypische stille Gesellschaft, Unternehmer, stiller Gesellschafter, Gewinnbeteiligung, Finanzierung, Steuerliche Behandlung.
- Citar trabajo
- Marén Kalz (Autor), 2008, Die stille Gesellschaft im Abgabenrecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138859