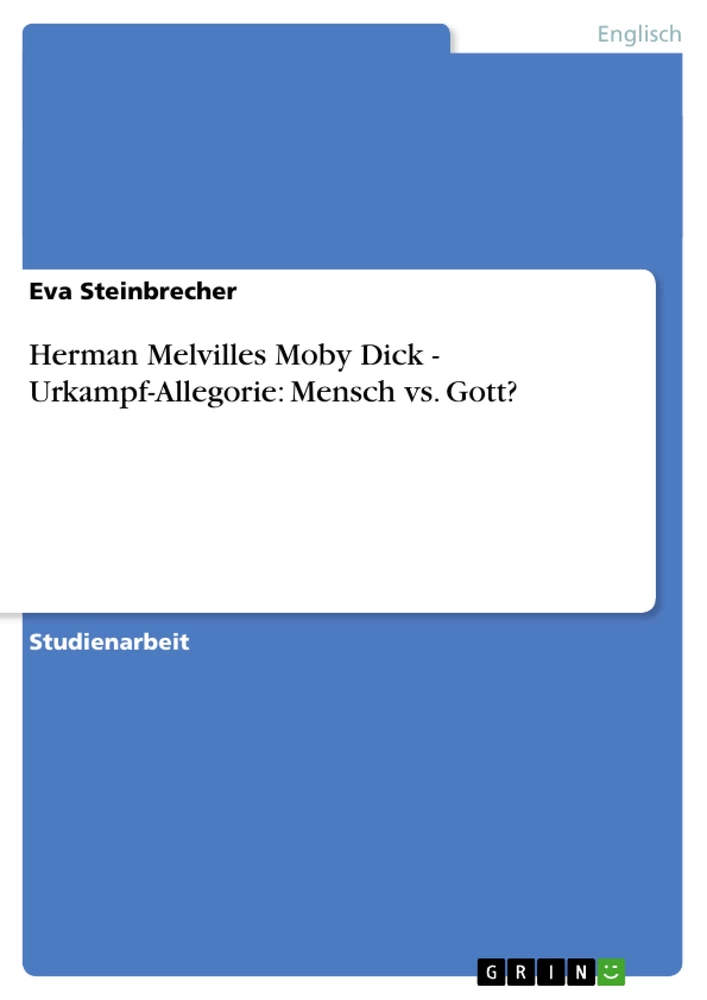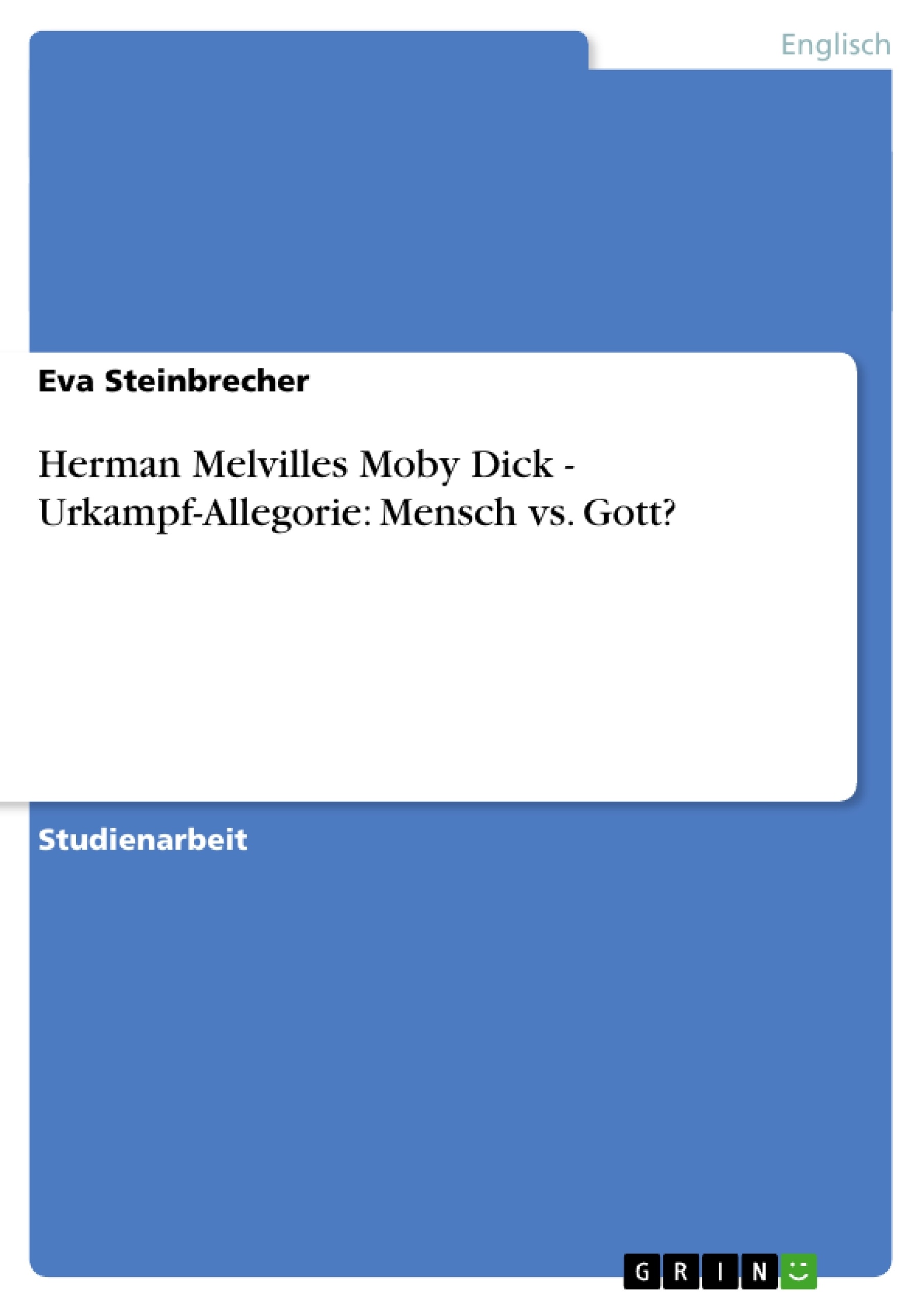Der Roman Moby Dick von H. Melville avancierte ohne Frage nach seiner Wiederentdeckung in der 1920er-Jahren zu einem Epos der amerikanischen Literaturgeschichte. Er ist nicht nur auf Grund des Buchumfangs, sondern vor allem ob der Vielschichtigkeit interpretatorischer Möglichkeiten, basierend auf theologischen, philosophischen, soziologischen u.a. Reminiszenzen, Grundlage diverser Analysen unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten, mit ebenso changierenden Resultaten, gewesen.
Ein äußerst relevanter Aspekt wurde bis dato in der Fachliteratur dieses Epos konsequent vernachlässigt: Der seit Menschen gedenken bestehende Kampf zwischen Menschen und Göttern. Es gilt, diese These durch die nachstehende Analyse zu verifizieren.
Über den Ursprung des Konfliktes, dessen Existenz in verschiedenen Religionen, als auch die Art der Ausprägung aus der Sicht der Menschen sollen anhand der in Moby Dick erwähnten Jonas- als auch Prometheuserzählung erläutert werden. Da weder der Prophet Jonas noch der Feuerbringer Prometheus handelnde Figuren als vielmehr romanrelevante Allegorien darstellen, ist eine jede Analyse gefolgt von deren Bedeutung für einen der Hauptprotagonisten, Kapitän Ahab, welcher kontextbezogen als Stellvertreter der Menschheit fungiert.
Die Darlegung der oben erwähnten These anhand der als Gleichnisse fungierenden Erzählungen wird durch den Einschub der Symbolanalyse der Elemente Feuer und Wasser ergänzt. Darauf hin gilt es zunächst zu klären, ob es sich bei dem vorliegenden Konflikt nicht unter Umständen um den Kampf der Elemente als den zwischen Menschen und Göttern handeln könnte.
Nachdem dieser Sachverhalt fundiert erörtert wurde, verbleibt die Aufgabe der Eingrenzung, Definierung und zu erfüllende Funktion der Figur des Ahab. Dies bildet die Grundlage für die abschließende Untersuchung über das Verhältnis der Götter zu den Menschen, welche nicht zuletzt durch den Versucht geprägt ist, das Handeln der Götter begreiflich zu machen und auf bestimmbare Gründe für ihr Handeln am Geschlecht des Menschen zurückzuführen.
Den Abschluss bildet ein komprimiertes Statement Erich Fromms über die Freiheit, deren Bedeutung nicht nur für die Menschheit, sondern für jedes einzelne Individuum und den daraufhin zu vollziehenden Kampf mit sich und seiner Umwelt, so wie Ahab es als Kapitän der Pequod durchlebt.
Inhaltsverzeichnis
1.0.) Einleitung
2.0.)Der Prophet Jonas in „The Sermon"
3.0.) Relevanz der Jonaserzählung im Kontext zu Ahab
4.0.) Melvilles Symbolik der Elemente Wasser und Feuer
4.1.) Melvilles Wassersymbolik
4.2.) Melvilles Feuersymbolik
5.0.) Griechische Mythologie in MD: Prometheus und das Feuer
6.0.) Kampf der Elemente?
7.0.) Der Urkampf: Menschheit vs. Götter
8.0) Ahabs Anklage an die Götter
9.0) Schlussbemerkung
1.) Einleitung
Der Roman Moby Dick von H. Melville avancierte ohne Frage nach seiner Wiederentdeckung in der 1920er-Jahren zu einem Epos der amerikanischen Literaturgeschichte. Er ist nicht nur auf Grund des Buchumfangs, sondern vor allem ob der Vielschichtigkeit interpretatorischer Möglichkeiten, basierend auf theologischen, philosophischen, soziologischen u.a. Reminiszenzen, Grundlage diverser Analysen unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten, mit ebenso changierenden Resultaten, gewesen.
Ein äußerst relevanter Aspekt wurde bis dato in der Fachliteratur dieses Epos konsequent vernachlässigt: Der seit Menschen gedenken bestehende Kampf zwischen Menschen und Göttern. Es gilt, diese These durch die nachstehende Analyse zu verifizieren.
Über den Ursprung des Konfliktes, dessen Existenz in verschiedenen Religionen, als auch die Art der Ausprägung aus der Sicht der Menschen sollen anhand der in Moby Dick erwähnten Jonas- als auch Prometheuserzählung erläutert werden. Da weder der Prophet Jonas noch der Feuerbringer Prometheus handelnde Figuren als vielmehr romanrelevante Allegorien darstellen, ist eine jede Analyse gefolgt von deren Bedeutung für einen der Hauptprotagonisten, Kapitän Ahab, welcher kontextbezogen als Stellvertreter der Menschheit fungiert.
Die Darlegung der oben erwähnten These anhand der als Gleichnisse fungierenden Erzählungen wird durch den Einschub der Symbolanalyse der Elemente Feuer und Wasser ergänzt. Darauf hin gilt es zunächst zu klären, ob es sich bei dem vorliegenden Konflikt nicht unter Umständen um den Kampf der Elemente als den zwischen Menschen und Göttern handeln könnte.
Nachdem dieser Sachverhalt fundiert erörtert wurde, verbleibt die Aufgabe der Eingrenzung, Definierung und zu erfüllende Funktion der Figur des Ahab. Dies bildet die Grundlage für die abschließende Untersuchung über das Verhältnis der Götter zu den Menschen, welche nicht zuletzt durch den Versucht geprägt ist, das Handeln der Götter begreiflich zu machen und auf bestimmbare Gründe für ihr Handeln am Geschlecht des Menschen zurückzuführen.
Den Abschluss bildet ein komprimiertes Statement Erich Fromms über die Freiheit, deren Bedeutung nicht nur für die Menschheit, sondern für jedes einzelne Individuum und den daraufhin zu vollziehenden Kampf mit sich und seiner Umwelt, so wie Ahab es als Kapitän der Pequod durchlebt.
2.0) Der Prophet Jonas in „The Sermon"
In dem neunten Kapitel Moby-Dick „The Sermon" schildert Melville die biblische Lehrgeschichte des Propheten Jonas. Die Jonasfigur —hinsichtlich des Charakters und Agierens für die Ahabfigur von erhebliche Relevanz -, soll einer prägnanten Beschreibung anhand der Lehrgeschichtszusammenfassung unterzogen werden. So kann einerseits der Bezug zur Ahabfigur herausgefiltert als auch belegt und anderseits Melvilles Intention im Kontext der Romanhandlung veranschaulicht werden. Der Prophet Jona (lat. Jonas) erhält von Gott die Aufgabe, der Bevölkerung Ninives auf Grund deren Schlechtigkeit ihren bevorstehenden Untergang zu verkünden.1 Jonas ist jedoch nicht gewillt, die Botschaft Gottes zu verkündigen. Er beschließt per Schiff in die entgegengesetzte Richtung Ninives davon zu segeln und somit die Flucht anzutreten. Gott, welcher nach dem Glauben des Pantheismus in allen Dingen dieser Welt existent und präsent ist, entgeht Jonas Flucht selbstverständlich nicht. Nachdem das Schiff den sicheren Hafen verlassen hatte, erhob sich ein von Gott bewirkter, gewaltiger Seesturm auf den Meeren. Die Seeleute waren ob der Heftigkeit des Sturmes und des unvorhersehbaren Auftretens zutiefst erschrocken. Sie versuchten durch seglerische Manöver und Überbordwerfen der Fracht das Schiff vor dem Kentern zu bewahren. Da aber durch keine Tat eine sichtbare Milderung der Umstände eintraf, ahnte die Besatzung bald, dass dieses Unglück übernatürlich sein musste. Alsbald verfielen sie auf den Gedanken, dass die Anwesenheit Jonas jenes Unwetter hervorgerufen haben musste. Jonas gestand auf Nachfrage, unter entsetzlichster Angst, sofort seine Flucht vor Gott ein, erklärte sich heroisch bereit, für seine Entscheidung Gott zu fliehen, die Konsequenzen zu ziehen und stürzte sich in die wogenden Fluten, um den Zorn Gottes vom Schiff und der Mannschaft zu nehmen und zu besänftigen. Nach seinem Sprung in das wogende Meer beruhigt sich dieses kurze Zeit darauf. Verlassen und allein trieb der Prophet in den unendlichen Weiten der Meere. Doch trotz Jonas Ungehorsam wandte Gott sich nicht von ihm ab. Er entsandt einen großen Fisch, welcher den Propheten mit Haut und Haaren verschlingen sollte. dieser tat wie ihm geheißen. Jonas, im finsteren Bauch des Fisches, überwältigt von Angst, begann zum ersten Mal durch beten zu Gott zu Fisch Jonas nach drei Tagen des Verweilens in völliger Dunkelheit, an Land aus. Jonas, nicht bekehrt aber einsichtiger, nahm nach diesem Vorfall seine von Gott auferlegte Bestimmung an und verkündete wie ihm geheißen wart, der Bevölkerung sprechen. Er betete, bat um Errettung und wurde erhört. Auf Geheiß Gottes spie der von Ninive die verheerende Prophezeiung. Als die Niniviten von dem bevorstehenden Unheil erfuhren, waren sie zutiefst erschrocken. Sogleich begannen sie zur Abwendung des Unheils und, zur Überraschung Jonas, sich selbst und ihre Tiere in Bußgewänder zu kleiden und zu Fasten. Das Geschehen wurde von Gottes Aufmerksamkeit achtsam verfolgt. Er erbarmte sich ihrer uns sah von der Zerstörung Ninives ab.
Und Gott sah ihr Verhalten [der Niniviten]; er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. 2 (m.H.)
Dieses, in Jonas Augen nachgiebige Verhalten Gottes, erboste ihn zutiefst. Schließlich erschien er in den Augen einiger Ungläubiger als falscher Prophet, als Lügner und, von gewichtiger Bedeutung für das Individuum Jonas: Er fühlt sich von Gott betrogen, arglistig hintergangen.
Welche Anspielungen, Parallelen, Schlussfolgerungen sind aus der Jonaserzählung in Bezug auf den Handlungsverlauf des Romans, auf die Figur des Ahab zu extrahieren? Als die zunächst evidenteste Parallele zu Melvilles Moby-Dick mag die Erwähnung des von Gott gesandten großen Fisches sein, welcher auf den Wal in Melvilles Roman anspielt. Anzumerken ist, dass in der Bibel nicht von einem Wal, sondern ausdriicklich die Rede von einem groBen Fisch ist. „Der Herr aber schickte einen groBen Fisch, der Jona verschlang."3 Da der Fisch den Propheten vollständig verschluckt, ist die Hypothese, dass es sich bei diesem Tier um einen Wal handeln könnte, possibel. Versetzt man sich ferner gedanklich in die Zeit der Niederschrift der Jonasgeschichte (5.-3.Jh.v. Chr.), muss der Umstand berücksichtigt werden, dass die Menschen zu jener Zeit den Wal als Tier nicht kannten, sondern lediglich als „groBen Fisch" zufallig auf den Weltmeeren erspahten.
Die bloße Erwähnung eines großen Fisches innerhalb der Bibelerzählung kann zweifelsohne keine ausreichende Grundlage darstellen, um von Melville in die Romanhandlung Moby-Dick aufgenommen, noch dazu in einem separaten Kapitel bearbeitet zu werden. Diese Hypothese wird durch Inklusion des Charakters und Movens des Agierens Jonas gegenüber Gott illustriert.
Welche additiven Konnotationen durch die Jonaserzählung für den Roman, handelnden Protagonisten — vornehmlich Ahab — entstehen, welches literarische Hilfsmittel Melville zur Veranschaulichung verwendete und welcher Zweck damit erfüllt werden soll, wird Gegenstand des folgenden Abschnitts sein.
3.0) Relevanz der Jonaserzählung im Kontext zu Ahab
Wie unter dem vorangegangenem Punkt 2.0 bereits erwähnt, widmet Melville der Jonaserzählung ein eigenständiges Kapitel. Die Erzählung ist von Melville keineswegs geistlos niedergeschrieben, sondern mit Charme und Einfallsreichtum anhand der Predigt eines Pfarrers, Vater Mapple, lebendig geschildert. Der Pfarrer weiß seiner Gemeinde die Jonasgeschichte gekonnt mit seiner persönlich intendierten Botschaft zu verknüpfen. Eine seiner zahlreichen Bemerkung, einem Aphorismus gleich, lautet: „And if we obey God, we must disobey ourselves; and it is in this disobeying ourselves, wherein the hardness of obeying God consists."4 Wer Gott gehorcht, kann sich selber nicht gehorchen. Wer sich selber nicht gehorchen kann oder darf, dem fällt es folglich schwer, Gott Folge zu leisten. Relevant ist, dass der Prophet Jonas nicht zum gottesfürchtigen Propheten stilisiert, sondern vielmehr als vom eigenen Willen geleiteter Mensch, demaskiert wird. Demaskiert auch im Sinne eines nach Autonomie strebenden, handelnden Individuums. Weder ist Jonas gotteshörig, noch williger Jünger, oder eifrig im Ausführen von Befehlen Gottes. Imaginieren gläubige Christen Propheten nicht konträr, präzise als willenlos hörig, Gott ergeben, ständig bereit vorgegebene Gebote gedankenfrei auszuführen? Es sind genau jene Charakteristika, derer Melville sich bedient und auf Ahab appliziert. Melvilles Fokus ist auf die mentale Autonomie des Jonas gerichtet. Auf eine Figur, die sich souverän aufoktroyierten Befehlen verweigert, nach eigenem Ermessen Entscheidungen trifft, Handlungen vollführt. Motiviert durch diesen Fokus, kristallisiert Melville die Bedeutung Jonas für den Charakter Ahabs heraus.
Melville legt dem potenziellen Leser unter keinen Umständen die Beschreibung eines idealen Propheten, als vielmehr die Charakterisierung eines Individuums, welches der Existenz Gottes zum Handeln nicht bedarf, vor. Durch dieses Kapitel wird eine nicht zu unterschätzende blasphemische Einstellung verdeutlicht, die bereits während der Veröffentlichung des Romans1851 als Grund für Ärgernis und Empörung in der amerikanischen Bevölkerung gereichte.
Hervorzuheben ist, dass Jonas nicht aus rigorosem Unwillen gegen Gottes Befehle handelt. Anstatt diese folgsam anzunehmen, auszuführen, hinterfragt und überlegt er. Hierin ist der Grund auszumachen, weshalb er die Flucht vor Gott nicht als Ungehorsam gegenüber demselbigen begreift. Er legitimiert seine Tat durch eigenständiges Denken und zu Gott über dessen Begnadigung der Bürger Ninives folgendes sagt:
Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen; denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. 5
Durch die Handlung des reflektierend, denkenden Jonas ist die Hierarchie zwischen dem omnipotenten, allwissenden Gott auf der einen Seite und dem Prophezeiung empfangenden Handlanger Gottes auf der anderen Seite aufgehoben. Für Jonas existiert keine derartige, festgesetzte Rangordnung. Für Gott und dessen gläubige Anhänger ist diese Hierarchie eo ipso existent, welche oftmals 8auch heutzutage) als solche im negativen Sinne weder perzipiert noch realisiert wird. Eine derartige Wahrnehmung präpositioniert reflektiertes, differenziertes Denken.
Daraus ist zu folgern, dass Jonas mit Hilfe des Verstandes nicht nur Gottes Befehl hinterfragt, sondern den Pantokrator, den omnipotenten, omnipräsenten Gott einschätzt und in letzter Instanz zu der blasphemisch anmutenden Urteils-Entscheidung über dessen wahrscheinliches Handeln gelangt. Welche Schluss-Folgerung resultieren daraus, appliziert man die bis dato gewonnen Erkenntnisse auf die Figur des Ahab?
Melville gebraucht die Jonaserzählung als Allegorie, welche, da so vorzeitig innerhalb des Romans angeführt, zwar auf den weiteren Handlungsverlauf bezogen ist, die Handlung jedoch nicht vorwegnimmt. Vielmehr ist sie durch das Voranschreiten des Lesers im weiteren Romanverlauf vom selbigen zu dekuvrieren.
[...]
1 Die Bibel, Das Buch Jona, Trier 2002.
2 Die Bibel, Das Buch Jona, Jona 3,10-4,2.
3 Die Bibel, Das Buch Jona, Jona 2.
4 Hermann Melville, Moby Dick, A Norton Critical Edition, (New York, 2002) K.9, S.49. 4
5 Die Bibel, Das Buch Jona, Jona, 4.2-3.
- Quote paper
- M.A. Eva Steinbrecher (Author), 2006, Herman Melvilles Moby Dick - Urkampf-Allegorie: Mensch vs. Gott?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138772