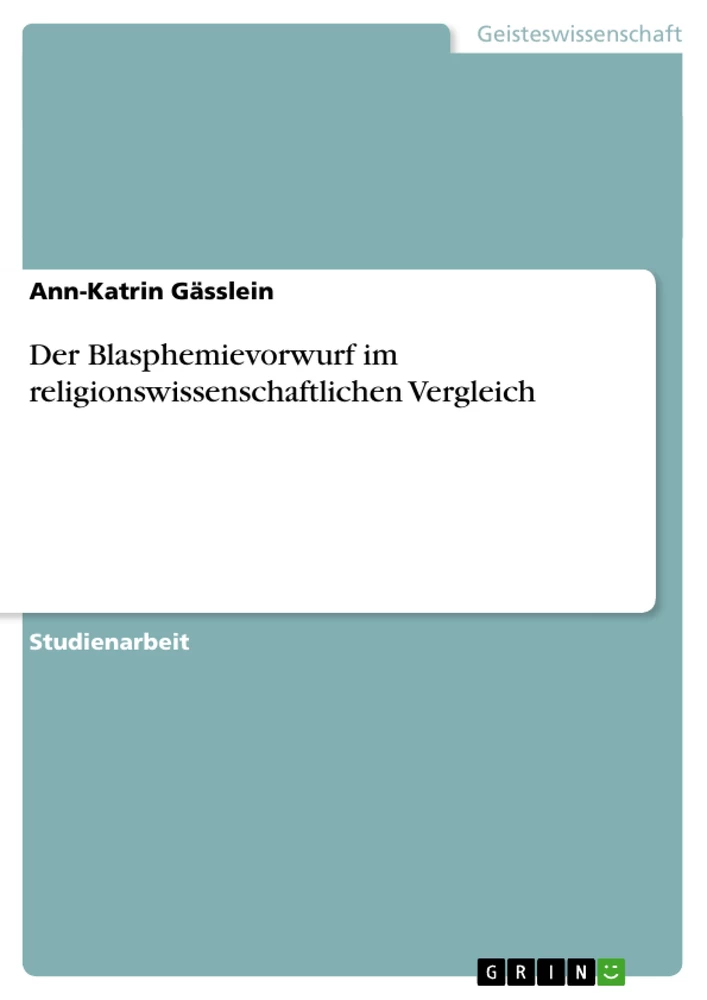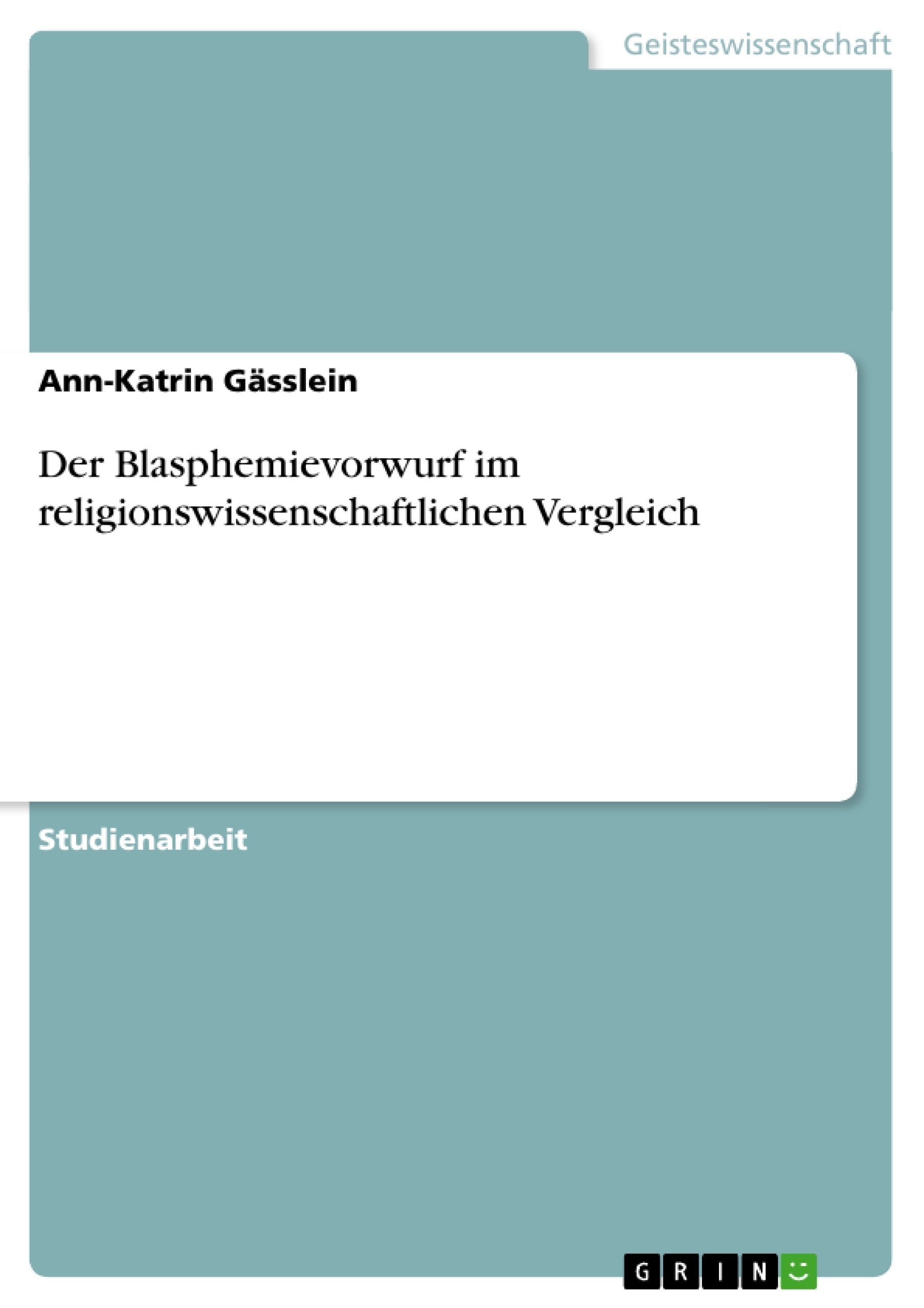[...] Da dieses
Thema nicht nur im Islam, sondern auch in anderen Religionen eine Rolle spielt, kam ich auf
die Idee, Blasphemie in einem religionswissenschaftlichen Vergleich zu untersuchen.
Der Vorwurf der Blasphemie ist eng mit der europäischen Kulturgeschichte verbunden und
weist gleichzeitig eine hohe aktuelle Brisanz auf. Wenn man einmal anfängt, in der
Geschichte nach Fällen zu stöbern, in denen dieser Vorwurf erhoben wurde oder gar zu einem
gerichtlichen Prozess geführt hat, sieht man sich schnell einer gewaltigen Menge von Material
gegenüber. Allein die Blasphemie-Fälle in der mittelalterlichen Geschichte der römischkatholischen
Kirche können schon Bände füllen. Der Historiker Alan Cabantous hat sich
dieses enorme Projekt vorgenommen.1 Dabei könnte man das Augenmerk auf Blasphemie in
der frühchristlichen Zeit richten, als die eben entstandene Kirche mit der Kanonisierung
beschäftigt war, um eine einheitliche Lehre rang und sich in diesem Kontext mit
„abweichenden Meinungen“ konfrontiert sah.2 Die Entwicklung des Protestantismus und der
Religionskriege könnte unter dem Gesichtspunkt der Blasphemie untersucht werden.3
Oder man konzentriert sich auf die mystischen Bewegungen im Christentum, Islam oder
Judentum und untersucht den Blasphemievorwurf bei grossen spirituellen Lehrmeistern:
Diese sprachen aus der unmittelbar eigenen Gottesschau und gingen damit über die Lehren
der Bibel und der kirchlichen Dogmen weit hinaus. Dazu zählen zum Beispiel Meister
Eckehart, der als Ketzer angeklagt und verfolgt wurde,4 oder Al-Halladsch aus der
islamischen Mystik.5
Die Fragestellung dieser Arbeit lässt die oben genannten Aspekte bewusst ausser Acht und
geht dahin, welche Elemente von Blasphemie nicht mehr ausschliesslich mit der jeweiligen
Religion zusammenhängen, in deren Kontext sie geschieht, d. h. welche „Gemeinsamkeiten“
sich in Blasphemiefällen feststellen lassen.
1 Cabantous, Geschichte
2 Religion in Geschichte und Gegenwart, Sp. 1441ff.
3 ebd., Sp. 1445ff.
4 Meister Eckehards Satz „Wer Gott selbst lästert, lobt Gott“ wurde mit einem Bannfluch belegt, vgl.
www.regina-berlinghof.de/mystik.htm: Die Antworten der Mystiker auf Gotteslästerung. Nachträge zur
Diskussion um Salman Rushdie und Annemarie Schimmel
5 Al-Halladsch schockierte öffentlich mit seinem Ausspruch „Ana l-haqq – Ich bin die göttliche Wahrheit“5 und
wurde schließlich hingerichtet, vgl. Vogel, Blasphemie, S. 20
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Herkunft und Bedeutung von Blasphemie
- 3. Vormoderne Blasphemie
- 3.1 Der Fall Sokrates
- 3.2 Der Fall Jesus von Nazareth
- 4. Moderne Blasphemie
- 4.1 Der Fall George Grosz
- 4.2 Skandal um Jesus Christus - eine kleine Chronik
- 4.3 Der Fall Salman Rushdie
- 4.5 „Die Satanischen Verse“
- 5. Formaler Vergleich: „Christus mit der Gasmaske“ und „Die Satanischen Verse“
- 5.1 Medium
- 5.2 Form
- 5.3 Inhalt
- 5.4 Motivation
- 6. Voraussetzungen für Blasphemie
- 6.1 Objektive Voraussetzungen
- 6.2 Subjektive Voraussetzungen
- 7. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Blasphemievorwurf im religionswissenschaftlichen Vergleich. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten in Blasphemiefällen verschiedener Religionen und Epochen zu identifizieren, unabhängig vom jeweiligen religionsspezifischen Kontext. Die Arbeit analysiert ausgewählte Fälle, um die Definition und die Voraussetzungen für Blasphemie zu beleuchten.
- Definition und historische Entwicklung des Blasphemiebegriffs
- Vergleich von Blasphemiefällen aus verschiedenen Religionen (antikes Griechenland, Judentum, Christentum, Islam)
- Analyse der objektiven und subjektiven Voraussetzungen für Blasphemie
- Untersuchung der Gemeinsamkeiten in der Kommunikation und Wahrnehmung von Blasphemie
- Religionswissenschaftliche Perspektive auf den Blasphemievorwurf
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Blasphemie ein und erläutert die Motivation der Autorin, den religionswissenschaftlichen Vergleich als Untersuchungsmethode zu wählen. Sie beschreibt den Umfang des Themas und die Auswahl der zu untersuchenden Fälle, die sowohl aus der vormodernen als auch der modernen Geschichte stammen und eine breite religionsvergleichende Basis bilden. Die Arbeit fokussiert sich auf Gemeinsamkeiten der Blasphemiefälle, unabhängig von ihrem religionsspezifischen Kontext.
2. Herkunft und Bedeutung von Blasphemie: Dieses Kapitel erörtert die etymologische Herkunft des Begriffs „Blasphemie“ aus dem Griechischen und dessen Entwicklung im jüdischen und römischen Recht. Es analysiert den Bedeutungswandel des Begriffs von einer allgemeinen Schmähung hin zu einer spezifischen Verletzung religiöser Gebote und Glaubensvorstellungen. Die Arbeit stützt sich auf die Definition von Gereon Vogel, der Blasphemie als Äußerungen beschreibt, die das Selbstverständnis von Gläubigen in ihren wesentlichen Elementen gefährden. Die Bedeutung einer „Kommunikationsgemeinschaft“ wird hervorgehoben, um die Relevanz der öffentlichen Anschuldigung zu unterstreichen.
3. Vormoderne Blasphemie: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert zwei Fallbeispiele vormoderner Blasphemie: den Fall Sokrates und den Fall Jesus von Nazareth. Es beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte und Ausprägungen von Blasphemie in polytheistischen und monotheistischen Kontexten. Durch den Vergleich dieser beiden Fälle wird die Entwicklung und die Vielschichtigkeit des Blasphemievorwurfs über verschiedene religiöse Traditionen hinweg veranschaulicht, welche trotz verschiedener historischer und religiöser Kontexte Gemeinsamkeiten aufweisen. Die jeweilige gesellschaftliche und religiöse Reaktion auf die Handlungen der beiden Personen wird untersucht.
4. Moderne Blasphemie: Dieses Kapitel behandelt moderne Fälle von Blasphemie, darunter George Grosz' „Christus mit der Gasmaske“ und die Kontroverse um Salman Rushdies „Satanische Verse“. Es analysiert die Fälle im Hinblick auf Medium, Form, Inhalt und Motivation, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zur vormodernen Blasphemie aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Reaktionen auf die jeweiligen Werke und die Rolle der Medien in der Verbreitung und der Eskalation der Debatten. Die Analyse zeigt die anhaltende Brisanz des Blasphemievorwurfs in der heutigen Zeit.
5. Formaler Vergleich: „Christus mit der Gasmaske“ und „Die Satanischen Verse“: Hier erfolgt ein detaillierter Vergleich der beiden ausgewählten modernen Beispiele von Blasphemie, unter Berücksichtigung von Medium, Form, Inhalt und Motivation der Werke. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen künstlerischen und literarischen Ausdrucksmittel und die jeweiligen Reaktionen darauf. Der Vergleich hebt sowohl die spezifischen als auch die gemeinsamen Aspekte der Blasphemievorwürfe hervor. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Kontext der jeweiligen zeitgeschichtlichen und soziokulturellen Umstände betrachtet.
6. Voraussetzungen für Blasphemie: Dieses Kapitel untersucht die objektiven und subjektiven Voraussetzungen für Blasphemie. Die objektiven Voraussetzungen beziehen sich auf den gesellschaftlichen Kontext, während die subjektiven Voraussetzungen die persönlichen Hintergründe des Blasphemikers betreffen. Es wird analysiert, inwiefern diese Voraussetzungen auf die zuvor vorgestellten Beispiele zutreffen und ob es Gemeinsamkeiten gibt, die unabhängig von ihrem historischen und religionsspezifischen Kontext sind. Diese Analyse zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis der Dynamik des Blasphemievorwurfs zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Blasphemie, Religionswissenschaft, Vergleichende Religionswissenschaft, Gotteslästerung, Salman Rushdie, George Grosz, Moderne Blasphemie, Vormoderne Blasphemie, Kommunikationsgemeinschaft, Objektive Voraussetzungen, Subjektive Voraussetzungen, Religionsvergleich, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit Blasphemie
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Blasphemievorwurf religionswissenschaftlich vergleichend. Ziel ist die Identifizierung von Gemeinsamkeiten in Blasphemiefällen verschiedener Religionen und Epochen, unabhängig vom religionsspezifischen Kontext. Ausgewählte Fälle werden analysiert, um Definition und Voraussetzungen von Blasphemie zu beleuchten.
Welche Fälle von Blasphemie werden untersucht?
Die Arbeit analysiert sowohl vormoderne (Sokrates, Jesus von Nazareth) als auch moderne Fälle (George Grosz' „Christus mit der Gasmaske“, Salman Rushdies „Satanische Verse“). Dieser religionsvergleichende Ansatz umfasst antikes Griechenland, Judentum, Christentum und Islam.
Wie wird Blasphemie in der Arbeit definiert?
Die Arbeit stützt sich auf Gereon Vogels Definition von Blasphemie als Äußerungen, die das Selbstverständnis von Gläubigen in ihren wesentlichen Elementen gefährden. Die Bedeutung einer „Kommunikationsgemeinschaft“ und der öffentlichen Anschuldigung wird hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Herkunft und Bedeutung von Blasphemie, Vormoderne Blasphemie, Moderne Blasphemie, Formaler Vergleich von „Christus mit der Gasmaske“ und „Die Satanischen Verse“, Voraussetzungen für Blasphemie und Schluss. Jedes Kapitel analysiert Aspekte der Blasphemie und deren Kontext.
Wie werden die modernen und vormodernen Blasphemiefälle verglichen?
Der Vergleich erfolgt anhand von Kriterien wie Medium, Form, Inhalt und Motivation der jeweiligen Äußerungen. Die kulturellen und gesellschaftlichen Reaktionen sowie die Rolle der Medien werden ebenfalls untersucht.
Welche Voraussetzungen für Blasphemie werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen objektiven Voraussetzungen (gesellschaftlicher Kontext) und subjektiven Voraussetzungen (persönliche Hintergründe des „Blasphemikers“). Es wird untersucht, inwieweit diese Voraussetzungen auf die untersuchten Fälle zutreffen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Blasphemie, Religionswissenschaft, Vergleichende Religionswissenschaft, Gotteslästerung, Salman Rushdie, George Grosz, Moderne Blasphemie, Vormoderne Blasphemie, Kommunikationsgemeinschaft, Objektive Voraussetzungen, Subjektive Voraussetzungen, Religionsvergleich, Kulturgeschichte.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten in der Definition, Wahrnehmung und den Voraussetzungen von Blasphemie über verschiedene Religionen und Epochen hinweg aufzuzeigen, trotz unterschiedlicher religionsspezifischer Kontexte.
Welche Methode wird in der Arbeit angewandt?
Die Arbeit verwendet einen religionswissenschaftlichen Vergleich als Untersuchungsmethode, um Gemeinsamkeiten in Blasphemiefällen unabhängig vom jeweiligen Kontext zu identifizieren.
Für wen ist diese Seminararbeit gedacht?
Diese Seminararbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für Religionswissenschaft, Vergleichende Religionswissenschaft und die Geschichte der Blasphemievorwürfe interessiert.
- Quote paper
- Ann-Katrin Gässlein (Author), 2003, Der Blasphemievorwurf im religionswissenschaftlichen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13861