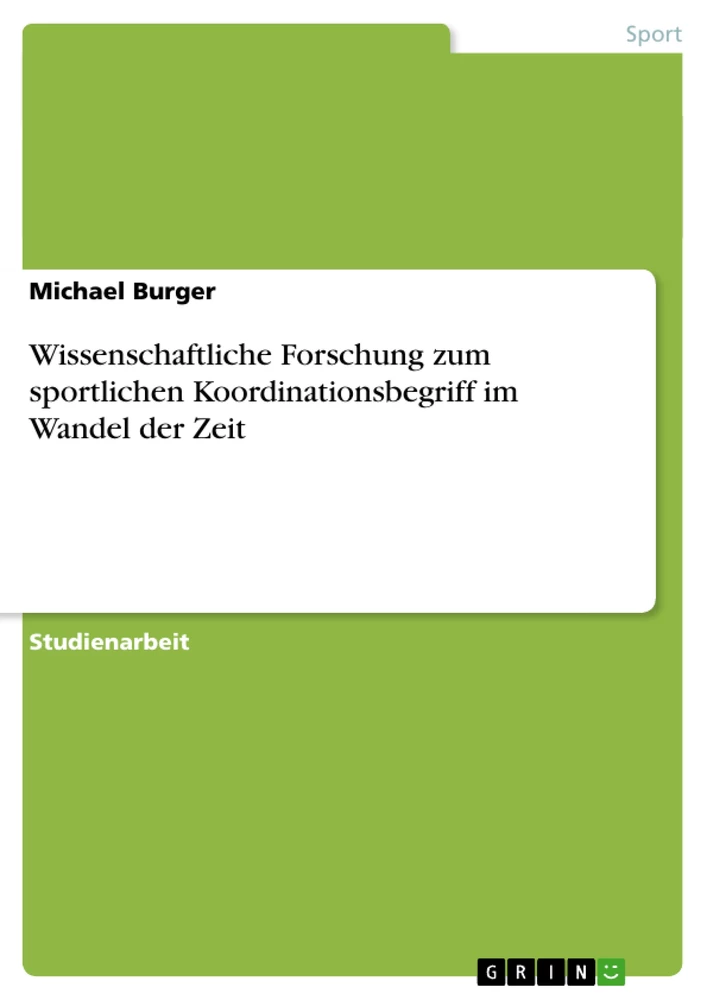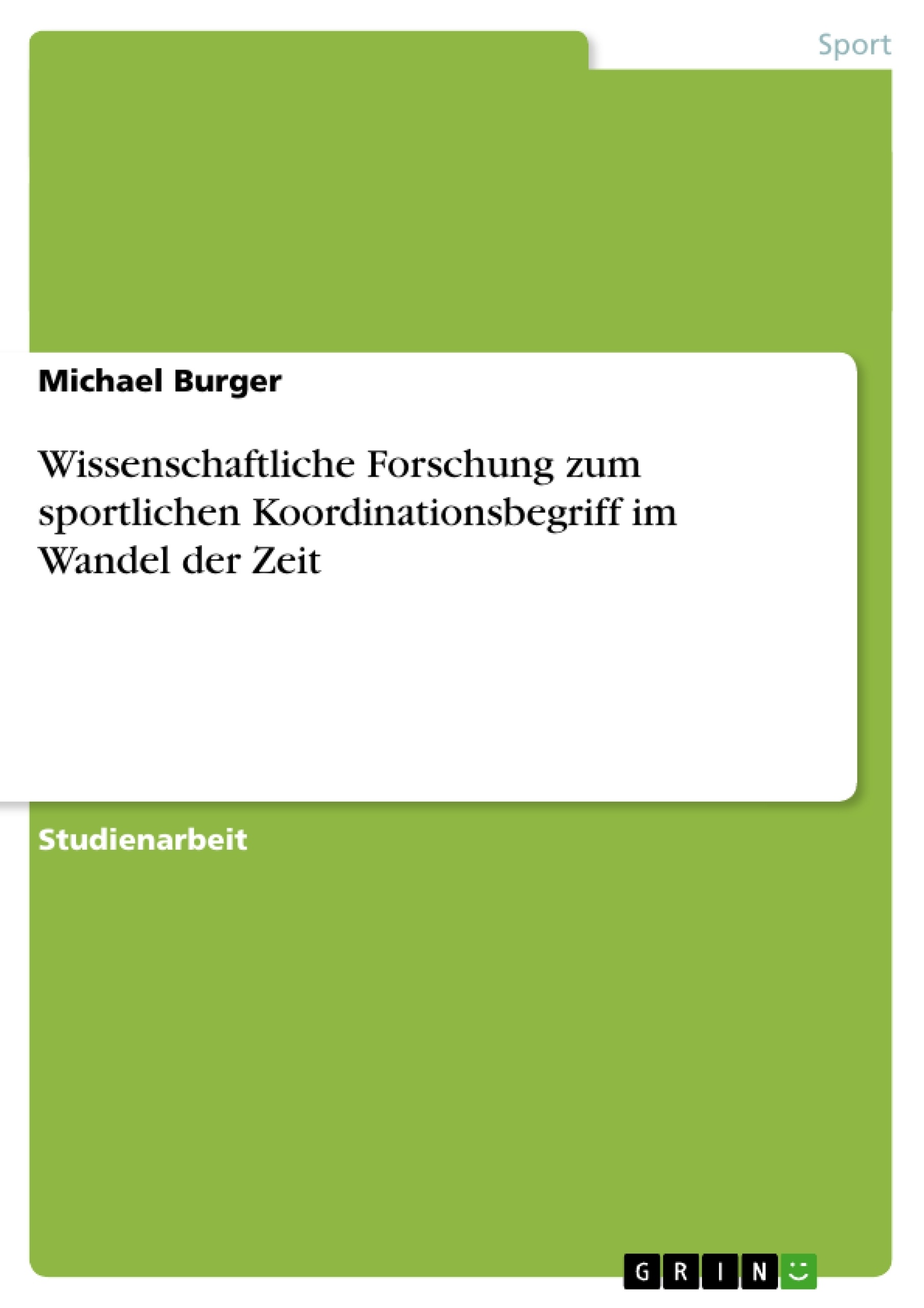1 Einleitung
Eine funktionierende und zielgerichtete Koordination ist zur erfolgreichen Ausführung von sportlichen wie alltäglichen Bewegungen eine unerlässliche Voraussetzung. Bezüglich dieser Tatsache sind sich die verschiedenen Forschungsbereiche, die unter dem Mantel der Sportwissenschaft zusammengefasst werden, seit langem einig. Die bewegungswissenschaftliche Disziplin der Koordinationsforschung beschäftigt sich bereits seit geraumer Zeit zum Einen mit einer wissenschaftlich fundierten Kategorisierung des theoretischen Konstrukts „Koordination“, sowie zum Anderen mit (sport-) praktischen Anwen-dungsmöglichkeiten eben dieser Kategorisierungen auf der Praxisebene. Rechtfertigen lassen sich diese Forschungsansätze durch ein erweitertes Ver-ständnis der menschlichen Motorik, was letztenendes zu optimierter Trainingsanwendung und Leistungssteigerungen führen sollte.
Definiert wird Koordination auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner als ein Zusammenwirken von Zentralnervensystem und Skelettmuskulatur innerhalb eines gezielten Bewegungsablaufs (Hollmann & Strüder, 2009).
2 Die Ursprünge – Koordinative Fähigkeiten
Die Erforschung der Koordination von Bewegungsabläufen aller Art hat ihren Ursprung im allgemeinen Fähigkeitsansatz. Eine Fähigkeit stellt dabei per Definition eine relativ (zeitlich und situativ) überdauernde Verhaltensdisposition einer Person dar (Hohmann, Lames & Letzelter, 2007). Für die Sportpraxis übersetzt bedeutet das, dass ein für eine Bewegungsgruppe erworbenes Fähigkeitsniveau beliebig auf andere Bewegungen übertragbar sein sollte. So gehen die Fähigkeitstheoretiker davon aus, dass ein von einer Versuchsperson gezeigtes Verhalten, bei einer ihr gestellten Bewegungsaufgabe, Rückschlüsse auf das Fähigkeitsniveau im angenommenen motorischen Steuerungsbereich zulässt. Zeigt ein Proband also beispielsweise gute Leistungen bei einer bestimmten Balancieraufgabe, so ergäbe sich daraus die logische Folgerung, dass jene Versuchsperson zum Einen eine gut ausgebildete Gleichgewichtsfähigkeit besitzen muss und zum Anderen diese internalisierte Fähigkeit auch auf andere Bewegungsaufgaben anwenden kann und folglich bei diesen dementsprechend ebenfalls gut abschneiden würde. Den motorischen Fähigkeiten gegenüber stehen die motorischen Fertigkeiten, welche laut Roth (1999) der Realisierung jeweils spezifischer Bewegungen zugrunde liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ursprünge – Koordinative Fähigkeiten
- Die Greifswalder Forschungsgruppe um Hirtz
- Das Leipziger Modell
- Praxisbezogenes Modell im Bereich Rückschlagspiele
- Neuere Herangehensweisen und alternative Ansätze
- Das Strukturmodell zu koordinativen Anforderungskategorien
- Fertigkeitsspezifische Ansätze
- Interdisziplinäre Ansätze
- Das Expertisemodell
- Synergetik
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze in der Entwicklung der sportwissenschaftlichen Koordinationsforschung. Ziel ist es, die verschiedenen Konstrukte kritisch zu hinterfragen und ein erweitertes Verständnis der menschlichen Motorik zu vermitteln, das zu optimierter Trainingsanwendung und Leistungssteigerung führt.
- Entwicklung der Koordinationsforschung
- Kategorisierung des Konstrukts „Koordination“
- (Sport-)praktische Anwendungsmöglichkeiten von Koordinationskategorisierungen
- Kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Forschungsansätzen
- Zusammenwirken von Zentralnervensystem und Skelettmuskulatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die essentielle Rolle einer funktionierenden Koordination für sportliche und alltägliche Bewegungen. Sie erläutert das Forschungsinteresse der Koordinationsforschung an der Kategorisierung von Koordination und deren praktischen Anwendungen. Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Ansätze in der Koordinationsforschung zu präsentieren und kritisch zu hinterfragen, um letztendlich zu einem optimierten Verständnis von menschlicher Motorik und Leistungssteigerung beizutragen. Die Definition von Koordination als Zusammenspiel von Zentralnervensystem und Muskulatur wird eingeführt, und der Bezug zur "Gewandtheit" als Fähigkeit zur schnellen Problemlösung im motorischen Bereich wird hergestellt. Die Arbeit stellt die koordinativen Fähigkeiten den konditionellen Fähigkeiten gegenüber, um deren komplexe Interaktion zu verdeutlichen.
Die Ursprünge - Koordinative Fähigkeiten: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der Koordinationsforschung im Fähigkeitsansatz. Es erklärt das Konzept der Fähigkeiten als zeitlich und situativ überdauernde Verhaltensdispositionen und ihre Übertragbarkeit auf verschiedene Bewegungen. Der Fokus liegt auf der Annahme, dass beobachtetes Verhalten Rückschlüsse auf das Fähigkeitsniveau erlaubt. Der Unterschied zwischen motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten wird verdeutlicht, wobei Fertigkeiten als Grundlage für spezifische Bewegungen beschrieben werden. Dieses Kapitel legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, die sich mit verschiedenen Modellen und Ansätzen der Koordinationsforschung befassen.
Die Greifswalder Forschungsgruppe um Hirtz: Dieses Kapitel beschreibt die groß angelegte induktive Feldstudie der Greifswalder Forschungsgruppe um Peter Hirtz. Die Studie untersuchte mittels sportmotorischer Tests bei Kindern (7-16 Jahre) koordinative Fähigkeiten, um diese im Sportunterricht gezielt fördern zu können. Die Anwendung der Faktorenanalyse zur Extraktion koordinativer Fähigkeiten aus den Testergebnissen wird erläutert, sowie die Kritik an dieser Methode, die vor allem auf dem Bedarf an großen Datenmengen und der relativen Geschlossenheit des Ergebnisrahmens beruht. Die Kritik betont, dass die Ergebnisse stark von den gewählten Tests abhängen ("man bekommt nur das heraus, was man reingesteckt hat").
Das Leipziger Modell: Dieses Kapitel diskutiert das Leipziger Modell, das auf den Ergebnissen der Hirtz’schen Studie aufbaut. Meinel und Schnabel betonen die Bedeutung einer ganzheitlichen Ausbildung der Koordination für Sportler und Schulkinder, um das Erlernen neuer Bewegungsfertigkeiten zu verbessern und den energetischen Funktionsgrad zu optimieren. Das Leipziger Modell reduziert die Vielzahl an Fähigkeitssystemen auf sieben essentielle koordinative Fähigkeiten: Differenzierungs-, Kopplungs-, Reaktions-, Orientierungs-, Gleichgewichts-, Umstellungs- und Rhythmusfähigkeit. Es geht um eine Vereinfachung und Strukturierung der verschiedenen Lehrmeinungen zu Koordinationsfähigkeiten.
Schlüsselwörter
Koordination, Koordinative Fähigkeiten, Bewegungswissenschaft, Sportwissenschaft, Fähigkeitsansatz, Greifswalder Modell, Leipziger Modell, Faktorenanalyse, Motorik, Leistungssteigerung, Trainingsanwendung, Gewandtheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Seminararbeit: Entwicklung der Koordinationsforschung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Ansätze in der sportwissenschaftlichen Koordinationsforschung. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der kritischen Hinterfragung verschiedener Konstrukte und der Vermittlung eines erweiterten Verständnisses der menschlichen Motorik zur Optimierung von Training und Leistungssteigerung.
Welche Forschungsansätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene historische und aktuelle Ansätze zur Erforschung von Koordination. Dies beinhaltet die Greifswalder Forschungsgruppe um Hirtz mit ihrer induktiven Feldstudie und dem daraus entstandenen Leipziger Modell von Meinel und Schnabel. Zusätzlich werden neuere Herangehensweisen und alternative Ansätze wie strukturmodellbasierte Kategorisierungen, fertigkeitsspezifische Ansätze, interdisziplinäre Ansätze (Expertisemodell, Synergetik) diskutiert.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Hauptziel ist es, ein erweitertes Verständnis der menschlichen Motorik zu vermitteln, indem verschiedene Ansätze in der Koordinationsforschung kritisch hinterfragt werden. Dies soll zu einer optimierten Trainingsanwendung und letztendlich zu einer Leistungssteigerung führen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der Koordinationsforschung nachzuvollziehen und verschiedene Kategorisierungen des Konstrukts "Koordination" zu beleuchten sowie deren sportpraktische Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Welche Schlüsselkonzepte werden erläutert?
Schlüsselkonzepte umfassen die Definition von Koordination (Zusammenspiel von Zentralnervensystem und Muskulatur), den Unterschied zwischen motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Anwendung der Faktorenanalyse in der Koordinationsforschung, die Kritik an induktiven Forschungsmethoden und die Bedeutung einer ganzheitlichen Ausbildung der Koordination.
Welche Modelle der Koordinationsforschung werden im Detail beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert das Greifswalder Modell der Koordinationsforschung (induktive Feldstudie von Hirtz) und das Leipziger Modell von Meinel und Schnabel. Das Leipziger Modell vereinfacht die Vielzahl an Fähigkeitssystemen auf sieben essentielle koordinative Fähigkeiten (Differenzierungs-, Kopplungs-, Reaktions-, Orientierungs-, Gleichgewichts-, Umstellungs- und Rhythmusfähigkeit).
Welche Kritikpunkte werden an den verschiedenen Modellen geäußert?
Die Arbeit kritisiert insbesondere die Abhängigkeit der Ergebnisse der Greifswalder Studie von den gewählten Tests ("man bekommt nur das heraus, was man reingesteckt hat") und den Bedarf an großen Datenmengen für die Faktorenanalyse. Die Arbeit beleuchtet auch die Grenzen und den Kontext der verschiedenen Modelle, um ein umfassenderes Bild der Koordinationsforschung zu liefern.
Welche praktischen Anwendungen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die (sport-)praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Koordinationskategorisierungen für die Optimierung von Training und Leistungssteigerung. Der Fokus liegt auf der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den Sportunterricht und die Ausbildung von Sportlern.
Wer sollte diese Seminararbeit lesen?
Diese Seminararbeit ist für Studierende der Sportwissenschaft, Bewegungswissenschaft und verwandter Disziplinen von Interesse. Sie eignet sich auch für Sportlehrer und Trainer, die ihr Verständnis von Koordination und Training verbessern möchten.
- Citar trabajo
- Michael Burger (Autor), 2009, Wissenschaftliche Forschung zum sportlichen Koordinationsbegriff im Wandel der Zeit , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138615