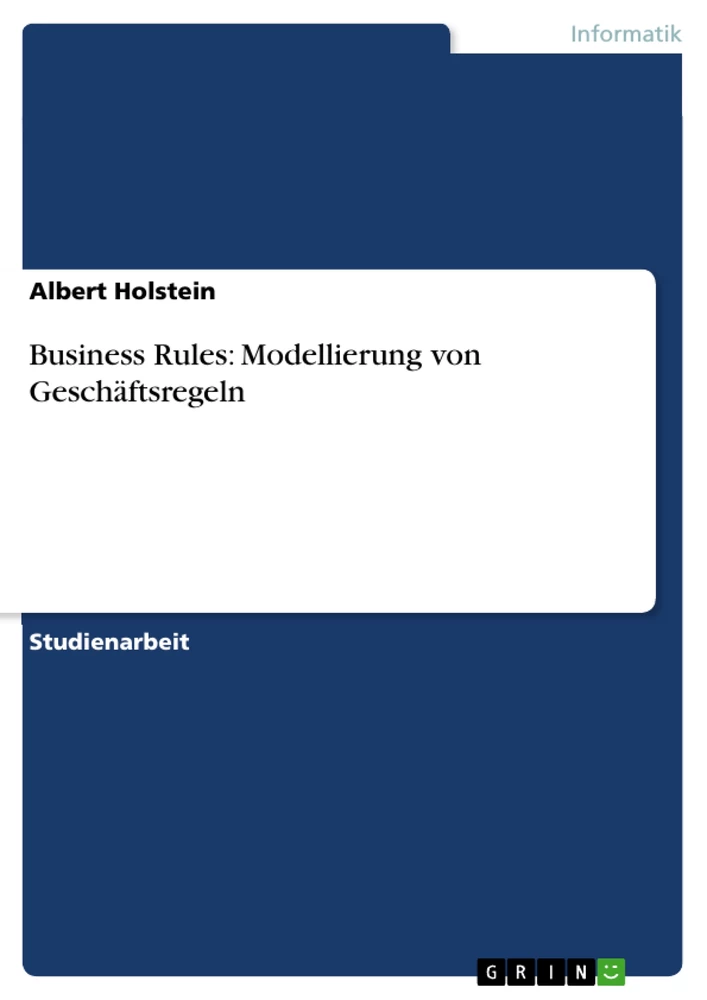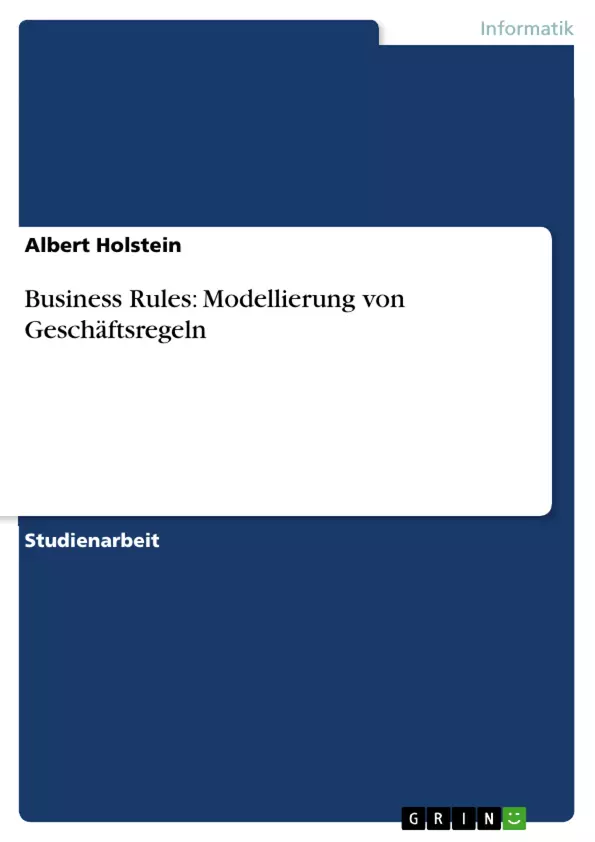1. Einleitung
Regeln sind einer der wichtigsten Bestandteile unseres Lebens. Sie ermöglichen ein Zusammenleben auf möglichst konfliktfreiem Niveau, legen fest was erlaubt und was verboten ist, man muss sie beachten und diesen folgen und vieles mehr. Die Regeln sind in allen Bereichen unseres Lebens zu finden, wie Verkehrsregeln beim Autofahren oder Spielregeln beim Fußball. Genau so haben auch verschiedene Unternehmen ihre Regeln, die bestimmte Sachverhalte festlegen. In diesem Zusammenhang wird von den Geschäftsregeln gesprochen, die in jeder Organisation existieren und für Aufgabenerfüllung verantwortlich sind, indem diese die zulässige Vorgehensweise festlegen oder diese zumindest eingrenzen.
Die Unternehmen sind einem ständigen Wettbewerb ausgestellt und werden damit konfrontiert, dass sie ihre laufenden Prozesse optimieren müssen, um immer wachsenden Ansprüchen auf dem Markt gerecht und somit auch konkurrenzfähig bleiben zu können. So werden auch die Geschäftsregeln, von denen oben die Rede war, optimiert, indem diese mit Hilfe von Computerprogrammen modelliert werden.
Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: zunächst wird im Kapitel 2. auf die Definition der Begriffe eingegangen und weiter im Kapitel 3. die Modellierung und Ihre Möglichkeiten dargestellt, wobei auf die Modellierung mit ECAA-Notationen und auch mittels EPK näher eingegangen wird. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einem Fazit (Kapitel 4.) in dem auch ein weiterführender Ausblick folgen wird.
2. Begriffliche Abgrenzung und Definition
In folgendem Kapitel werden zunächst die wichtigsten Begriffe definiert, die im Laufe der Arbeit verwendet werden. Damit werden mögliche Missverständnisse ausgeräumt, die mit zahlreinen verfügbaren Definitionen möglicherweise zusammenhängen können.
Zunächst werden die Geschäftsregeln definiert (Kapitel 2.1.) und ihre Klassifikation (Kap. 2.1.1.) und Komponenten (Kap. 2.1.1.) beschrieben, danach der Begriff Modellierung (Kapitel 2.2.) erklärt...
3. Modellierung von Geschäftsregeln
Aktives Geschäftsprozessmanagement ist in der heutigen Zeit unerlässlich. Für agile Prozesse spielen Geschäftsregeln zur Steuerung und Ausführung von Prozessabläufen eine zentrale Rolle. Durch die Integration der Modellierung und Verwaltung von Geschäftsregeln können Unternehmen ihre Effizienz steigern...
4. Fazit und Ausblick
In dieser Arbeit wurden Modellierung von Geschäftsregeln mit ECAA-Notationen, mit EPK und deren Zusammenhänge im Bereich der Modellierung...
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffliche Abgrenzung und Definition
2.1. Geschäftsregeln
2.1.1. Klassifikation von Geschäftsregeln
2.1.2. Komponenten der Geschäftsregeln
2.2. Modellierung
3. Modellierung von Geschäftsregeln
3.1. Modellierung allgemein. Theorie und Praxis
3.2. Geschäftsregelbasierte Modellierung mit ECAA-Notationen
3.2.1. Ereignis
3.2.2. Bedingung
3.2.3. Aktion
3.3. Modellierung von Geschäftsregeln mit EPK
3.3.1. Beschreibung und Struktur der EPK
3.3.2. Eigenschaften
3.4. Beispielmodellierungen von Geschäftsregeln
4. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 ECA-Regel
Abb. 2 Geschäftsregeln in ECAA-, ECA- und EA-Notation
Abb. 3 Konstruktelemente der EPK
Abb. 4 Unzulässige Verknüpfungsarten in einem EPK
Abb. 5 Beispiel für die Modellierung einer EA-Sequenz in EPK
Abb. 6 Beispiel zur Modellierung einer ECAA-Regel mittels EPK
Abb. 7 Beispiel zur Modellierung einer ECA-Regel mittels EPK
1. Einleitung
Regeln sind einer der wichtigsten Bestandteile unseres Lebens. Sie ermöglichen ein Zusammenleben auf möglichst konfliktfreiem Niveau, legen fest was erlaubt und was verboten ist, man muss sie beachten und diesen folgen und vieles mehr. Die Regeln sind in allen Bereichen unseres Lebens zu finden, wie Verkehrsregeln beim Autofahren oder Spielregeln beim Fußball. Genau so haben auch verschiedene Unternehmen ihre Regeln, die bestimmte Sachverhalte festlegen. In diesem Zusammenhang wird von den Geschäftsregeln gesprochen, die in jeder Organisation existieren und für Aufgabenerfüllung verantwortlich sind, indem diese die zulässige Vorgehensweise festlegen oder diese zumindest eingrenzen.
Die Unternehmen sind einem ständigen Wettbewerb ausgestellt und werden damit konfrontiert, dass sie ihre laufenden Prozesse optimieren müssen, um immer wachsenden Ansprüchen auf dem Markt gerecht und somit auch konkurrenzfähig bleiben zu können. So werden auch die Geschäftsregeln, von denen oben die Rede war, optimiert, indem diese mit Hilfe von Computerprogrammen modelliert werden.
Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: zunächst wird im Kapitel 2. auf die Definition der Begriffe eingegangen und weiter im Kapitel 3. die Modellierung und Ihre Möglichkeiten dargestellt, wobei auf die Modellierung mit ECAA-Notationen und auch mittels EPK näher eingegangen wird. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einem Fazit (Kapitel 4.) in dem auch ein weiterführender Ausblick folgen wird.
2. Begriffliche Abgrenzung und Definition
In folgendem Kapitel werden zunächst die wichtigsten Begriffe definiert, die im Laufe der Arbeit verwendet werden. Damit werden mögliche Missverständnisse ausgeräumt, die mit zahlreinen verfügbaren Definitionen möglicherweise zusammenhängen können.
Zunächst werden die Geschäftsregeln definiert (Kapitel 2.1.) und ihre Klassifikation (Kap. 2.1.1.) und Komponenten (Kap. 2.1.1.) beschrieben, danach der Begriff Modellierung (Kapitel 2.2.) erklärt.
2.1. Geschäftsregeln
Geschäftsregeln oder englisch Business-Rules sind in jeder Organisation existierende für die Aufgabenerfühlung Regeln, die zulässige Vorgehensweise entweder festlegen oder diese doch zumindest eingrenzen. Diese Regeln ergeben sich aus ethischen und kulturellen Normen, aus rechtlichen Vorgaben oder auch aus innerbetrieblichern Festlegungen. Diese Geschäftsregeln sind teilweise in Organisationshandbüchern festgehalten (explizite Regeln). Implizit geltende Regeln sind Bestandteil der Know-hows der Mitarbeiter. Bei der Entwicklung der computergestützten Informationssysteme muss ein Teil dieser Regeln in den Anwendungsprogrammen bzw. in den Datenbanksystemen abgelegt werden. Das Ablegen von Regeln in Datenbanksystemen wird insbesondere durch aktive Datenbanksysteme unterstützt. Im Grundsatz lässt sich jede Geschäftsregel durch die drei Basiselemente (dazu mehr in Kapitel 2.1.2.) Ereignis, Bedingung und Aktion beschreiben [StEG97].
Ein einfaches Beispiel aus dem Bereich Telekommunikation:
'''WENN''' das Telefonat länger als 30 Minuten gedauert hat
''UND'' das Telefonat zwischen 18:00 Uhr und 24:00 Uhr geführt wurde
''UND'' der Tarif des Besitzers ''Student 30+'' heißt
'''DANN''' wende 10% Rabatt auf das geführte Telefonat an.
Für die Definition vieler ähnlicher Regeln kann auch eine Entscheidungstabelle verwendet werden. Solche Regeln bilden die Grundlage für Regelbasierte Systeme und werden im weiteren Sinne dem Spezialgebiet der künstlichen Intelligenz zugerechnet.
2.1.1. Klassifikation von Geschäftsregeln
„Geschäftsregeln sind wesentlicher Bestandteil des Aufbaus von Organisationen bzw. der in ihnen stattfindenden Abläufe. Diese Regeln schreiben vor, wie die Geschäftsabwicklung zu erfolgen hat, das heißt sie beinhalten Richtlinien und Einschränkungen bezüglich der in Organisationen existierenden Zustände und Geschäftsprozesse“ [HeKn95]. Mit Hilfe von Regeln können die unter bestimmten Bedingungen auszuführenden Aktivitäten und die sie auslösenden Ereignisse in Beziehung gesetzt werden. In diesem Sinne können Geschäftsprozesse auf der Grundlage von Geschäftsregeln beschrieben und ausgeführt werden.
Dementsprechend können Geschäftsregeln in folgende Kategorien aufgeteilt werden:
Einschränkung: eine Aussage über ein Geschäft, das immer wahr sein muss. Zum Beispiel ein Kreditlimit eines Kunden bei Bestellungen zum keinen Zeitpunkt überschritten werden kann.
Ableitung: wenn aus der alten (bekannten) Informationen neue Informationen abgeleitet werden. Zum Beispiel bei einem Kunden wird aufgrund der früher gewonnenen Informationen entschieden, ob und in welcher Höhe ihm ein Rabatt zusteht.
Prozessregel: wenn eine bestimmte Aktion ausgeführt werden kann oder auch nicht, nachdem eine Situation aufgetreten ist. Zum Beispiel bestellte Ware darf nur dann ausgeliefert werden, wenn diese bezahlt wurde [SchM06].
2.1.2. Komponenten der Geschäftsregeln
Im Bereich aktiver Datenbanksysteme werden Regeln oft durch die drei Komponenten „event“, „condition“ und „action“ (Ereignis, Bedingung und Aktion) beschrieben, woraus sich die Bezeichnung als ECA-Regel ableitet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 ECA-Regel
Im Folgenden werden diese Komponenten kurz und knapp erläutert. Ausführlicher wird auf das Thema im Kapitel 3.2. eingegangen.
Ereignis
- Phänomen, das durch sein Auftreten eine relevante Situation beeinflusst
- Eintreten eines Ereignisses ist nicht zeitkonsumierend bezüglich des Prozesses
- Ereignisse können die Ausführung einer Geschäftsregel bewirken
Bedingung
- formuliert, welcher Zustand vorliegen muss, damit eine bestimmte Aktion ausgeführt wird.
- Prüfung der Bedingung erfordert eine Aktivität eines Akteurs - ist zeitkonsumierend - optionaler Bestandteil der Geschäftsregel, die als Spezialfall einer Aktion aufgefasst werden kann:
- Ressourcen werden nur abgefragt, aber nicht erzeugt, verändert oder gelöscht
- Ergebnis der Prüfung einer Bedingung ist immer ein Wahrheitswert
- nach einer Bedingung erfolgt innerhalb der Geschäftsregel immer eine XOR-Verzweigung zu einer Aktion
Aktion
- durch physische oder geistige Aktivitäten zu erzeugende Leistung
- Beendigung einer Aktion löst wiederum ein Ereignis aus.
2.2. Modellierung
Modelle werden hier als Abbilder eines Untersuchungsbereichs verstanden, die durch Abstraktion von Sachverhalten zustande kommen. In meist semi-formaler oder formaler Form werden mit ihnen die als relevant erachteten Komponenten dieses Bereichs sowie die Beziehungen, die zwischen diesen bestehen, beschrieben. Die Ergebnisse von Untersuchungen anhand eines Modells sollen in den relevanten Komponenten mit dem Ergebnis übereinstimmen, das eine Untersuchung des realen System ergeben würde [Troi90]. „Modelle, die aufgrund der Abstraktion mehreindeutig sind und die Struktur des realen Systems in der Abbildung erhalten, werden als homomorphe Abbilder bezeichnet“ [Riep92].
[...]
- Quote paper
- Albert Holstein (Author), 2006, Business Rules: Modellierung von Geschäftsregeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138603