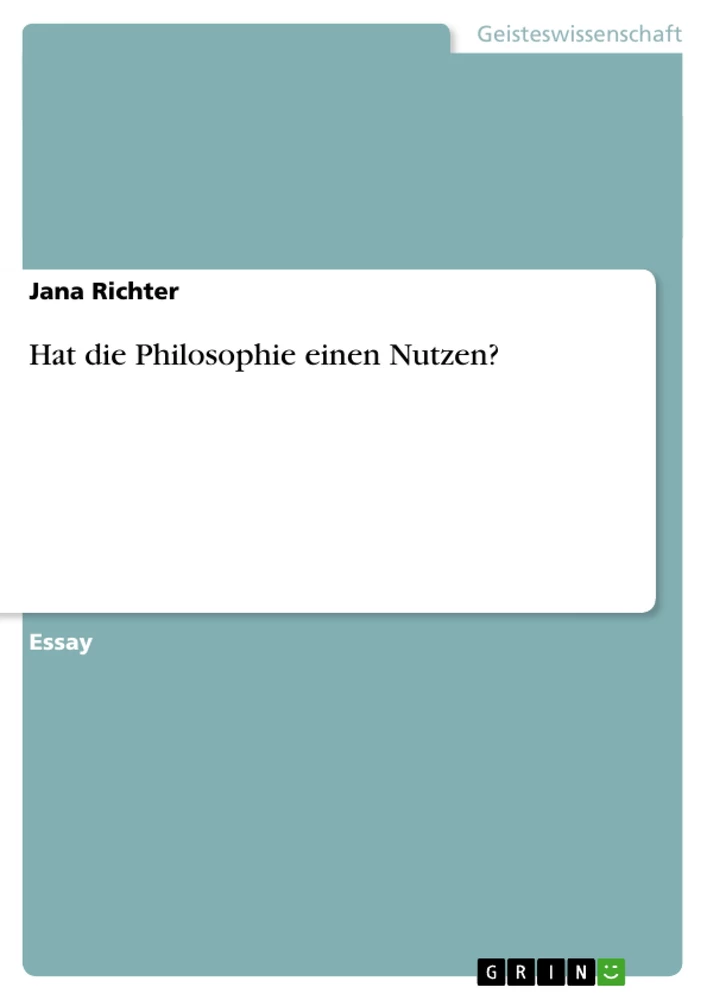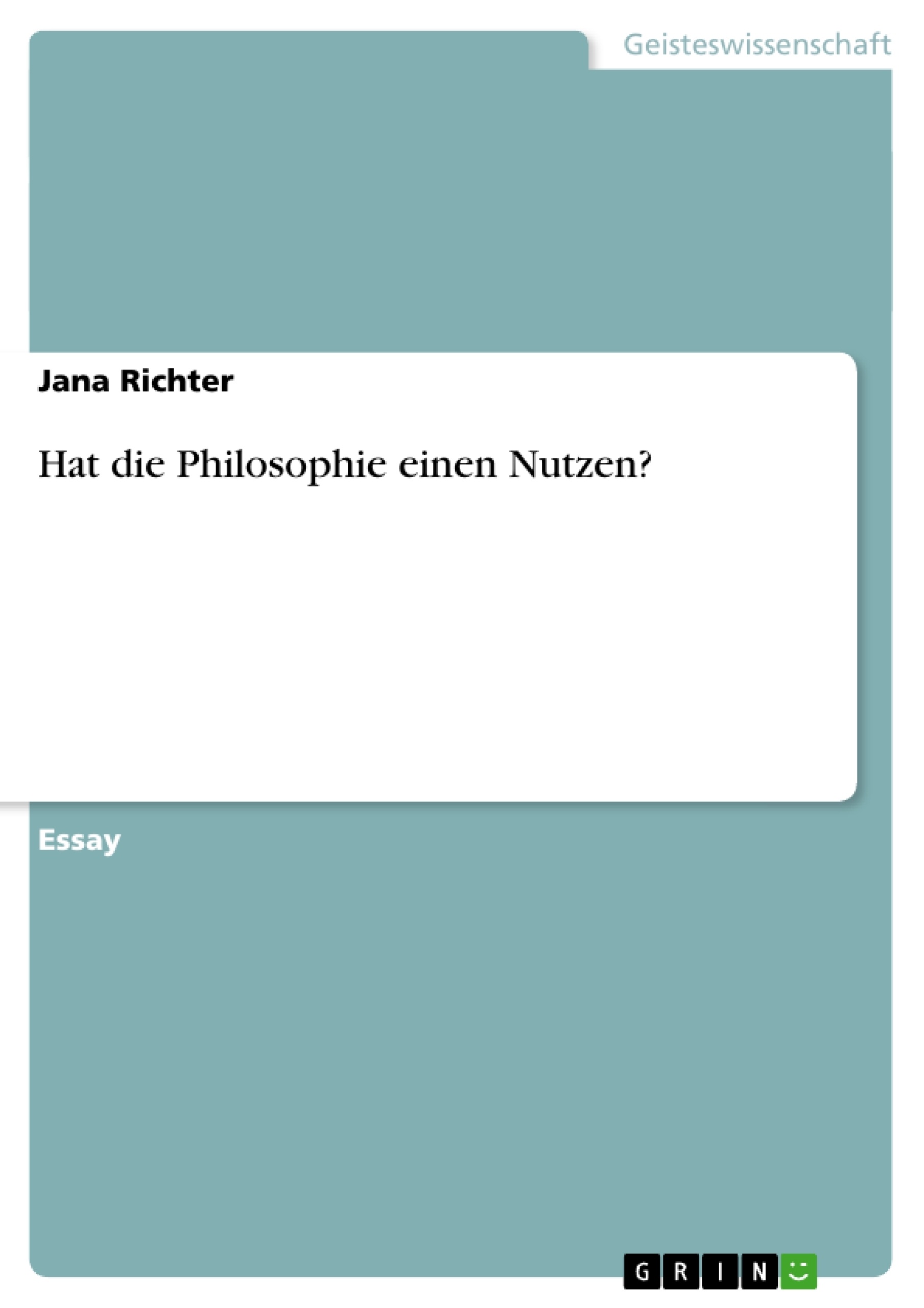Thales von Milet – einer der sieben Weisen der Antike und von Aristoteles zum Vater der Philosophie erklärt – beobachtete einst, so die Legende, derart hingerissen den Sternenhimmel, dass er nicht darauf achtete, wo seine Füße hintraten und unversehens in eine Grube fiel. Eine thrakische Magd soll sich darüber köstlich amüsiert haben.
Die Anekdote nährt das Klischee des zerstreuten Philosophen: weltfremd, mit scheinbar unerheblichen Fragen und Problemen beschäftigt, vergisst er die Welt im Hier und Jetzt.
Das Image des Nutzlosen, Weltfremden hat die Philosophie bis heute nicht losbekommen. Zu Recht? Oder hat die Philosophie doch einen Nutzen? Wenn ja, wie weit reicht dieser? Bezieht er sich lediglich auf das Individuum oder auch auf ganze Gesellschaften?
Diese Fragen sollen im vorliegenden Essay diskutiert werden. Grundlagentext hierfür ist Max Horkheimers Aufsatz Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie, anschließend wird auch auf weitere Sekundärliteratur eingegangen. Zum Schluss werde ich kurz meine eigene Meinung darlegen.
Thales von Milet – einer der sieben Weisen der Antike und von Aristoteles zum Vater der Philosophie erklärt – beobachtete einst, so die Legende, derart hingerissen den Sternenhimmel, dass er nicht darauf achtete, wo seine Füße hintraten und unversehens in eine Grube fiel. Eine thrakische Magd soll sich darüber köstlich amüsiert haben.
Die Anekdote nährt das Klischee des zerstreuten Philosophen: weltfremd, mit scheinbar unerheblichen Fragen und Problemen beschäftigt, vergisst er die Welt im Hier und Jetzt.
Das Image des Nutzlosen, Weltfremden hat die Philosophie bis heute nicht losbekommen. Zu Recht? Oder hat die Philosophie doch einen Nutzen? Wenn ja, wie weit reicht dieser? Bezieht er sich lediglich auf das Individuum oder auch auf ganze Gesellschaften?
Diese Fragen sollen im vorliegenden Essay diskutiert werden. Grundlagentext hierfür ist Max Horkheimers Aufsatz Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie, anschließend wird auch auf weitere Sekundärliteratur eingegangen. Zum Schluss werde ich kurz meine eigene Meinung darlegen.
Ein Grund, warum die Philosophie ein derartiges stiefmütterliches Dasein unter den Wissenschaften führt, ist, dass ihr – im Gegensatz zu den Naturwissenschaften - jeglicher Konkretität fehlt. Während sich für Wissenschaften wie Physik, Chemie, Medizin oder Geschichte ein genauer Untersuchungsgegenstand festmachen lässt, streiten die Philosophen untereinander bereits über eine Definition:
Viele Denker, denen Platon und Kant als Autoritäten gelten, betrachten die Philosophie als eine exakte Wissenschaft eigener Legitimität, mit eigenem Forschungsbereich und spezifischen Gegenstand. Andere Denker, wie Ernst Mach, begreifen Philosophie als die kritische Weiterentwicklung und Synthese der Spezialwissenschaften zu einem einheitlichen Ganzen.[1]
Andere Philosophen wie beispielsweise Friedrich Schiller bestritten den wissenschaftlichen Charakter der Philosophie. Er sah ihren Zweck darin, eine ästhetische Ordnung in Gedanken und Handlungen zu bringen.[2] Henri Bergson sieht die Philosophie eher eng verwandt mit der Kunst als mit der Wissenschaft.[3]
Auch über den Untersuchungsgegenstand herrscht Uneinigkeit: mal steht die letzte Erkenntnis Gottes, das so genannte Apriori, mal die inneren Erfahrungen oder universale Werte wie Wahrheit, Schönheit, Güte und Heiligkeit im Zentrum des Interesses.[4]
Diese Uneinheitlichkeit ist natürlich nicht förderlich, den Respekt und das Vertrauen der anderen Wissenschaften und von Otto Normalbürger zu gewinnen und Glaubwürdigkeit zu etablieren.
Aufgrund dessen haben, so Horkheimer, immer wieder Philosophen versucht. „die Philosophie als eine besondere Art von Wissenschaft zu ‚verkaufen’ oder doch wenigstens zu zeigen, daß sie für die Spezialwissenschaften sehr nützlich sei. In dieser Gestalt ist sie dann nicht mehr die Kritikerin, sondern die Dienerin der Wissenschaft und der Gesellschaft allgemein.“[5]
Für Horkheimer ist diese Position zu eng gedacht. Seiner Meinung nach liegt die eigentliche gesellschaftliche Funktion der Philosophie in der Kritik des Bestehenden: „Das Hauptziel einer derartigen Kritik ist es zu verhindern, daß die Menschen sich an jene Ideen und Verhaltensweisen verlieren, welche die Gesellschaft in ihrer jetzigen Organisation ihnen eingibt.“[6] Dabei entfalte sie ein kritisches und dialektisches Denken, mit dem sie beharrlich versuche, Vernunft in die Welt zu bringen.[7] Dass dies auch eine gefährliche Angelegenheit sein kann, weiß man spätestens seit Sokrates, der aufgrund seiner – so der Vorwurf – jugendgefährdenden Lehren zum Tode verurteilt wurde. „Sie [die Philosophie] ist unbequem, obstinat und zudem ohne unmittelbaren Nutzen, also wirklich eine Quelle des Ärgernisses. Es fehlt ihr an eindeutigen Kriterien und zwingenden Beweisen.“[8]
Hauptmerkmal der echten Philosophen ist die Fähigkeit zu kritisieren. Kritik bedeutet für Horkheimer aber nicht eine bloße Ablehnung, sondern
jene intellektuelle und schließlich praktische Anstrengung, die herrschenden Ideen, Handlungsweisen und gesellschaftlichen Verhältnisse nicht unreflektiert, rein gewohnheitsmäßig hinzunehmen; die Anstrengung, die einzelnen Seiten des gesellschaftlichen Lebens miteinander und mit den allgemeinen Ideen und Zielen der Epoche in Einklang zu bringen, sie genetisch abzuleiten, Erscheinung und Wesen voneinander zu trennen, die Grundlagen der Dinge zu untersuchen, sie also, kurz gesagt, wirklich zu erkennen.[9]
Horkheimer veröffentlichte sein Essay im Jahr 1940. Welche Auffassung von der Funktion, vom Nutzen der Philosophie haben heutige Autoren, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Vom Nutzen des Nutzlosen schreibt Ottfried Höffe in seinem 2005 erschienenen Aufsatz. Für ihn steht die Frage nach der Bedeutung der Philosophie im Zeitalter der Globalisierung und Ökonomisierung im Zentrum des Interesses.
Höffe stellt die These auf, „dass die Geisteswissenschaften, insbesondere die Philosophie, für demokratische Gemeinwesen unverzichtbar sind, darüber hinaus für eine globale Welt.“[10]
Nicht nur diese: Er sagt auch, dass das Zeitalter der globalen Finanz-, Waren- und Dienstleistungsmärkte mehr denn je der Philosophie bedarf.[11]
Die Philosophie rege zur Veränderung seiner Einstellung gegenüber der sozialen und kulturellen Welt und nicht zuletzt gegenüber sich selbst an; man wird gebildet[12]: „Es ist kein Vorrat konkreter Kenntnisse, der heute ohnehin rasch veraltet. Gemeint ist der Besitz allgemeiner Gesichtspunkte, mit denen man auch dort treffend mithält, wo man auf neuartige Sachverhalte stößt. Gebildet ist zum Beispiel … wer für die Wirtschaft und die Naturwissenschaften sowohl deren Wert als auch deren Grenzen einzuschätzen versteht.“[13]
Im Zeitalter der Globalisierung liefert die Philosophie auch in dem Sinne gute Dienste, als dass sie den kulturellen Reichtum der ganzen Menschheit vergegenwärtigt und so einem kulturellen Egozentrismus entgegenwirkt.[14] Die Philosophie und die Geisteswissenschaften „lehren sowohl (1) die anderen in ihrer Andersartigkeit als (2) sich und die anderen in ihrer Gemeinsamkeit, schließlich (3) durch den Kontrast sich selber besser zu verstehen.“[15] Damit wird auch automatisch Vorurteilen entgegengewirkt.
Wie Horkheimer, misst auch Höffe der Kritikfähigkeit, die durch das Studium der Philosophie erworben wird, große Bedeutung zu: „[Man] bildet .. sich eine eigene Meinung, und gegen die oft fragwürdigen Versprechen politischer Führung oder auch gegen eine augenmaßlose Kritik übt man eine kritische Urteilsfähigkeit ein.“[16] Diese ist, was unsere Zeit nach Höffe vornehmlich braucht, nämlich „ … die unparteiische Suche sowohl nach Für- als auch nach Gegenargumenten und die sich daran anschließende richterliche Abwägung, eben die judikative Kritik.“[17]
Die Philosophie lehre außerdem Geduld zu haben hinsichtlich des Entwicklungs- und Lernprozesses von Gesellschaften und Kulturen und steure so einer ungeduldigen Politik entgegen.[18] Die Kenntnisse der Entwicklung der eigenen Kultur und fremden Gesellschaften und das Wissen um „allgemeinmenschliche Antriebskräfte für Kooperation, aber auch für Konflikt“[19] helfen auch in der Weltpolitik.
[...]
[1] Horkheimer: Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie. S. 332
[2] vgl. ebd. S. 333
[3] vgl. ebd. S. 333
[4] vgl. ebd. S. 333f.
[5] Horkheimer: Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie, 1940, S. 341
[6] ebd. S. 344
[7] vgl. ebd. S. 347
[8] ebd. S. 347
[9] ebd. S. 350
[10] Höffe: Vom Nutzen des Nutzlosen. 2005, S. 668
[11] vgl. ebd. S. 669
[12] ebd. S. 670
[13] ebd. S. 670
[14] vgl. ebd. S. 671
[15] ebd. S. 673
[16] ebd. S. 671
[17] ebd. S. 672
[18] vgl. ebd. 672
[19] ebd. S. 674
- Quote paper
- Jana Richter (Author), 2009, Hat die Philosophie einen Nutzen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138503