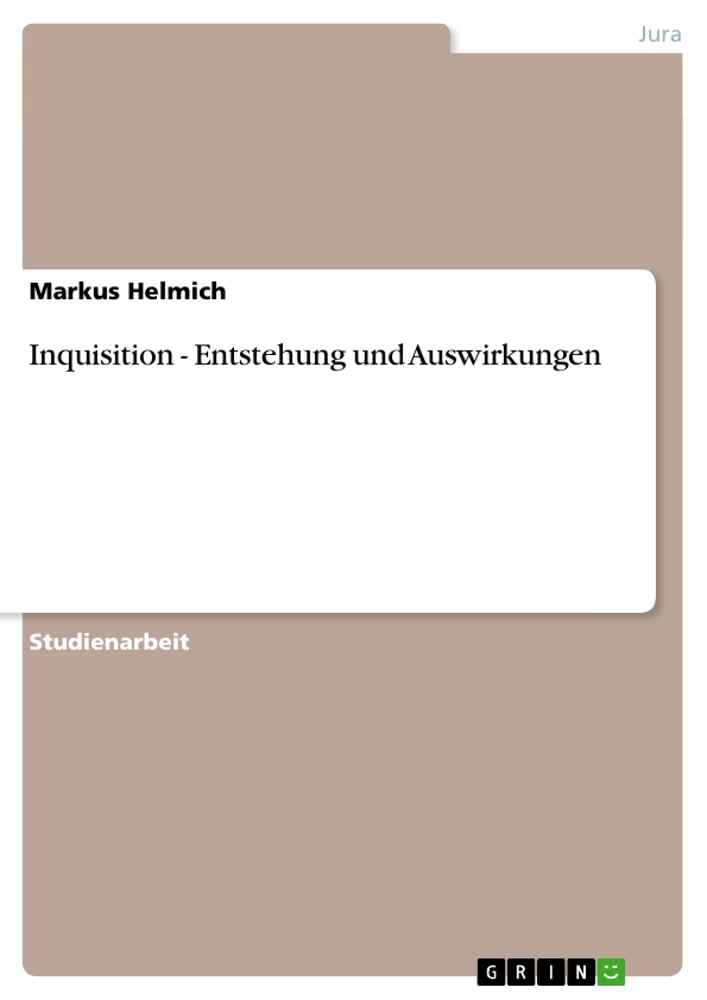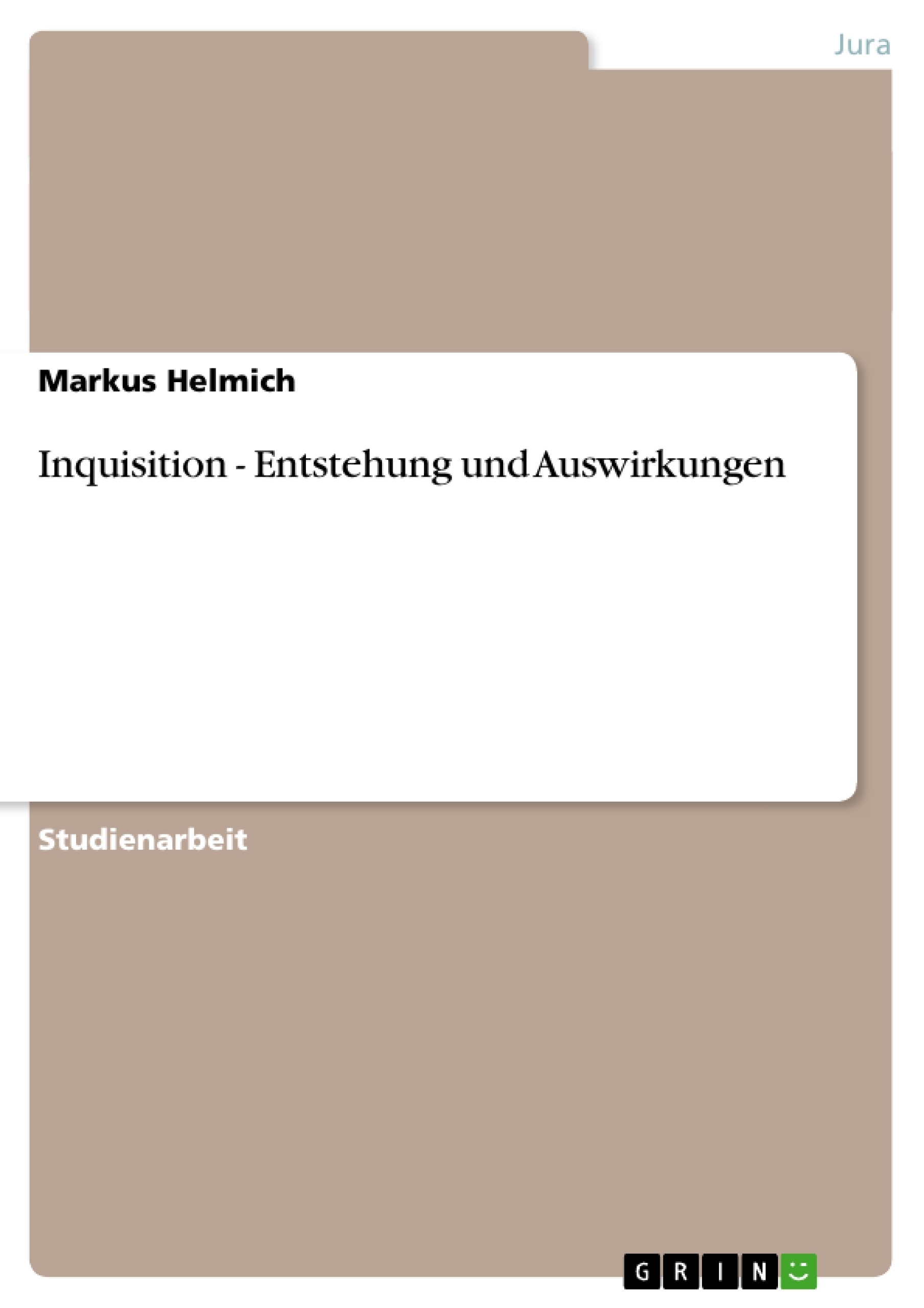In der strafrechtsgeschichtlichen Forschung besteht heute Einigkeit darüber, dass die
Anfänge des Inquisitionsprozesses in der katholischen Kirchenpolitik des Mittelalters
zu suchen sind. Diese neue und nachhaltige Autorität hatte sich in Europa rasch
durchgesetzt, die selbst über allen weltlichen Herrschern stand: die Autorität der
katholischen Kirche. Und so ,,verfügte diese neue Hierarchie bald über Machtmittel,
von denen die Urkirche nicht zu träumen wagte".
Dieser kirchliche Inquisitionsprozess, wie er vor allem in Ländern wie Frankreich,
Italien, Deutschland, Böhmen und Spanien praktiziert werden sollte, galt ursprünglich
pflichtvergessenen und übel beleumundeten Priestern, denen mit dem bislang
geltenden Akkusationsprozess nicht beizukommen war.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vormittelalterliche Entwicklungen
- 1. Einleitung
- 2. „Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter“
- 3. Vom Akkusations bis zum Infamationsprozeß
- II. Die Entstehung des Inquisitionsprozesses
- 1. Grundsätze des Inquisitionsprozesses
- III. Die Entstehung der Ketzerinquisition
- 1. Die Vorgehensweisen gegen Ketzer bis 1184
- 2. Die Inquisition als Mittel der Ketzerverfolgung
- 3. Begrenzung und Abschaffung der Folter
- IV. Die Auswirkungen der Inquisitionen
- 1. „Historische“ Opfer des Inquisitionsverfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Inquisitionsprozesses im mittelalterlichen Europa. Sie beleuchtet die Vorläufer des Verfahrens im vormittelalterlichen Recht und analysiert den Wandel vom Akkusationsprozess zum Inquisitionsprozess innerhalb des kirchlichen Strafrechts. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Inquisition bei der Verfolgung von Ketzern.
- Entwicklung des Inquisitionsprozesses vom Akkusations- zum Infamationsprozess
- Die Rolle der katholischen Kirche in der Etablierung des Inquisitionsprozesses
- Verfolgung von Ketzern und die Bedeutung des Edikt Ad abolendam
- Unterschiede zwischen Akkusations- und Inquisitionsprozess
- Auswirkungen der Inquisition auf die betroffenen Personen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vormittelalterliche Entwicklungen: Dieses Kapitel untersucht die Rechtspraktiken vor dem Aufkommen des Inquisitionsprozesses. Es beschreibt die Abwesenheit eines vergleichbaren Verfahrens im älteren deutsch-germanischen Recht, wo Selbstjustiz und Fehde vorherrschten. Die Lex Salica wird als Beispiel für ein frühes Verfahren vor dem Königsgericht angeführt, das jedoch auf private Klage angewiesen war und somit dem Akkusationsprozess entspricht. Das Kapitel beleuchtet auch zaghafte Versuche einer amtlichen Verbrechensverfolgung durch „Rügegeschworene“, die sich jedoch nicht durchsetzten. Das Prinzip „Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter“ wird als prägendes Element des alten Rechts hervorgehoben. Der Übergang vom Akkusations- zum Infamationsprozess innerhalb des kirchlichen Strafrechts wird als Vorläufer des Inquisitionsprozesses eingeführt.
II. Die Entstehung des Inquisitionsprozesses: Dieses Kapitel beschreibt die Grundsätze des Inquisitionsprozesses, die sich im Gegensatz zum Akkusationsprozess durch die Untersuchung von Amts wegen auszeichneten. Im Gegensatz zum Akkusationsprozess, der eine formelle Anklage benötigte, ermöglicht der Inquisitionsprozess es, selbstständig die Wahrheit zu ermitteln, ohne dass eine formale Anklage erforderlich ist. Die Bedeutung dieser Entwicklung für das kirchliche Strafrecht wird dargelegt und der Übergang zur inquisitio veritatis, also der Untersuchung der Wahrheit von Amts wegen, erläutert. Der Reinigungseid behält eine subsidiäre Rolle.
III. Die Entstehung der Ketzerinquisition: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der Inquisition im Kontext der Ketzerverfolgung. Es beschreibt die Vorgehensweisen gegen Ketzer vor 1184 und die zunehmende Bedeutung der Inquisition als Instrument der Kirchenpolitik zur Bekämpfung von Häresie. Das Edikt Ad abolendam von 1184, das eine geregelte Vorgehensweise gegen Ketzer festlegte, wird detailliert erläutert, ebenso wie die Rolle der „mala fama“ als Ersatz für die Anklage. Der Gebrauch von Gottesurteilen und Reinigungseiden wird im Zusammenhang mit der Ketzerverfolgung analysiert. Die Entwicklung von der inquisitio famae zur inquisitio veritatis wird im Kontext der Ketzerverfolgung näher beleuchtet, wobei der zunehmende Fokus auf der Ermittlung der Wahrheit herausgestellt wird.
IV. Die Auswirkungen der Inquisitionen: Dieser Abschnitt beleuchtet die Auswirkungen der Inquisition auf die betroffenen Personen, die als „historische Opfer“ des Verfahrens bezeichnet werden. Es wird hier auf die konkreten Folgen des Inquisitionsprozesses und die damit verbundenen Leiden für die Angeklagten eingegangen, ohne jedoch konkrete Details oder Einzelheiten zu nennen, um Spoiler zu vermeiden. Das Kapitel fokussiert auf den generellen, geschichtlichen Kontext des Leids.
Schlüsselwörter
Inquisition, Akkusationsprozess, Infamationsprozess, Ketzerverfolgung, Häresie, kanonisches Recht, mittelalterliches Strafrecht, kirchliche Gerichtsbarkeit, Edikt Ad abolendam, mala fama, Reinigungseid, Gottesurteil, inquisitio veritatis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entstehung und Entwicklung des Inquisitionsprozesses
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Inquisitionsprozesses im mittelalterlichen Europa. Sie beleuchtet die Vorläufer im vormittelalterlichen Recht und analysiert den Wandel vom Akkusations- zum Inquisitionsprozess innerhalb des kirchlichen Strafrechts. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Inquisition bei der Verfolgung von Ketzern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Inquisitionsprozesses vom Akkusations- zum Infamationsprozess, die Rolle der katholischen Kirche bei dessen Etablierung, die Verfolgung von Ketzern und die Bedeutung des Edikts Ad abolendam, die Unterschiede zwischen Akkusations- und Inquisitionsprozess sowie die Auswirkungen der Inquisition auf die betroffenen Personen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel I behandelt vormittelalterliche Entwicklungen, Kapitel II die Entstehung des Inquisitionsprozesses, Kapitel III die Entstehung der Ketzerinquisition und Kapitel IV die Auswirkungen der Inquisitionen.
Was wird in Kapitel I ("Vormittelalterliche Entwicklungen") behandelt?
Kapitel I untersucht Rechtspraktiken vor dem Inquisitionsprozess, die Abwesenheit eines vergleichbaren Verfahrens im älteren deutsch-germanischen Recht (Selbstjustiz, Fehde), die Lex Salica als Beispiel für ein frühes Verfahren vor dem Königsgericht (Akkusationsprozess), versuchte amtliche Verbrechensverfolgung durch „Rügegeschworene“ und den Übergang vom Akkusations- zum Infamationsprozess im kirchlichen Strafrecht als Vorläufer des Inquisitionsprozesses.
Was sind die zentralen Aspekte von Kapitel II ("Die Entstehung des Inquisitionsprozesses")?
Kapitel II beschreibt die Grundsätze des Inquisitionsprozesses (Untersuchung von Amts wegen im Gegensatz zum Akkusationsprozess), die Bedeutung dieser Entwicklung für das kirchliche Strafrecht und den Übergang zur inquisitio veritatis (Untersuchung der Wahrheit von Amts wegen). Die subsidiäre Rolle des Reinigungseids wird ebenfalls erläutert.
Worauf konzentriert sich Kapitel III ("Die Entstehung der Ketzerinquisition")?
Kapitel III konzentriert sich auf die Entwicklung der Inquisition im Kontext der Ketzerverfolgung. Es beschreibt Vorgehensweisen gegen Ketzer vor 1184, die zunehmende Bedeutung der Inquisition als Instrument der Kirchenpolitik, das Edikt Ad abolendam (1184), die Rolle der „mala fama“, den Gebrauch von Gottesurteilen und Reinigungseiden im Zusammenhang mit der Ketzerverfolgung und die Entwicklung von der inquisitio famae zur inquisitio veritatis.
Was wird in Kapitel IV ("Die Auswirkungen der Inquisitionen") behandelt?
Kapitel IV beleuchtet die Auswirkungen der Inquisition auf die betroffenen Personen ("historische Opfer"). Es wird auf die Folgen des Inquisitionsprozesses und die Leiden der Angeklagten eingegangen, ohne jedoch konkrete Details oder Einzelheiten zu nennen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inquisition, Akkusationsprozess, Infamationsprozess, Ketzerverfolgung, Häresie, kanonisches Recht, mittelalterliches Strafrecht, kirchliche Gerichtsbarkeit, Edikt Ad abolendam, mala fama, Reinigungseid, Gottesurteil, inquisitio veritatis.
- Quote paper
- Markus Helmich (Author), 2008, Inquisition - Entstehung und Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138443