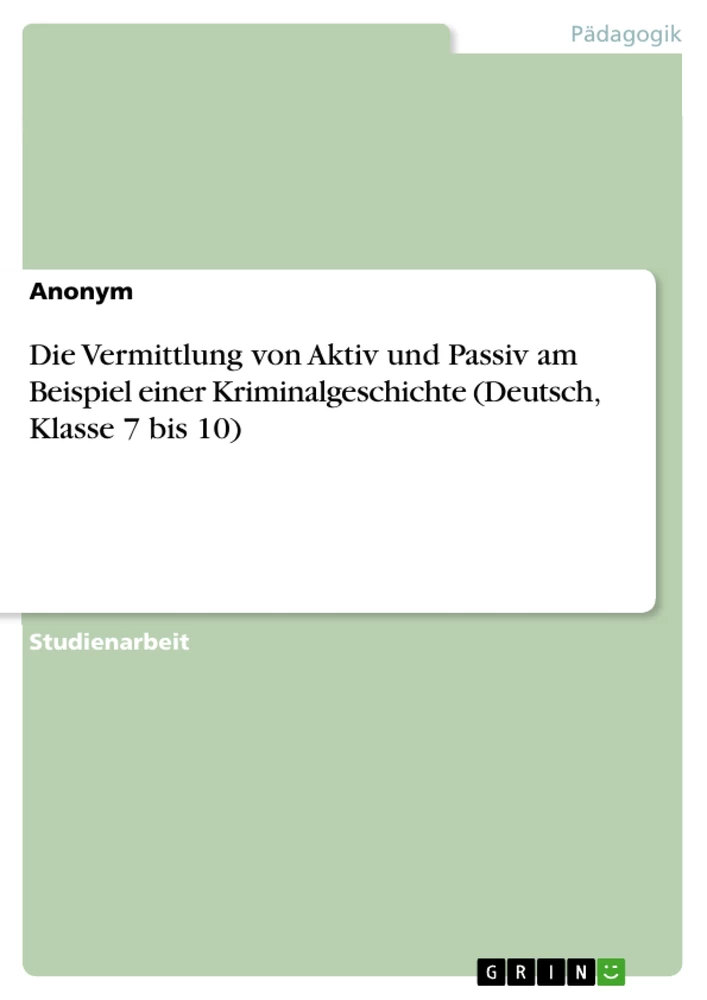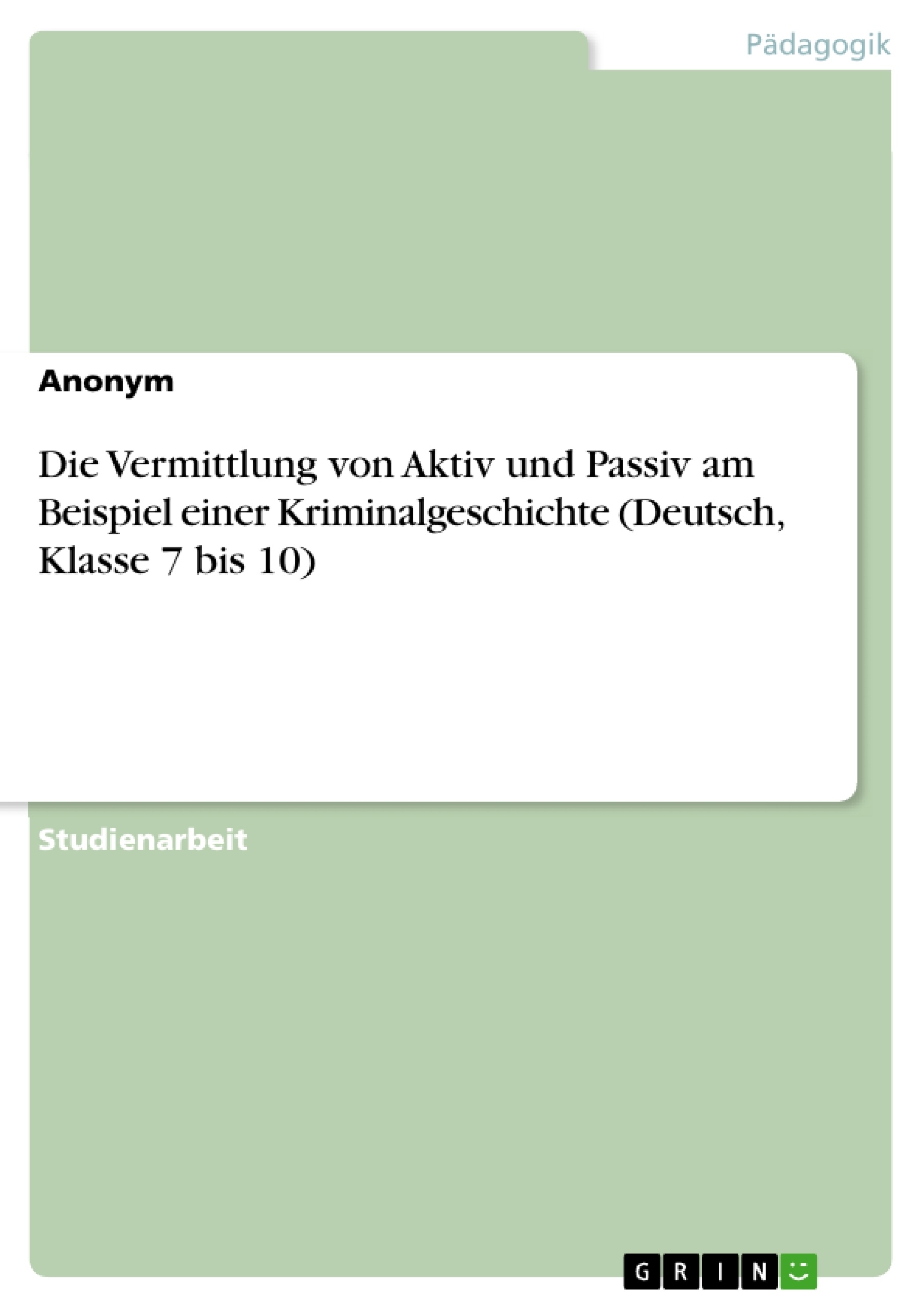In dieser Ausarbeitung wird konzeptualisiert, inwieweit die Auseinandersetzung mit einer fiktiven Kriminalgeschichte im Unterricht zur Vermittlung von Aktiv und Passiv beitragen kann. Um dies präziser erläutern zu können, wird zunächst ein fachwissenschaftlicher Bezug des Unterrichtsthemas hergestellt, der in eine fachdidaktische Konzeptualisierung mündet.
Angelegt ist dieses Unterrichtskonzept für die Klassenstufen sieben bis zehn. Das Unterrichtskonzept zum Mini-Krimi wurde im Jahr 2017 von der Autorin Wortliebe auf dem Online-Lehrermarktplatz hochgeladen, welche eine Plattform für Unterrichtsmaterialien ist, wo sich zahlreiche Lehrer:innen ihre unterrichtserprobten Materialien mit ihren Kolleg:innen teilen. Das Dokument besteht aus zehn PDF-Seiten und beinhaltet neben Regeln, Übungen, einem Spicker, einer Hausaufgabe und einem Kompetenz-Check-Raster auch Lösungsblätter für die Lehrkräfte. In der Produktbeschreibung wird angepriesen, dass anhand des motivierenden Materials die Schüler:innen nicht nur die Täterin/den Täter der Kriminalgeschichte ermitteln, sondern zusätzlich alles Relevante rund um das Aktiv und Passiv erkunden.
Wesentlich ist das Verständnis des Aktivs und Passivs und die Vermittlung dieser im Unterricht. Grammatikstunden sind für Schüler:innen selten mitreißend, weshalb die Vermittlung Schwierigkeiten aufweisen könnte. Deshalb empfiehlt es sich, Grammatik in der Praxis nicht isoliert zu unterrichten, sondern diese in eine passende Situierung einzubetten, welche den Schüler:innen als Anker dienen kann. Auf diese Weise kann der Unterricht motivierender und gleichzeitig lehrreicher als das ledigliche Einführen von Regeln und dem anschließenden Wiederholen mit Übungen ohne jeglichen Kontext werden. Auch Lehrbücher zur Grammatik beinhalten selten anschauliche Übungen, welche den Schüler:innen das Lernen der Regeln erleichtern. Deshalb setzen Lehrkräfte zunehmend mehr auf das entdeckende Lernen, bei dem Schüler:innen „auf der Basis angebotener, nicht vorstrukturierter Beispiele, Phänomene, Situationen oder Probleme Wissen in Form von Konzepten oder Zusammenhängen selbst erarbeiten“ müssen. Laut Leuders hat diese aktive Konstruktion Vorteile wie die tiefere Verarbeitung, das nachhaltige Einprägen, die Förderung von Lernstrategien, das selbstregulierte Lernen und die intrinsische Motivation. Mit dem folgenden Unterrichtskonzept werden ebenfalls diese Ziele verfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fachwissenschaftlicher Bezug des Unterrichtsthemas
- 2.1 Vorgangs- und Zustandspassiv: Formenbildung
- 2.2 Vorgangspassiv: Syntaktische Einstufung
- 2.3 Der Gebrauch und die Bedeutung des Vorgangs- und Zustandspassivs
- 2.4 Passiv und Aktiv im Vergleich
- 3. Fachdidaktische Konzeptualisierung
- 3.1 Traditioneller deduktiver Grammatikunterricht vs. integrativer induktiver Grammatikunterricht
- 3.2 Angestrebte Kompetenzbereiche des Unterrichtskonzepts
- 3.3 Didaktischer Rahmen nach Klafki
- 3.4 Didaktische Reduktion
- 3.5 Handlungsorientierung: Geeignete Kommunikationsformen
- 3.6 Methodische Schlussfolgerungen für den Unterricht
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung setzt sich zum Ziel, die Vermittlung von Aktiv und Passiv anhand einer Kriminalgeschichte im Unterricht zu konzeptualisieren. Der fachwissenschaftliche Bezug wird untersucht, um anschließend eine fachdidaktische Konzeptualisierung zu entwickeln.
- Grammatikalische Grundlagen von Aktiv und Passiv
- Entwicklung eines Unterrichtskonzepts für die Klassenstufen sieben bis zehn
- Einsatz einer fiktiven Kriminalgeschichte als motivierendes Lernmaterial
- Integration von Aktiv und Passiv in praxisnahen Übungen
- Handlungsorientiertes Lernen und Stärkung der Sprachkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Thema der Ausarbeitung vor und erläutert die Zielsetzung. Dabei wird die Verwendung einer fiktiven Kriminalgeschichte zur Vermittlung von Aktiv und Passiv im Unterricht dargelegt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet den fachwissenschaftlichen Bezug des Unterrichtsthemas und untersucht die verschiedenen Formen und Funktionen des Aktiv und Passiv. Dazu werden die Bildung des Vorgangs- und Zustandspassivs, die syntaktische Einstufung des Vorgangspassivs sowie die Bedeutung und der Gebrauch beider Formen im Vergleich behandelt.
- Kapitel 3: Der Schwerpunkt liegt auf der fachdidaktischen Konzeptualisierung. Hier werden verschiedene Ansätze zum Grammatikunterricht, die angestrebten Kompetenzbereiche des Unterrichtskonzepts, der didaktische Rahmen nach Klafki sowie die didaktische Reduktion und die Handlungsorientierung des Unterrichts erörtert. Schließlich werden methodische Schlussfolgerungen für die praktische Umsetzung im Unterricht gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den grammatikalischen Grundlagen von Aktiv und Passiv, einem Unterrichtskonzept zur Vermittlung dieser Formen in der Sekundarstufe, dem Einsatz einer Kriminalgeschichte als motivierendes Lernmaterial sowie mit didaktischen und methodischen Aspekten des Grammatikunterrichts. Die Arbeit zielt darauf ab, den Schüler:innen ein besseres Verständnis von Aktiv und Passiv zu vermitteln und gleichzeitig den Unterricht motivierender und handlungsorientierter zu gestalten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die Vermittlung von Aktiv und Passiv am Beispiel einer Kriminalgeschichte (Deutsch, Klasse 7 bis 10), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1383287