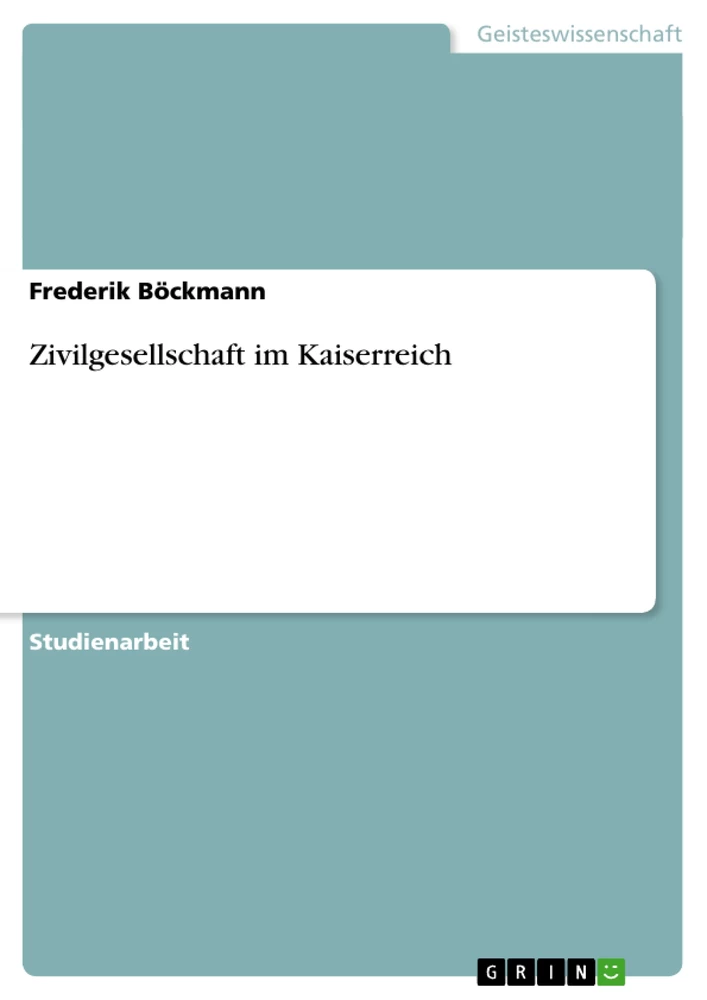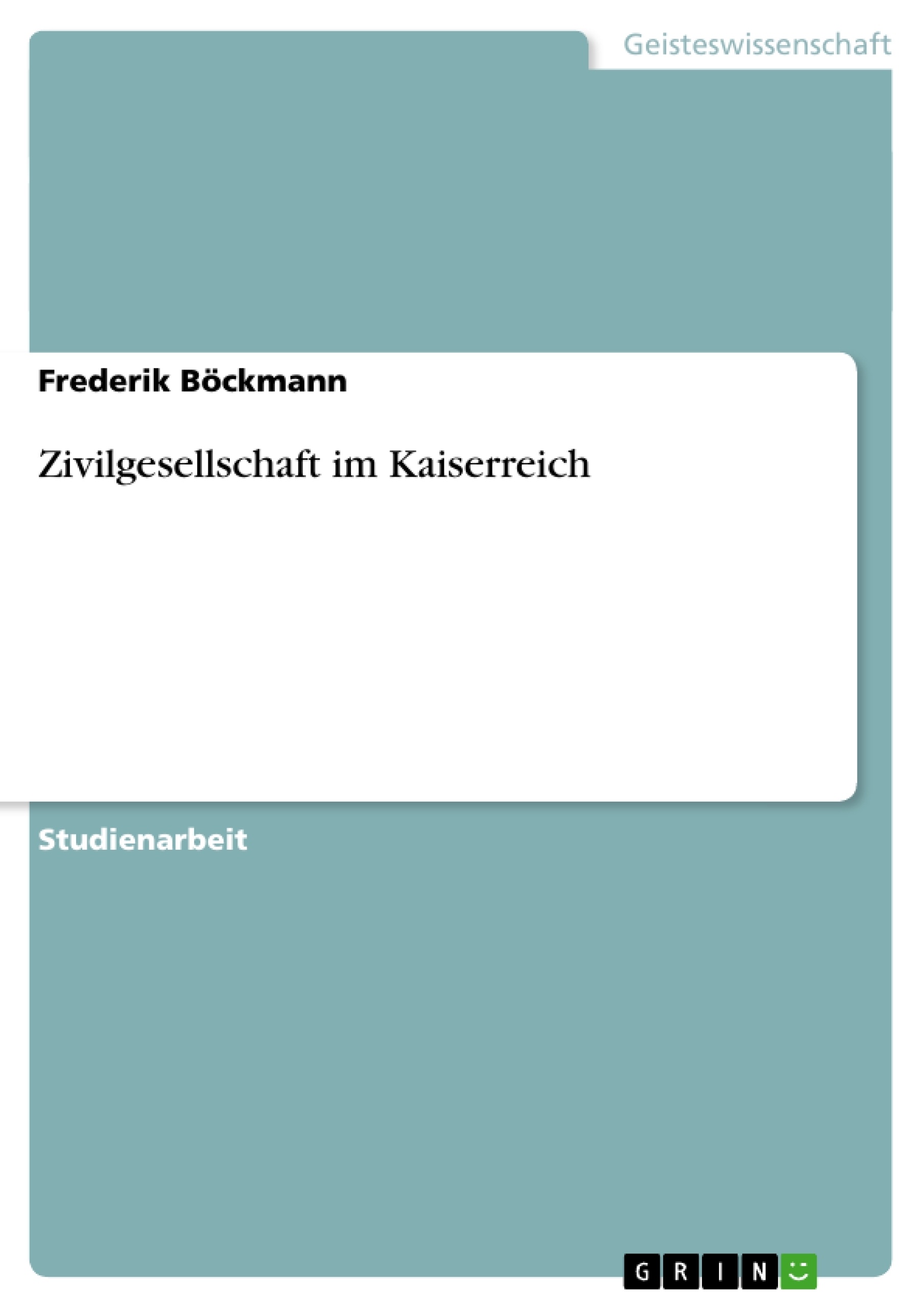Die Zivilgesellschaft gewinnt in Deutschland zunehmend an Stärke und gesellschaftlicher Relevanz, für Jürgen Kocka (2001: 4) verbreitet sie sich sogar wie eine „Epidemie“. Dies ist ein Erfolg der stärkeren öffentlichen Wahrnehmung, denn bürgerschaftliches Engagement nimmt in Deutschland immer stärker zu. Der Begriff der Zivilgesellschaft ist den Debatten häufig schon zu einer „Zauberformel“ geworden, mit der nahezu alle Steuerungs- und Integrationsprobleme nicht nur des Staates, sondern obendrein auch noch des Marktes gelöst werden sollen.
Diese Arbeit soll sich aber nicht mit den aktuellen Debatten um Zivilgesellschaft beschäftigen, sondern mit der Zivilgesellschaft in historischer Perspektive befassen. Genauer gesagt mit Zivilgesellschaft im deutschen Kaiserreich. Einer Zeit, in der sich Deutschland rasant vom Agrarstaat zum Industriestaat wandelte, und wo Vereine und Verbände wie Pilze aus dem Boden sprießen. Je komplexer die deutsche Gesellschaft wurde, desto bunter wurde auch das Vereins- und Verbandsleben. Es gab in der Zeit des Kaiserreiches, so resümierte Volker Berghahn (2003), „am Ende keine menschliche Tätigkeit, der man nicht in einer Organisation zusammen mit Gleichgesinnten nachgehen konnten.“
In dieser Arbeit soll daher die Frage geklärt werden, warum ausgerechnet in einem nicht-demokratischen Regime wie dem deutschen Kaiserreich eine der organisationsmächtigsten Zivilgesellschaften in Europa entstand. Zum besseren Verständnis wird zunächst auf die Definition der Zivilgesellschaft, ihrer Begriffsgeschichte und ihrer Entwicklung in der Zeit bis zum Kaiserreich eingegangen. Dann folgt zudem ein Blick auf die Gesellschaftsstruktur des Kaiserreiches geworfen, um für die bessere Einordnung für diese Zeit zu sorgen. Danach wird sich im Hauptteil der Arbeit mit der Vereinslandschaft, den Verbänden und der Kirche beschäftigt – die drei tragenden Säulen der Zivilgesellschaft zur Zeit des Kaiserreiches. Im Fazit werde ich dann die zuvor erarbeiteten Ergebnisse zusammenfassen und abschließend bewerten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Allgemeiner Überblick
2.1. Definition Zivilgesellschaft
2.2. Begriffsgeschichte der Zivilgesellschaft
2.3. Entwicklung der Zivilgesellschaft bis zum Kaiserreich
3. Gesellschaftsstruktur
3.1. Allgemeiner Überblick
3.2. Militär
4. Vereine
4.1. Allgemeiner Überblick
4.2. Sport
4.3. Kriegervereine
5. Verbände
5.1. Allgemeiner Überblick
5.2. Gewerkschaften
6. Kirche
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Die Zivilgesellschaft gewinnt in Deutschland zunehmend an Stärke und gesellschaftlicher Relevanz, für Jürgen Kocka (2001: 4) verbreitet sie sich sogar wie eine „Epidemie“. Dies ist ein Erfolg der stärkeren öffentlichen Wahrnehmung, denn bürgerschaftliches Engagement nimmt in Deutschland immer stärker zu. Der Begriff der Zivilgesellschaft ist den Debatten häufig schon zu einer „Zauberformel“ geworden, mit der nahezu alle Steuerungs- und Integrationsprobleme nicht nur des Staates, sondern obendrein auch noch des Marktes gelöst werden sollen.
Diese Arbeit soll sich aber nicht mit den aktuellen Debatten um Zivilgesellschaft beschäftigen, sondern mit der Zivilgesellschaft in historischer Perspektive befassen. Genauer gesagt mit Zivilgesellschaft im deutschen Kaiserreich. Einer Zeit, in der sich Deutschland rasant vom Agrarstaat zum Industriestaat wandelte, und wo Vereine und Verbände wie Pilze aus dem Boden sprießen. Je komplexer die deutsche Gesellschaft wurde, desto bunter wurde auch das Vereins- und Verbandsleben. Es gab in der Zeit des Kaiserreiches, so resümierte Volker Berghahn (2003), „am Ende keine menschliche Tätigkeit, der man nicht in einer Organisation zusammen mit Gleichgesinnten nachgehen konnten.“
In dieser Arbeit soll daher die Frage geklärt werden, warum ausgerechnet in einem nicht-demokratischen Regime wie dem deutschen Kaiserreich eine der organisationsmächtigsten Zivilgesellschaften in Europa entstand. Zum besseren Verständnis wird zunächst auf die Definition der Zivilgesellschaft, ihrer Begriffsgeschichte und ihrer Entwicklung in der Zeit bis zum Kaiserreich eingegangen. Dann folgt zudem ein Blick auf die Gesellschaftsstruktur des Kaiserreiches geworfen, um für die bessere Einordnung für diese Zeit zu sorgen. Danach wird sich im Hauptteil der Arbeit mit der Vereinslandschaft, den Verbänden und der Kirche beschäftigt – die drei tragenden Säulen der Zivilgesellschaft zur Zeit des Kaiserreiches. Im Fazit werde ich dann die zuvor erarbeiteten Ergebnisse zusammenfassen und abschließend bewerten.
2. Allgemeiner Überblick
2.1. Definition Zivilgesellschaft
Was genau ist Zivilgesellschaft? Ursprünglich mit den anti-absolutistischen Lehren des 18. Jahrhunderts entstanden und von den osteuropäischen Dissidenten als Gegenutopie zu den sozialistischen Systemen wieder aufgenommen, ist der Begriff der „civil society“ in der Wissenschaft zu einem Schlagwort für höchst unterschiedliche politische und gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen avanciert. Gemeinsam ist diesen Vorstellungen, dass sie die aktive Partizipation und das freiwillige, gemeinnützige Engagement der Bürgerinnen und Bürger zum Leitbild einer guten Ordnung erheben. In der wissenschaftlichen und politischen Diskussion wird der Begriff Zivilgesellschaft darüber hinaus zur Bezeichnung jener Organisationen, Institutionen und Formen gemeinnützigen Handelns benutzt, die außerhalb vom Markt und des staatlichen Bereiches anzutreffen sind. Auch wenn Definition und Abgrenzung der Begriffe „Zivilgesellschaft“ mitunter variieren, besteht doch weitgehende Einigkeit über seine Merkmale und Kennzeichen. So sind mit dem Begriff Assoziationen wie Verbände, Vereine und Bürgerstiftungen zwischen Gesellschaft und Staat angesprochen, in denen und durch die eine politische Meinungs-, Willens- und Entscheidungsfindung stattfindet und in der Öffentlichkeit ausgetragen wird (vgl. Adloff 2005).
Jürgen Kocka (2001: 1) beschreibt Zivilgesellschaft als „weitgehend selbst-regulierten Raum bürgerschaftlichen Engagements zwischen Staat, Ökonomie und Privatsphäre, andererseits ein immer noch nicht voll eingelöstes Zukunftsprojekt menschlichen Zusammenlebens in der Tradition der Aufklärung.“ Dazu gehörten gesellschaftliche Selbstorganisation, Gemeinwohlorientierung, die Begrenzung staatlicher Herrschaft durch Verfassung, Recht und Partizipation wie auch kulturelle Vielfalt, politische Öffentlichkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit.
Bei der Zivilgesellschaft geht es vor allem um die Interaktion von Bürgern. Das Maecenata Instititut für Philanthropie und Zivilgesellschaft (2005: 2) versteht darunter, wie international üblich, „die Summe der Organisationen und informellen Initiativen, die ohne Gewinnstreben im öffentlichen Raum wirken.“ Bürgerinitiativen und Menschenrechtsgruppen zählen ebenso dazu wie international agierende Nichtregierungsorganisationen, Wohlfahrts- und Sportverbände, Naturschutz- oder Jugendorganisationen ebenso wie Kultur- und Brauchtumsvereine, Stiftungen ebenso Selbsthilfegruppen. Denn diese sind auf Freiwilligkeit gegründet und umfassen das Angebot, der Gesellschaft Ideen, Zeit und materielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ob politische Parteien auch zu gehören ist strittig; daher wird in der folgenden Hausarbeit auf die Nennung der Parteien als zivilgesellschaftliche Akteure im Kaiserreich verzichtet.
Im Kontext verschiedener Diskurse haben Begriff und Idee der Zivilgesellschaft in jüngerer Zeit bedeutend an Aufmerksamkeit und Zuspruch gewonnen. So wird zivilgesellschaftlichen Organisationen im Rahmen von Globalisierung und eingeschränkter nationalstaatlicher Handlungsfähigkeit bei gleichzeitigem Machtzuwachs transnationaler Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle zugesprochen. Oder es wird im Kontext der Debatte um den Umbau des Sozialstaates mit verschiedenen Stoßrichtungen die Hoffnung auf zivilgesellschaftliche Akteure gesetzt (vgl. Reimer: 2006).
Die Zivilgesellschaft ist auf Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte angewiesen; also auf einen staatlichen Schutz der Meinungs-, Presse- und Vereinigungsfreiheit. In der Regel zählen außerdem bestimmte zivile Verhaltensstandards wie Toleranz, Verständigung, Gewaltfreiheit, aber auch Gemeinsinn zur Zivilgesellschaft (vgl. Adloff 2005).
2.2. Begriffsgeschichte der Zivilgesellschaft
Die Entwicklung der Zivilgesellschaft lässt sich als ein Prozess erklären, in dem Individuen und gesellschaftliche Gruppen die Möglichkeiten der Freiheit zwischen staatlicher und privater Sphäre entwickelten. Gegen die absolutistische Macht des Königs sprach Locke von Zivilgesellschaft als Schutz des Einzelnen durch ein lebendiges Parlament. Später meinte Montesquieu, dass es zwischen dem Einzelnen und dem Parlament große vermittelnde Organisationen geben müsse, die ebenfalls zur Zivilgesellschaft gehörten. Tocquevilles Ansicht nach wird die Zivilgesellschaft vor allem durch eine Vielzahl von Verbänden, Vereinen und Assoziationen getragen. Habermann betonte schließlich, dass eine Zivilgesellschaft ummittelbar auf eine öffentliche und herrschaftsfreie Kommunikation angewiesen sei. Die Gemeinsamkeit aller besteht trotz unterschiedlicher Interessen darin, die Rechte und die Freiheit der Individuen gegenüber dem Staat auszudehnen.
Die historische Entwicklung von Zivilgesellschaften hat viel mit Begründung, Reichweite, Folgen und vor allem dem Wandel der Regeln und Praktiken zu tun. Der Kontrast zwischen dem Universalitätsanspruch der zivilgesellschaftlichen Utopie und der Realität sozialer Exklusivität legitimiert Mitwirkungsforderungen ausgeschlossener Gruppen und ermöglicht letztlich die Ausdehnung von Partizipationschancen (wie etwa bei den Erfolgen der Arbeiter- und Frauenbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts). Zudem entwickelte sich das Staatsangehörigkeit- und Staatsbürgerschaftsrecht in modernen Nationalstaaten zu einem wichtigen Instrument der Zuteilung von Teilhaberechten das nach innen Partizipationschancen vergrößerte, im selben Maße aber nach außen verstärkte.
Im Mittelalter und der gesamten Frühneuzeit hindurch fand mit dem Begriff der „civil society“ eine Abgrenzung von der Sphäre des Hauses und der Familie statt; vielmehr stand der Begriff für das Gemeinwesen als noch nicht in sich ausdifferenzierten gesellschaftspolitischen Raum. In der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts fand dann schrittweise die moderne Umprägung des Begriffes statt. Mit der „civil society“ respektive Zivilgesellschaft meinte man den Prozess fortschreitender Zivilisierung – sei es durch Arbeit und Fleiß, Handel und Eigentum, auf der anderen Seite die Zivilisierung durch Bildung und Kultur oder schließlich als Emanzipation, Befreiung aus den Begrenzungen der Geburt, des Standes und des Geschlechts. Dazu wurde mit Zivilgesellschaft im 18. Jahrhundert auch die Stoßrichtung gegen den Obrigkeitsstaat[1] betont (vor allem in den absolutistisch regierten Ländern). Im 19. Jahrhundert veränderte sich der Begriff weiter hin zur Ausdifferenzierung zwischen Staat und Gesellschaft. Die Zivilgesellschaft oder auch bürgerliche Gesellschaft entwickelte sich zu einem eigenen Konzept, das als Reich der Arbeit und der Bedürfnisse, des Verkehrs und der Kommunikation oder auch der Konflikte – jeweils in scharfer Abgrenzung zum Staat (vgl. Adloff 2005; Reimer 2006: 30-32; Kocka 2001).
2.3. Entwicklung der Zivilgesellschaft bis zum Kaiserreich
In der Zeit vor dem Kaiserreich entstand in Deutschland eine vielfältige Zivilgesellschaft, in dem etwa politisch engagierte Turner, Sänger und Wissenschaftler nationale Netzwerke, Vereine, Clubs und Organisationen aufbauten und die Förderung von „Zivilität“ zu ihrem Programm machten: etwa als Aufklärungs- und Lesegesellschaften, als Bürgervereine oder liberale politische Clubs. Diese bürgerliche Gesellschaft sprengte einerseits ständische Grenzen der Zugehörigkeit – zum Beispiel zwischen Adel und Bürgertum, zwischen Staatsdienern und handelsbürgerlichen Unternehmen – beschränkte sich aber noch im frühen 19. Jahrhundert auf eine relativ schmale, adlig-bürgerliche Elite und blieb zudem den Männern vorbehalten.
Langsam an zu boomen fing die Vereinslandschaft vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts. Angehörige des gehobenen Bürgertums, Verwaltungsbeamte, Professoren, aber auch Adelige schlossen sich zu „Vereinen“ zusammen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten neue Vereinsformen mit einer veränderten Mitgliederstruktur auf wie Burschenschaften, Gesangs- und Turnverein. Verbindungsnamen wie Teutonia (Heidelberg 1814) oder Germania (Gießen 1815) belegen den Bezug auf die Nation. Die Verbreitung von Vereinen unterschied sich nicht wesentlich von europäischen Ländern oder den Vereinigten Staaten. Allerdings blieb bis 1848 der rechtliche Charakter von Vereinen teilweise ungeklärt, und es wurden auf Grundlage des Einzelfalls öffentlich-rechtliche Konzessionen oder Genehmigungen erteilt.
Besonders seit den 1830er Jahren erweiterte sich dann aber die soziale Basis der Zivilgesellschaft ganz erheblich „nach unten“, in mittel- und kleinbürgerliche Schichten, und erreichte teilweise auch die ländliche Bevölkerung. Bedingt dadurch, dass Deutschland keine Demokratie darstellte, waren alle Bereiche des städtischen Lebens vereinsmäßig organisiert. Und wegen der rückständigen Struktur von Wahlrecht und politischer Klasse trug die blühende Vereinslandlandschaft viel zur Entwicklung einer politischen Öffentlichkeit, der Erfindung und Erprobung demokratischer Verfahren und der Selektion und Schulung politischer Akteure bei. Selbst unter den Bedingungen begrenzter Parlamentisierung und politischer Diskriminierung spielte die Versammlungsdemokratie in den Vereinen eine bedeutende Rolle bei der Ausbildung einer demokratischen Arbeiterbewegungskultur in Deutschland (vgl. Adloff 2005: 100-108).
3. Gesellschaftsstruktur
3.1. Allgemeiner Überblick
Am 18. Januar 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich nach dem Sieg des Norddeutschen Bundes und der mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten gegründet. Damit war auf kleindeutscher Grundlage und unter der Herrschaft der preußischen Hohenzollern erstmals ein deutscher Nationalstaat entstanden – in Form einer konstitutionellen Monarchie mit dem Kaiser als Oberhaupt. Demokratische Strukturen gab es aber eher nur zum Schein. Denn der Einfluss des Parlaments auf die Ausarbeitung von Gesetzen war eher eingeschränkt. Das Kaiserreich war, wenn auch in Grenzen, schon ein Parteienstaat. Denn die Parteien mobilisierten die Wähler, vermittelten zwischen den „Stammtischen“ und den politischen Institutionen und wirkten über die Parlamente am politischen Entscheidungsprozess mit. Durch den Aufstieg von Massenverbänden (siehe 5.) und -Parteien sowie der wachsenden Bedeutung der Presse gewann zudem die öffentliche Meinung an Gewicht. Deutschland, das 1870 in ökonomischer Sicht noch sehr rückständig war, entwickelte sich innerhalb der 40 Jahre bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dem daraus resultierenden Endes Kaiserreichs zu einer großen Weltmacht. Dazu wuchs die Bevölkerung von 41 auf 67 Millionen Einwohner (Ullmann 1995; Ullrich 2006).
[...]
[1] Als Obrigkeitsstaat wird ein Staat ein dann charakterisiert, wenn die öffentlichen Angelegenheiten nahezu ausschließlich durch einen Herrscher sowie ein ihm zugeordnete aristokratische, militärische oder bürokratische Führungsgruppe geregelt werden – so wie im konstitutionell-monarchischen deutschen Kaiserreich.
- Quote paper
- Frederik Böckmann (Author), 2009, Zivilgesellschaft im Kaiserreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138323