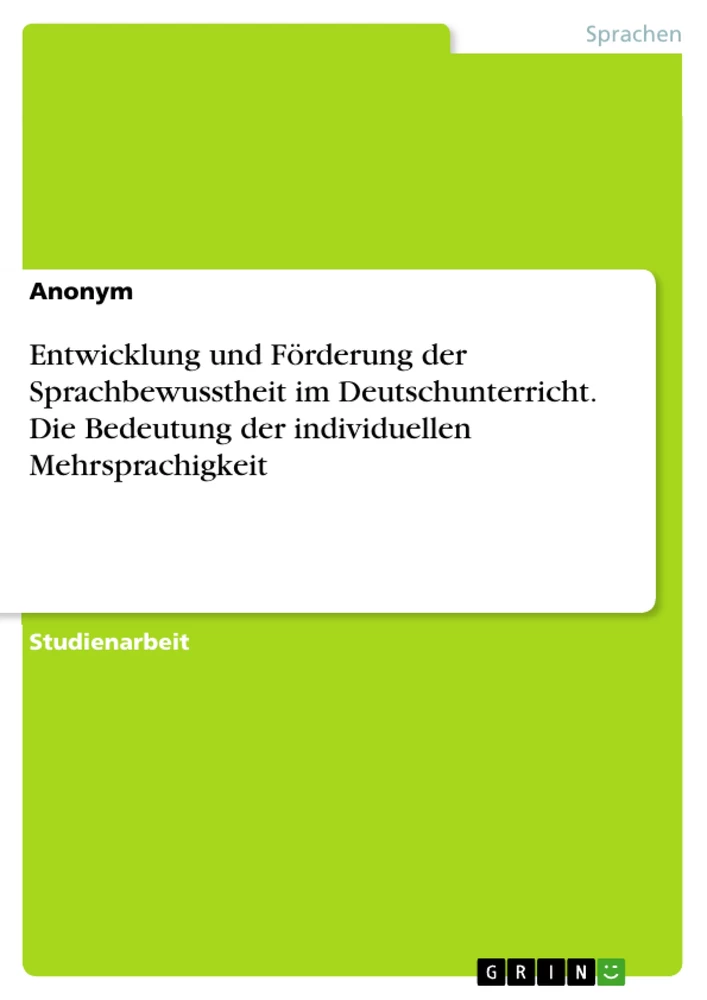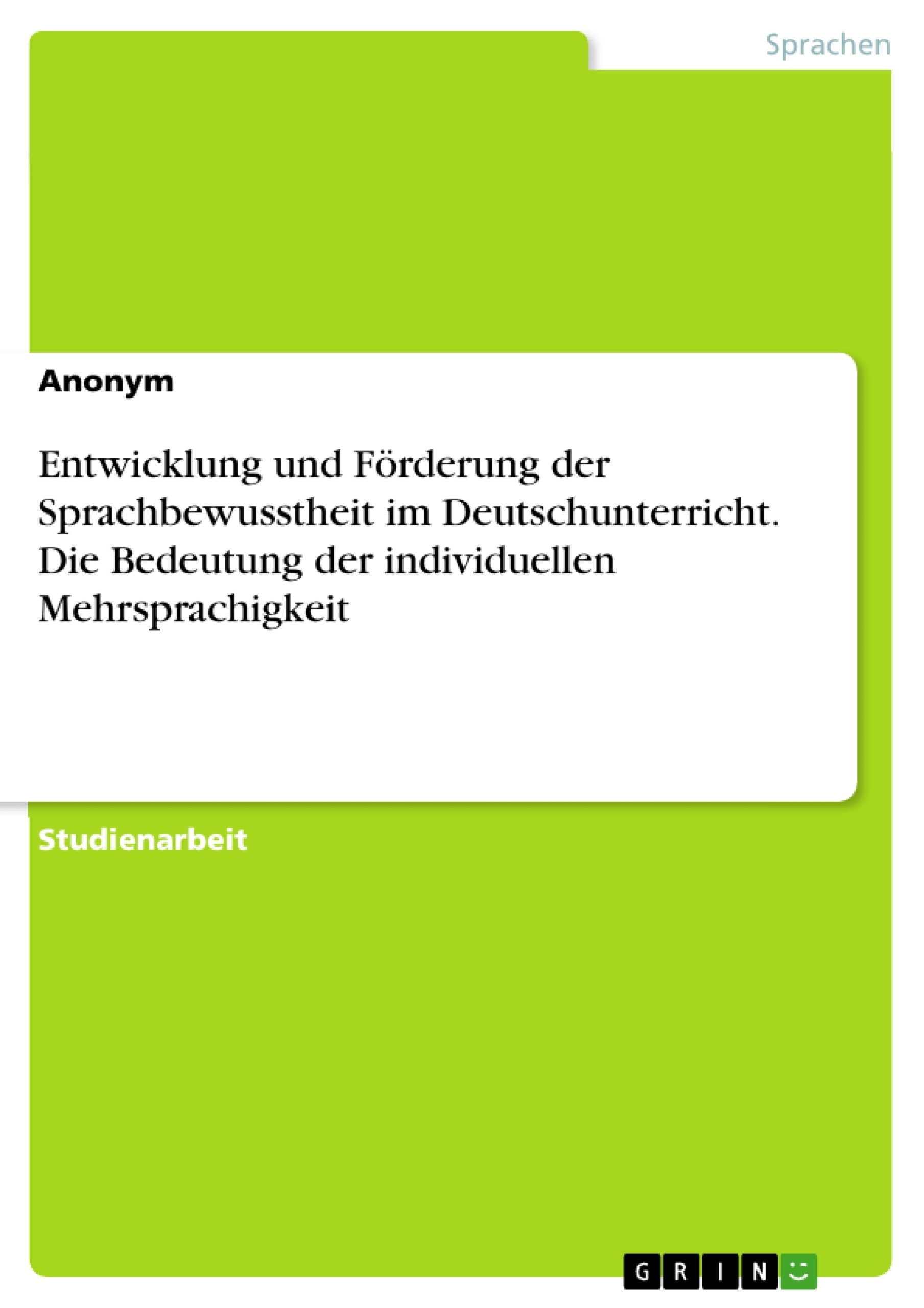Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Mehrsprachigkeit für die Entwicklung der Sprachbewusstheit im Deutschunterricht. Angesichts der wachsenden mobilen Gesellschaft und Migration ist Mehrsprachigkeit in Schule und Alltag präsent.
Es wird untersucht, wie die individuelle Mehrsprachigkeit im Unterricht genutzt werden kann, um die Sprachbewusstheit zu fördern. Sie betrachtet den Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und metasprachlichen Fähigkeiten sowie die Rolle der Sprachbewusstheit im Zweit- und Drittspracherwerb. Die Methode des Sprachvergleichs wird als Möglichkeit zur Förderung der Sprachbewusstheit vorgestellt.
Die Arbeit betont die Bedeutung eines Deutschunterrichts, der die individuelle Mehrsprachigkeit der Lernenden berücksichtigt und gezielt zur Förderung der Sprachbewusstheit einsetzt.
Eingangs wird überblicksmäßig skizziert, worum es sich beim Begriff Sprachbewusstheit handelt. Dabei werden verschiedene terminologische Auffassungen der Begriffe Language Awareness, Sprachbewusstheit und Sprachbewusstsein gegenübergestellt. Anschließend wird auf den Erwerb metasprachlicher Fähigkeiten eingegangen und verschiedene Modelle dazu erläutert.
Des Weiteren wird der Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Sprachbewusstheit aufgezeigt und auf die explizite Sprachthematisierung zur Förderung der Sprachbewusstheit eingegangen. Im Folgenden wird ein Überblick über die Rolle der Sprachbewusstheit beim Zweit- und Drittspracherwerb gegeben. Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Vorstellung der Methode des Sprachvergleichs, mit der sowohl die individuelle Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht berücksichtigt als auch die Sprachbewusstheit gefördert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Language-Awareness-Ansatz
- Sprachbewusstheit
- Das Modell nach Schöler
- Zwei-Komponenten-Modell nach Bialystoks
- Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit
- Explizite Thematisierung von Sprache zur Förderung der Sprachbewusstheit
- Die Rolle der Sprachbewusstheit beim Zweit- und Drittspracherwerb
- Interlingualer Transfer
- Sprachvergleich als Unterrichtselement
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, wie die individuelle Mehrsprachigkeit von Lernenden im Deutschunterricht zur Entwicklung und Förderung der Sprachbewusstheit genutzt werden kann, wobei der Fokus auf migrationsbedingter Mehrsprachigkeit liegt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Auswirkung einer gut ausgeprägten Sprachbewusstheit auf das weitere Sprachlernen.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Sprachbewusstheit, Sprachbewusstsein und Language Awareness.
- Analyse verschiedener Modelle zum Erwerb metasprachlicher Fähigkeiten.
- Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Sprachbewusstheit.
- Methoden zur expliziten Thematisierung von Sprache im Unterricht zur Förderung der Sprachbewusstheit.
- Rolle der Sprachbewusstheit beim Zweit- und Drittspracherwerb.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Relevanz der Forschungsfrage: Inwiefern kann die individuelle Mehrsprachigkeit der Lernenden im Deutschunterricht für die Entwicklung und Förderung der Sprachbewusstheit genutzt werden? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt den Fokus auf migrationsbedingte Mehrsprachigkeit sowie den Einfluss von Sprachbewusstheit auf den weiteren Spracherwerb.
Begriffsklärung: Dieses Kapitel beleuchtet die Begriffe Language Awareness, Sprachbewusstheit und Sprachbewusstsein und ihre jeweiligen terminologischen Auffassungen. Es wird der Language-Awareness-Ansatz aus Großbritannien detailliert erläutert, inklusive der fünf Domänen nach James und Garrett (kognitive, performative, affektive, soziale und Machtdomäne). Die Unterschiede und Überschneidungen zwischen den Begriffen werden herausgearbeitet, und die Fokussierung der deutschen Forschung auf die kognitive Domäne wird im Vergleich zur britischen Forschung diskutiert.
Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel (angenommen, es existiert im Originaltext) würde den Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und der Entwicklung von Sprachbewusstheit untersuchen. Es würde wahrscheinlich empirische Befunde und theoretische Ansätze präsentieren, die belegen, wie der Kontakt mit verschiedenen Sprachen die Fähigkeit zur sprachlichen Reflexion und zum Metawissen über Sprache beeinflusst. Die Kapitel würde wahrscheinlich die Vorteile der Mehrsprachigkeit für den Sprachunterricht aufzeigen.
Explizite Thematisierung von Sprache zur Förderung der Sprachbewusstheit: Dieses Kapitel (angenommen, es existiert im Originaltext) würde sich mit konkreten didaktischen Ansätzen befassen, die die Sprachbewusstheit im Unterricht fördern. Es könnte Methoden und Strategien beschreiben, die explizit die sprachliche Reflexion der Schüler anregen und ihr Bewusstsein für sprachliche Strukturen und Prozesse schärfen. Beispiele könnten gezielte Übungen zur Grammatik, zum Wortschatz und zur Textanalyse sein.
Die Rolle der Sprachbewusstheit beim Zweit- und Drittspracherwerb: Dieses Kapitel würde die Bedeutung der Sprachbewusstheit für den Erwerb weiterer Sprachen untersuchen. Es würde wahrscheinlich den Einfluss von Sprachbewusstheit auf Prozesse wie den interlingualen Transfer beleuchten und darstellen, wie ein höheres Maß an Sprachbewusstheit den Spracherwerb erleichtern kann. Die Diskussion könnte sich auf die Anwendung der im vorherigen Kapitel vorgestellten Methoden im Kontext des Zweit- und Drittspracherwerbs konzentrieren.
Sprachvergleich als Unterrichtselement: Dieses Kapitel (angenommen, es existiert im Originaltext) würde eine konkrete Methode zur Förderung von Sprachbewusstheit vorstellen: den Sprachvergleich. Es würde wahrscheinlich detailliert erläutern, wie der Vergleich verschiedener Sprachen im Unterricht die sprachliche Reflexion und das Verständnis für sprachliche Strukturen fördern kann. Dies könnte Beispiele für konkrete Unterrichtsaktivitäten umfassen.
Schlüsselwörter
Sprachbewusstheit, Sprachbewusstsein, Language Awareness, Mehrsprachigkeit, metasprachliche Fähigkeiten, Sprachvergleich, Zweitspracherwerb, Drittspracherwerb, Deutschunterricht, Interlingualer Transfer, Sprachdidaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht, wie die individuelle Mehrsprachigkeit von Lernenden im Deutschunterricht zur Entwicklung und Förderung der Sprachbewusstheit genutzt werden kann, mit einem Schwerpunkt auf migrationsbedingter Mehrsprachigkeit und dem Einfluss auf den weiteren Spracherwerb.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit klärt die Begriffe „Sprachbewusstheit“, „Sprachbewusstsein“ und „Language Awareness“ und analysiert deren unterschiedliche Auffassungen. Besonders wird der „Language-Awareness-Ansatz“ aus Großbritannien mit seinen fünf Domänen (kognitiv, performativ, affektiv, sozial und Macht) erläutert.
Welche Modelle zum Erwerb metasprachlicher Fähigkeiten werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle zum Erwerb metasprachlicher Fähigkeiten, unter anderem das Modell nach Schöler und das Zwei-Komponenten-Modell nach Bialystok.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Sprachbewusstheit dargestellt?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und der Entwicklung von Sprachbewusstheit. Sie präsentiert wahrscheinlich empirische Befunde und theoretische Ansätze, die belegen, wie der Kontakt mit verschiedenen Sprachen die Fähigkeit zur sprachlichen Reflexion und zum Metawissen über Sprache beeinflusst.
Welche Methoden zur Förderung der Sprachbewusstheit im Unterricht werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt Methoden und Strategien zur expliziten Thematisierung von Sprache im Unterricht, um die Sprachbewusstheit zu fördern. Dies beinhaltet wahrscheinlich konkrete didaktische Ansätze und Übungen zur Grammatik, zum Wortschatz und zur Textanalyse. Der Sprachvergleich wird als eine konkrete Methode hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Sprachbewusstheit beim Zweit- und Drittspracherwerb?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Sprachbewusstheit auf den Zweit- und Drittspracherwerb, insbesondere auf den interlingualen Transfer. Sie zeigt auf, wie ein höheres Maß an Sprachbewusstheit den Spracherwerb erleichtern kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachbewusstheit, Sprachbewusstsein, Language Awareness, Mehrsprachigkeit, metasprachliche Fähigkeiten, Sprachvergleich, Zweitspracherwerb, Drittspracherwerb, Deutschunterricht, Interlingualer Transfer, Sprachdidaktik.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Begriffsklärung, Kapitel zu Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit, zur expliziten Thematisierung von Sprache im Unterricht, zur Rolle der Sprachbewusstheit beim Zweit- und Drittspracherwerb, zum Sprachvergleich als Unterrichtselement und ein Fazit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Inwiefern kann die individuelle Mehrsprachigkeit der Lernenden im Deutschunterricht für die Entwicklung und Förderung der Sprachbewusstheit genutzt werden?
Auf welche Art der Mehrsprachigkeit konzentriert sich die Arbeit?
Der Fokus liegt auf migrationsbedingter Mehrsprachigkeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Entwicklung und Förderung der Sprachbewusstheit im Deutschunterricht. Die Bedeutung der individuellen Mehrsprachigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382907