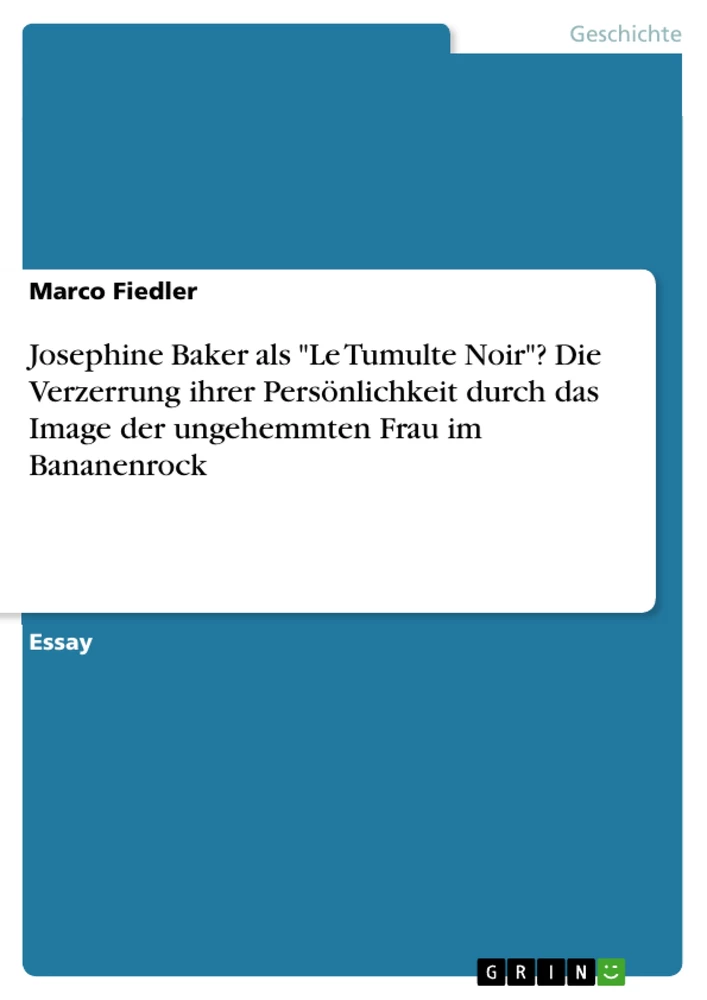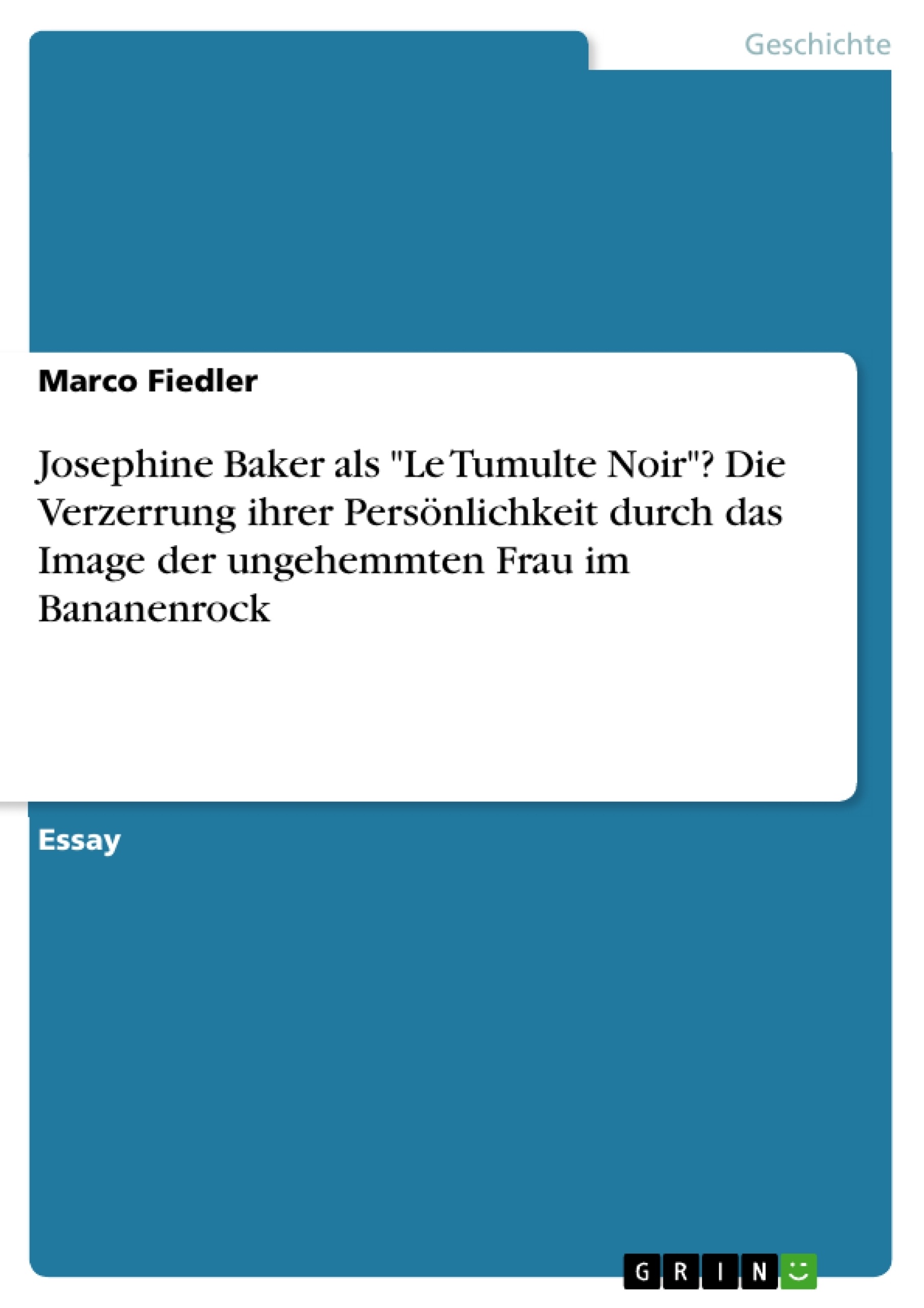Der Name Josephine Baker (1906-1975) wird oft mit der stereotypen Vorstellung einer schönen, jungen Frau verknüpft, die im Paris der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts - nackt oder nur mit einem knappen Bananenrock bekleidet - in den Revuetheatern der Stadt auftritt und mit teilweise clownesker Mimik freizügig und ausgelassen tanzt. Rasch erlangt sie durch ihre Darbietungen Berühmtheit, Einfluss und Reichtum und wird so auch zum "Sehnsuchtsobjekt" verschiedener Fantasien.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses beständig zirkulierende Bild der ungezügelten Nackten der Vorstellung von Josephine Baker in ihren frühen Pariser Jahren tatsächlich gerecht wird, oder ob das Image der ungehemmten Frau im Bananenrock nicht eher auch große Teile ihrer Person und Persönlichkeit überlagern und einseitig verzerren?
Inhaltsverzeichnis
- Josephine Baker - Le Tumulte Noir?
- Das beständige Bild der ungezügelten Nackten
- Der Nackttanz an sich
- Josephine Baker im Privatleben
- Couture und das Zirkustier
- Gabrielle Chanel und Josephine Baker
- Josephine Baker in Bildern
- Tamara de Lempicka und das Art déco
- Madonna und das Art déco
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit dem Bild, das die Öffentlichkeit von Josephine Baker in den 1920er Jahren in Paris hatte. Er hinterfragt die weitverbreitete Vorstellung, dass Baker ausschließlich als nackte Tänzerin in den Revue-Theatern auftrat. Der Essay analysiert die verschiedenen Facetten von Bakers Persönlichkeit, ihre Rolle als Künstlerin, ihre Modevorlieben und ihren Einfluss auf die Gesellschaft.
- Das öffentliche Bild von Josephine Baker und die stereotype Vorstellung der nackten Tänzerin
- Die Ambivalenz von Nacktheit im Tanz und Josephine Bakers künstlerische Nutzung
- Die Rolle von Couture und Luxusgütern in Bakers Privatleben und als Schutzschild vor der öffentlichen Wahrnehmung
- Die Bedeutung von Gabrielle Chanel und Tamara de Lempicka im Kontext des Art déco und ihrer Beziehung zu Josephine Baker
- Die Rezeption von Josephine Baker und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und die Kunstgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer Darstellung des stereotypen Bildes von Josephine Baker als freizügige Revuetänzerin, die in den Pariser Theatern auftrat. Er beleuchtet die Rolle des Grafikers Paul Colin, der mit seinen Entwürfen dieses Bild prägte.
- Es wird weiter ausgeführt, dass Nacktheit im Tanz kein spezifisches Merkmal von Josephine Baker war. Auch andere Tänzerinnen wie Mata Hari und Anita Berber bedienten sich exotischer und erotisierender Ausdrucksformen. Der Essay betont, dass Nacktheit im Tanz nicht automatisch lasterhaft sein muss und dass es bei Josephine Baker um eine künstlerische Nutzung handelt.
- Es wird gezeigt, wie Josephine Baker Couture und Luxusgüter nutzte, um sich von der stark sexualisierenden Wahrnehmung der nackten Tänzerin zu distanzieren. Der Essay führt die Fotografie "Grace in Cage" von Jean Paul Goude an, die diese Vorstellung illustriert.
- Der Essay stellt die Beziehung zwischen Josephine Baker und Gabrielle Chanel in den Kontext ihrer Zeit und ihren Einfluss auf die Modewelt. Es wird betont, wie Chanel die Frau für die Öffentlichkeit anzieht, während Baker sich für die Öffentlichkeit auszieht.
- Es wird darauf hingewiesen, dass es ein Stigma ist, Josephine Baker ausschließlich als nackte Tänzerin zu sehen. Der Essay möchte dieses Bild revidieren und Bakers vielschichtige Persönlichkeit, ihr soziales und politisches Engagement sowie ihre Bedeutung für die Kunstgeschichte in den Vordergrund stellen.
Schlüsselwörter
Josephine Baker, Nacktheit, Tanz, Revuetänzerin, Paul Colin, Mata Hari, Anita Berber, Couture, Gabrielle Chanel, Tamara de Lempicka, Art déco, Madonna, Soziales Engagement, Politisches Engagement, Pantheon.
- Quote paper
- Marco Fiedler (Author), 2023, Josephine Baker als "Le Tumulte Noir"? Die Verzerrung ihrer Persönlichkeit durch das Image der ungehemmten Frau im Bananenrock, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382657