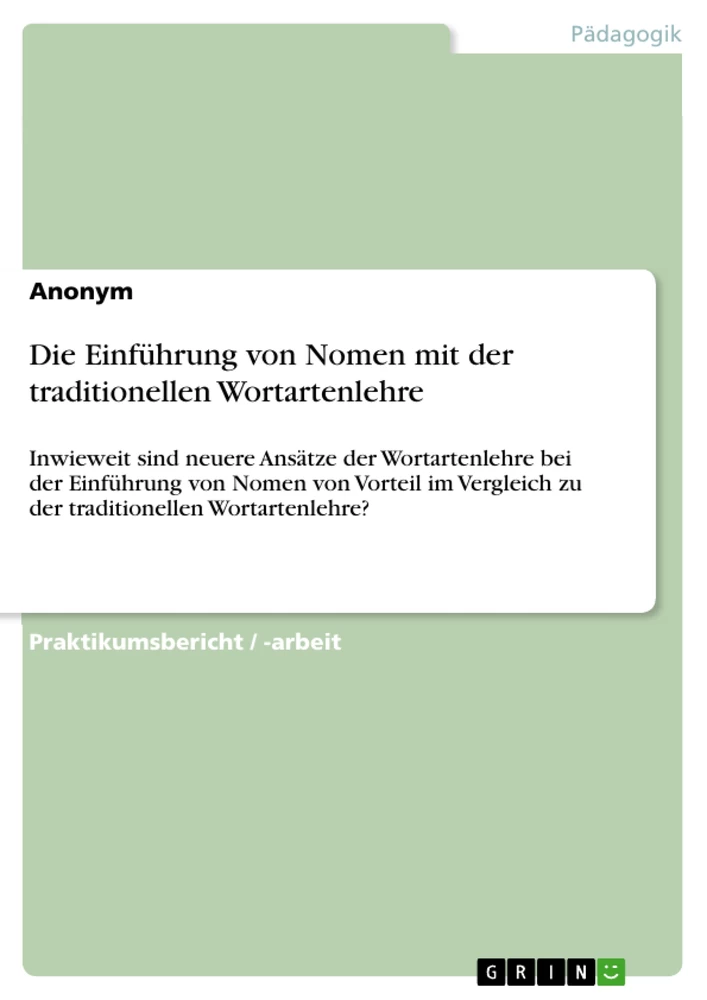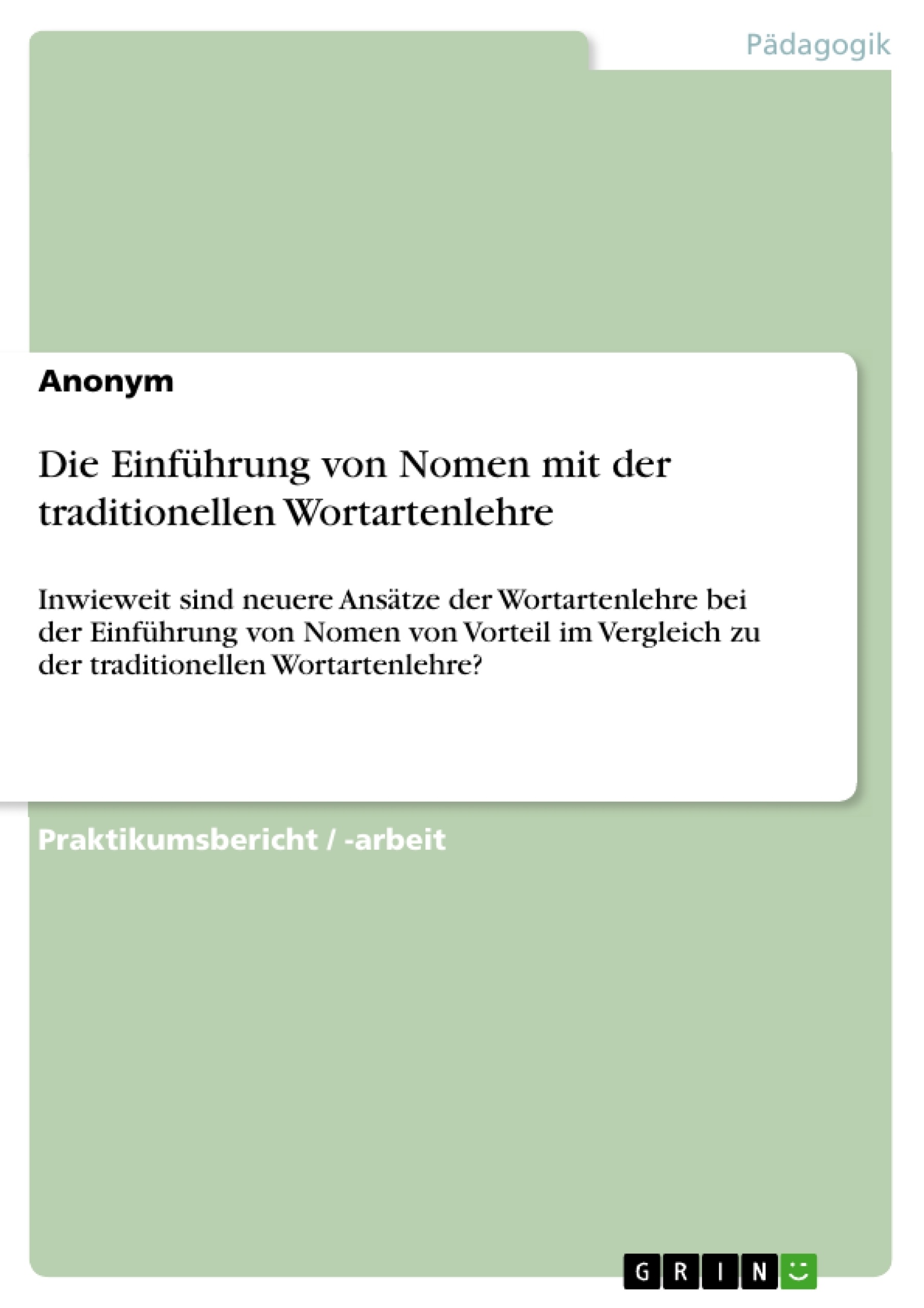In diesem Praktikumsbericht geht es um die Einführung von Nomen. Auch ich habe die Nomen anhand der traditionellen Wortartenlehre eingeführt. Zu Beginn wird von meiner Unterrichtssequenz berichtet, bevor im nächsten Kapitel auf den theoretischen Hintergrund eingegangen wird. Dabei wird zuerst die Schulgrammatik und ihre Kritik kurz umrissen. Anschließend wird die lexikalisch-kategoriale Wortartenlehre in Bezug zu den Nomen näher erläutert: Worin besteht die traditionelle Wortartenlehre? Warum wird sie so stark kritisiert? Und wenn sie doch so stark kritisiert wird, gibt es denn neuere beziehungsweise andere Ansätze? Diese Fragen haben schlussendlich zu der Leitfrage dieser Arbeit geführt: Inwieweit sind neuere Ansätze der Wortartenlehre bei der Einführung von Nomen von Vorteil im Vergleich zu der traditionellen Wortartenlehre?
Um diese Frage zu beantworten werden in Kapitel 4 neuere Ansätze der Wortartenlehre dargestellt. Das Ende bildet die Reflexion der Unterrichtssequenz und das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die geplante Unterrichtssequenz
- 2.1 Thema und Kernanliegen
- 2.2 Die Lerngruppe
- 2.3 Darstellung und Begründung der Lehr-/Lernstruktur
- 3 Der theoretische Hintergrund
- 3.1 Die Schulgrammatik und ihre Kritik
- 3.2 Die traditionelle Wortartenlehre
- 3.3 Die Kritik an der traditionellen Wortartenlehre
- 4 Neuere Erkenntnisse der Sprachwissenschaft
- 4.1 Der syntaktische Ansatz
- 4.2 Die Grammatik-Werkstatt nach Menzel
- 5 Reflexion der Unterrichtssequenz
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung von Nomen im Deutschunterricht der Grundschule. Sie vergleicht den traditionellen, lexikalisch-kategorialen Ansatz mit neueren Ansätzen der Wortartenlehre und bewertet deren Vor- und Nachteile. Die Arbeit basiert auf einer selbst durchgeführten Unterrichtssequenz und der reflexiven Analyse derselben.
- Traditionelle vs. neuere Ansätze der Wortartenlehre
- Praxisbezogene Anwendung der Wortartenlehre im Grundschulunterricht
- Analyse einer konkreten Unterrichtssequenz zur Einführung von Nomen
- Herausforderungen im Grammatikunterricht der Grundschule
- Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Problematik des Grammatikunterrichts in der Grundschule, seine Unbeliebtheit bei Schülern und Lehrern und die Diskussion um alternative Ansätze zur traditionellen Wortartenlehre. Sie führt die Herausforderungen des Lehrplans ein und begründet die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit der traditionellen Methode der Nomen-Einführung. Die eigene Arbeit wird als Beitrag zu dieser Diskussion positioniert, mit dem Fokus auf den Vergleich traditioneller und neuerer Ansätze.
2 Die geplante Unterrichtssequenz: Dieses Kapitel beschreibt detailliert eine dreistündige Unterrichtssequenz zur Einführung von Nomen in einer jahrgangsgemischten Grundschulklasse (Jahrgangsstufen 1-3). Es werden die einzelnen Stunden mit ihren Lernzielen und Methoden dargestellt, angefangen von der Einführung des Begriffs „Nomen“ über die Anwendung von Nomenproben bis hin zum Erkennen von Nomen in Texten. Die Heterogenität der Lerngruppe und die damit verbundenen Herausforderungen werden deutlich gemacht. Die didaktische Struktur mit steigender Schwierigkeit wird beschrieben und begründet.
3 Der theoretische Hintergrund: Dieses Kapitel analysiert die traditionelle Wortartenlehre und ihre Kritikpunkte. Es beleuchtet die lexikalisch-kategoriale Methode der Nomen-Einführung und deren Schwächen. Es werden kritische Stimmen aus der Fachdidaktik zitiert, die die traditionelle Methode als fehleranfällig und lernhemmend darstellen. Der Fokus liegt auf der Frage, warum trotz bestehender Kritik die traditionelle Methode weiterhin im Unterricht verwendet wird.
4 Neuere Erkenntnisse der Sprachwissenschaft: Hier werden neuere Ansätze der Wortartenlehre vorgestellt, wie der syntaktische Ansatz und die Grammatik-Werkstatt nach Menzel. Diese Ansätze werden im Kontext der Kritik an der traditionellen Methode dargestellt und deren potenziell positive Effekte für den Grundschulunterricht diskutiert. Es wird untersucht, warum diese innovativen Methoden im Grundschulunterricht bisher nur wenig Verbreitung gefunden haben.
5 Reflexion der Unterrichtssequenz: Dieses Kapitel dient der Reflexion der im zweiten Kapitel beschriebenen Unterrichtssequenz. Es werden die Erfolge und Schwierigkeiten der Umsetzung der traditionellen Methode analysiert und kritisch reflektiert. Die Reflexion bezieht sich auf die Lernziele, die Methoden und die Reaktion der Schüler. Der Bezug zu den in Kapitel 3 und 4 dargestellten theoretischen Ansätzen wird hergestellt und eine kritische Bewertung der eigenen Unterrichtspraxis durchgeführt.
Schlüsselwörter
Nomen, Wortartenlehre, Grammatikunterricht, Grundschule, traditionelle Wortartenlehre, neuere Ansätze, syntaktischer Ansatz, Grammatik-Werkstatt, Lexikalisch-kategoriale Methode, Unterrichtssequenz, Reflexion, Lehrplan, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einführung von Nomen im Deutschunterricht der Grundschule
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Einführung von Nomen im Deutschunterricht der Grundschule. Sie vergleicht den traditionellen, lexikalisch-kategorialen Ansatz mit neueren Ansätzen der Wortartenlehre und bewertet deren Vor- und Nachteile anhand einer selbst durchgeführten und reflektierten Unterrichtssequenz.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die traditionelle Wortartenlehre und ihre Kritik, neuere Ansätze wie den syntaktischen Ansatz und die Grammatik-Werkstatt nach Menzel, die Planung und Durchführung einer konkreten Unterrichtssequenz zur Einführung von Nomen in einer jahrgangsgemischten Grundschulklasse (Jahrgangsstufen 1-3), sowie die Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis und die Herausforderungen im Grammatikunterricht der Grundschule.
Welche Ansätze der Wortartenlehre werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den traditionellen, lexikalisch-kategorialen Ansatz mit neueren Ansätzen, insbesondere dem syntaktischen Ansatz und der Grammatik-Werkstatt nach Menzel. Die Vor- und Nachteile beider Ansätze werden im Kontext des Grundschulunterrichts diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, die geplante Unterrichtssequenz (inkl. Thema, Lerngruppe und Lehr-/Lernstruktur), der theoretische Hintergrund (traditionelle Wortartenlehre und deren Kritik), neuere Erkenntnisse der Sprachwissenschaft, Reflexion der Unterrichtssequenz und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer selbst durchgeführten dreistündigen Unterrichtssequenz zur Einführung von Nomen in einer jahrgangsgemischten Grundschulklasse. Die Sequenz wird detailliert beschrieben, und deren Erfolg und Herausforderungen werden kritisch reflektiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die traditionelle Methode der Nomen-Einführung kritisch zu hinterfragen und neuere, potenziell effektivere Ansätze im Kontext des Grundschulunterrichts zu beleuchten. Sie möchte einen Beitrag zur Diskussion um einen effektiven und schülergerechten Grammatikunterricht leisten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nomen, Wortartenlehre, Grammatikunterricht, Grundschule, traditionelle Wortartenlehre, neuere Ansätze, syntaktischer Ansatz, Grammatik-Werkstatt, Lexikalisch-kategoriale Methode, Unterrichtssequenz, Reflexion, Lehrplan, Heterogenität.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Grundschullehrer*innen, Fachdidaktiker*innen und alle, die sich mit dem Thema Grammatikunterricht in der Grundschule und der Einführung von Nomen auseinandersetzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die Einführung von Nomen mit der traditionellen Wortartenlehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382519