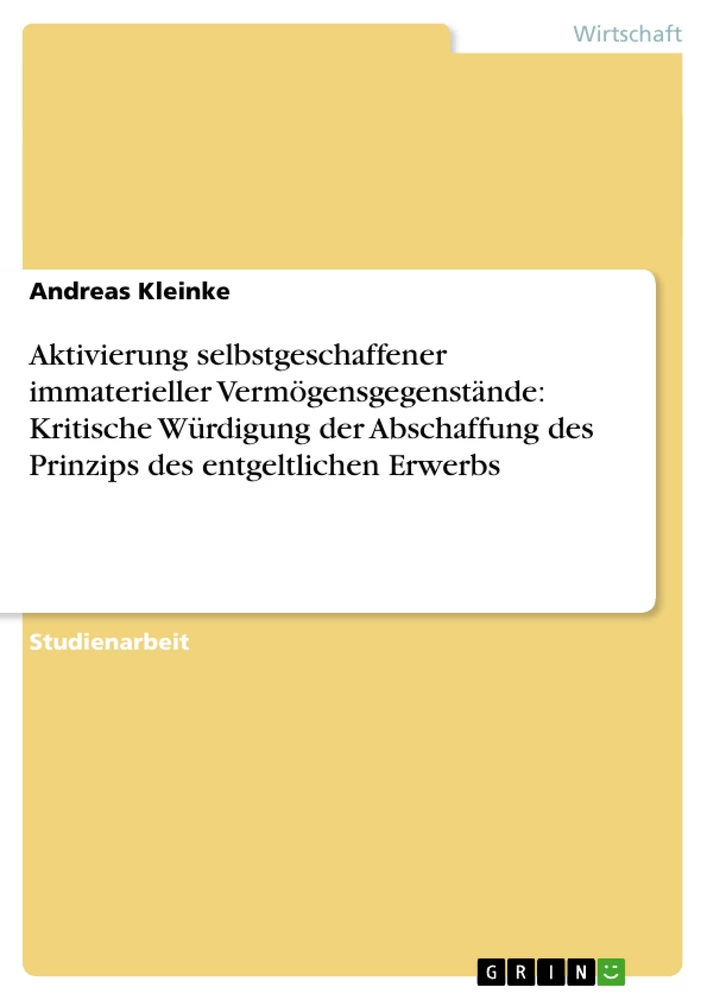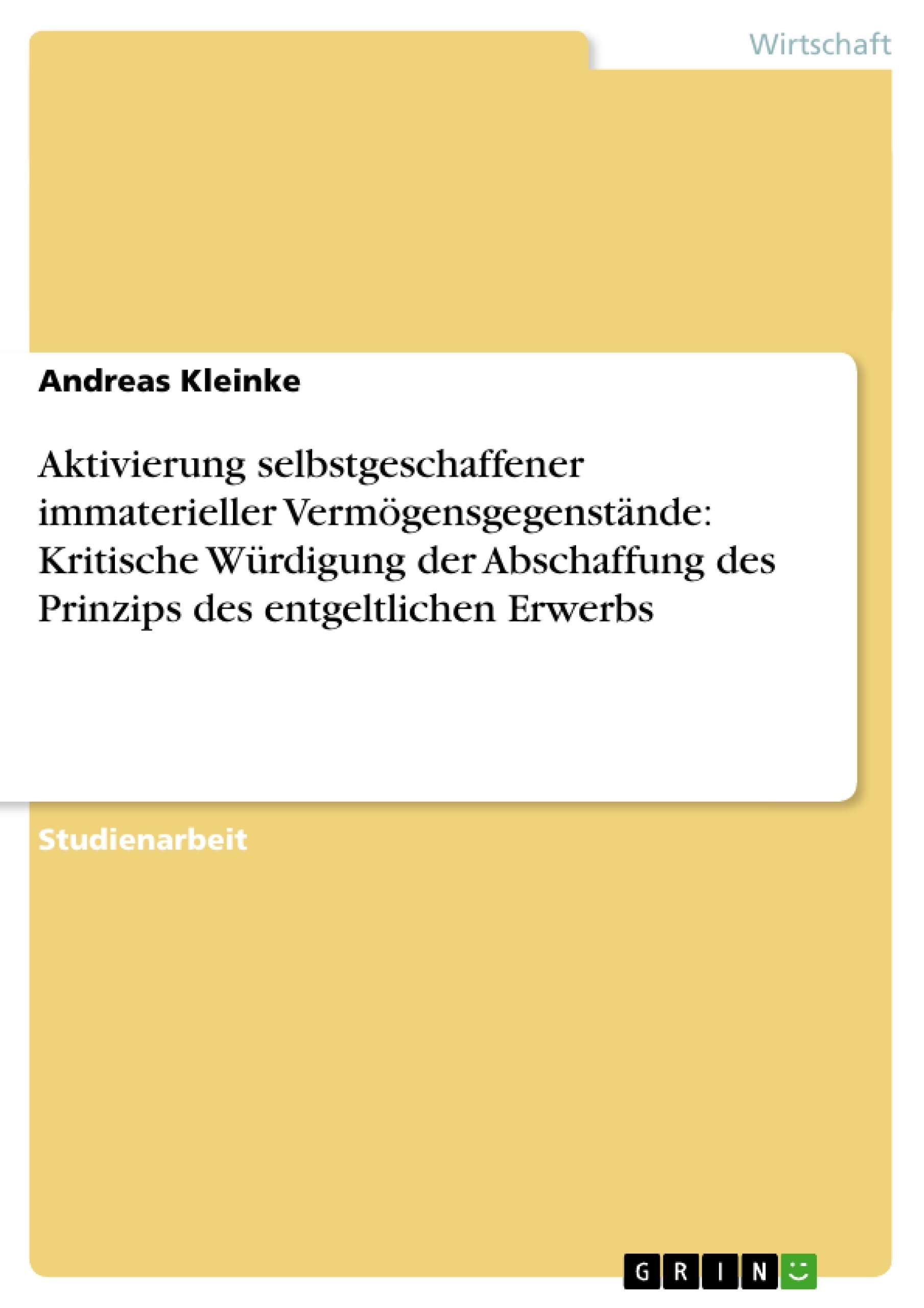„Das HGB wird nicht mehr dasselbe sein!“ Mit diesen Worten lässt sich eine der
wohl größten Reformen des deutschen Bilanzrechts beschreiben. Am 8.11.2007 hat
das Bundesministerium der Justiz den erwarteten Referentenentwurf eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) veröffentlicht. Der Gesetzgeber verfolgt
mit diesem Entwurf das Ziel, das Handelsgesetzbuch zu modernisieren und somit
den Unternehmen im Vergleich zu den internationalen Rechnungslegungsstandards
eine gleichwertige, aber weniger komplexe und kostengünstigere Alternative zu
bieten. Eine wesentliche geplante Änderung stellt die Abschaffung des Prinzips des
entgeltlichen Erwerbs, welches in § 248 Abs. 2 HGB3 kodifiziert ist, dar. Folglich
möchte der Gesetzgeber Entwicklungskosten aktiviert wissen, was keine Neuerung
im internationalen Kontext darstellt, da in IAS 38 die Aktivierung von Entwicklungskosten
bereits vorgeschrieben ist. So soll durch diese Änderung der zunehmenden
Bedeutung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechnung getragen
werden, was eine Stärkung der Informationsfunktion des Jahresabschlusses
bewirken soll, wobei an der Zahlungsbemessungsfunktion festgehalten werden
soll.
An dieser ambitionierten dualistischen Zielsetzung gilt es den Gesetzgeber zu
messen. Als erstes stellt sich die Frage, ob den Adressaten durch die Abschaffung
des Aktivierungsverbots ein Mehr an Informationen bereitgestellt wird. Es ist auch
zu hinterfragen, ob dem Bilanzierenden ein subjektiver Ermessensspielraum ermöglicht
wird und dadurch zu einer Entobjektivierung der Jahresabschlussinformationen
führt. Eine der zentralen Zielsetzungen an denen sich der Gesetzgeber
messen lassen muss, ist die Frage, in wieweit diese geplante Neuregelung mit
den elementaren Funktionen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses harmonisiert,
insbesondere mit der durch die Ausschüttungsstatik geprägten objektivierten und
vorsichtigen Ermittlung eines ausschüttungsfähigen Gewinns.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Zielsetzung der handelsrechtlichen Rechnungslegung
- Die abstrakte Aktivierungsfähigkeit
- Das Vermögenswertprinzip
- Das Greifbarkeits- und Übertragbarkeitsprinzip
- Das Prinzip selbständiger Bewertbarkeit
- Die konkrete Aktivierungsfähigkeit: Das Prinzip des entgeltlichen Erwerbs
- Kritische Würdigung der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die geplante Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die Zielsetzung ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen dieser Änderung auf die handelsrechtliche Rechnungslegung.
- Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände
- Harmonisierung von Handelsrecht, Steuerrecht und IFRS
- Auswirkungen auf die Informationsfunktion des Jahresabschlusses
- Kritische Bewertung der Objektivität und Vorsicht im Jahresabschluss
- Ermessensspielraum des Bilanzierenden
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der geplanten Bilanzrechtsreform durch das BilMoG und der damit verbundenen Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs im HGB. Dies wird als eine weitreichende Änderung charakterisiert, die die Aktivierung von selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen ermöglicht und eine Annäherung an internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS) darstellt. Die zentrale Frage ist, ob diese Änderung zu einer Verbesserung der Informationsqualität des Jahresabschlusses führt, ohne die fundamentalen Prinzipien der handelsrechtlichen Rechnungslegung zu beeinträchtigen.
Zielsetzung der handelsrechtlichen Rechnungslegung: Dieses Kapitel dürfte die grundlegenden Ziele der handelsrechtlichen Rechnungslegung erörtern. Es wird wahrscheinlich die Funktionen des Jahresabschlusses, wie z.B. die Informationsfunktion und die Funktion der Gewinn- und Verlustrechnung für die Ausschüttungsentscheidung, erläutern. Die Diskussion wird sich wahrscheinlich auf die Notwendigkeit einer Balance zwischen Transparenz und Objektivität konzentrieren und die Herausforderungen bei der Berücksichtigung von immateriellen Vermögenswerten beleuchten.
Die abstrakte Aktivierungsfähigkeit: In diesem Abschnitt wird vermutlich auf die allgemeinen Kriterien eingegangen, die erfüllt sein müssen, damit ein Vermögensgegenstand überhaupt aktiviert werden kann. Dies beinhaltet wahrscheinlich eine Diskussion über das Vermögenswertprinzip (wirtschaftlicher Wert), die Greifbarkeit und Übertragbarkeit, sowie die selbstständige Bewertbarkeit des Vermögensgegenstandes. Die Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Aktivierung von immateriellen Vermögenswerten erörtern.
Die konkrete Aktivierungsfähigkeit: Das Prinzip des entgeltlichen Erwerbs: Dieser Abschnitt befasst sich mit der bisherigen Rechtslage, insbesondere mit dem Prinzip des entgeltlichen Erwerbs gemäß § 248 Abs. 2 HGB. Er wird detailliert erklären, warum die Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände bisher nur unter sehr restriktiven Bedingungen möglich war. Die Diskussion wird sich wahrscheinlich mit den Problemen und den Folgen der bisherigen Regelung auseinandersetzen.
Kritische Würdigung der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs: Hier wird die Kernargumentation der Arbeit zu finden sein. Die Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs wird kritisch bewertet. Es werden wahrscheinlich sowohl positive als auch negative Aspekte der geplanten Änderung diskutiert. Besonders im Fokus dürfte die Frage nach der Objektivität und der Vorsicht der Bilanzierung im Lichte des neuen Rahmens stehen. Die Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen werden vermutlich ebenso analysiert.
Schlüsselwörter
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Aktivierung, Immaterielle Vermögensgegenstände, Entgeltlicher Erwerb, Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), Jahresabschluss, Informationsfunktion, Objektivität, Vorsicht, Ermessensspielraum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs im BilMoG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch die geplante Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und deren Auswirkungen auf die handelsrechtliche Rechnungslegung. Der Fokus liegt auf der Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände und der Harmonisierung mit internationalen Standards (IFRS).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Problemstellung der Bilanzrechtsreform, die Zielsetzung der handelsrechtlichen Rechnungslegung, die abstrakte und konkrete Aktivierungsfähigkeit (inkl. des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs), eine kritische Würdigung der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs und bietet eine thesenförmige Zusammenfassung. Spezifische Themen sind die Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögenswerte, die Harmonisierung von Handelsrecht, Steuerrecht und IFRS, die Auswirkungen auf die Informationsfunktion des Jahresabschlusses, die Objektivität und Vorsicht im Jahresabschluss sowie der Ermessensspielraum des Bilanzierenden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Problemstellung, der Zielsetzung der handelsrechtlichen Rechnungslegung, der abstrakten und konkreten Aktivierungsfähigkeit (inkl. des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs) und einer kritischen Würdigung der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der Thematik.
Was versteht man unter "abstrakter Aktivierungsfähigkeit"?
Die abstrakte Aktivierungsfähigkeit beschreibt die allgemeinen Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Vermögensgegenstand überhaupt aktiviert werden kann. Dies umfasst das Vermögenswertprinzip (wirtschaftlicher Wert), die Greifbarkeit und Übertragbarkeit sowie die selbstständige Bewertbarkeit.
Was versteht man unter "konkreter Aktivierungsfähigkeit" und dem Prinzip des entgeltlichen Erwerbs?
Die konkrete Aktivierungsfähigkeit bezieht sich auf die bisherige Rechtslage gemäß § 248 Abs. 2 HGB, insbesondere das Prinzip des entgeltlichen Erwerbs. Dieses Prinzip schränkte die Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände stark ein.
Welche Kritikpunkte werden an der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs geübt?
Die Arbeit bewertet kritisch die Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs, diskutiert positive und negative Aspekte und beleuchtet insbesondere die Auswirkungen auf die Objektivität und Vorsicht der Bilanzierung sowie die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Aktivierung, Immaterielle Vermögensgegenstände, Entgeltlicher Erwerb, Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), Jahresabschluss, Informationsfunktion, Objektivität, Vorsicht, Ermessensspielraum.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs auf die handelsrechtliche Rechnungslegung ab. Es soll untersucht werden, ob die Änderung zu einer Verbesserung der Informationsqualität des Jahresabschlusses führt, ohne die fundamentalen Prinzipien der handelsrechtlichen Rechnungslegung zu beeinträchtigen.
- Quote paper
- Andreas Kleinke (Author), 2008, Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände: Kritische Würdigung der Abschaffung des Prinzips des entgeltlichen Erwerbs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138250