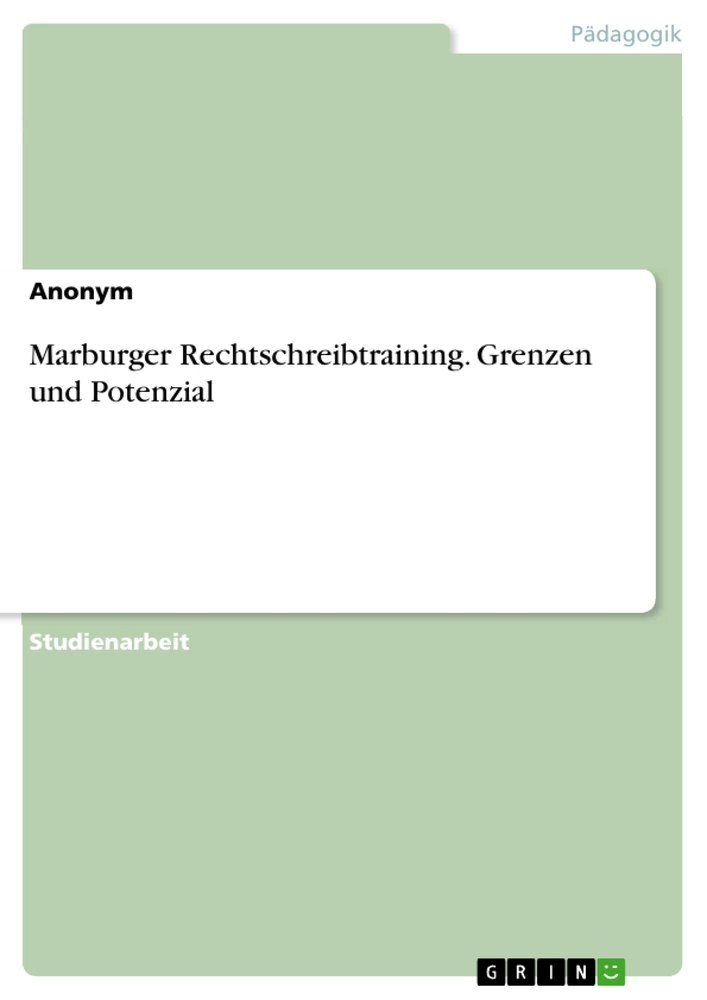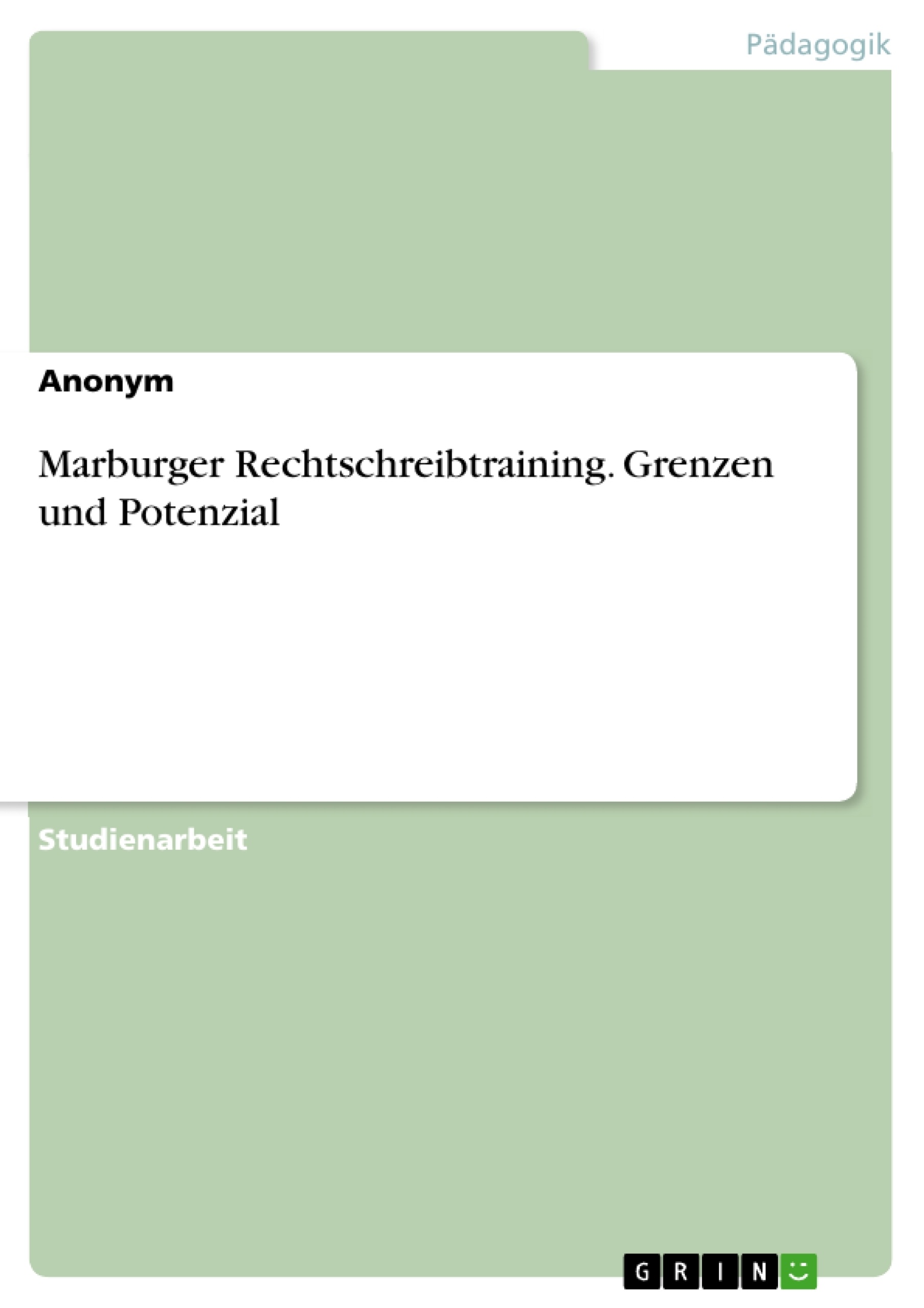Diese Hausarbeit beschäftigt sich im Hinblick auf die Lese-Rechtschreibstörung (LRS) mit dem Förderprogramm des Marburger Rechtschreibtrainings. Dabei soll vorerst grundlegend auf die Problematik der Lese-Rechtschreibstörung eingegangen werden, bevor vor dem Hintergrund dessen verschiedene Fördermöglichkeiten bzw. Förderprogramme und ihre Wirksamkeit vorgestellt werden.
Im Fokus dieser Programme steht jedoch das sogenannte Marburger Rechtschreibtraining (MRT) von Gerd Schulte-Körne und Frank Mathwig, über das im Rahmen dieser Abhandlung näher reflektiert werden soll. So sollen Grenzen und Potenziale des Rechtschreibtrainings aufgezeigt und erläutert werden, sowie sich mit der Frage beschäftigt werden, welche Vorteile die Verwendung des Marburger Rechtschreibtrainings gegenüber der anderer LRS-Förderprogrammen bietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
- 2. Mögliche Fördermöglichkeiten bei LRS
- 3. Das Marburger Rechtschreibtraining
- 3.1 Ansatz und Wirksamkeit
- 3.2 Studienlage und Ergebnisse
- 3.3 Abgrenzung zur Lautgetreuen Lese-Rechtschreibförderung
- 4. Grenzen und Potenziale des Marburger Rechtschreibtrainings
- 5. Ausblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Marburger Rechtschreibtraining (MRT) im Kontext von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Zunächst wird die Problematik von LRS grundlegend beleuchtet, bevor verschiedene Fördermöglichkeiten und deren Wirksamkeit vorgestellt werden. Der Fokus liegt auf dem MRT von Schulte-Körne und Mathwig, dessen Grenzen und Potenziale analysiert werden. Es wird auch der Vergleich mit anderen LRS-Förderprogrammen thematisiert.
- Definition und Charakterisierung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS)
- Übersicht verschiedener Förderprogramme für LRS
- Detaillierte Betrachtung des Marburger Rechtschreibtrainings (MRT)
- Wirksamkeit und Grenzen des MRT im Vergleich zu anderen Methoden
- Potenziale des MRT für die LRS-Förderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein. Sie beschreibt den Fokus auf das Marburger Rechtschreibtraining (MRT) als Förderprogramm für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Es wird eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Problematik von LRS angekündigt, bevor verschiedene Fördermöglichkeiten und deren Wirksamkeit vorgestellt werden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Reflexion des MRT, wobei Grenzen und Potenziale aufgezeigt und ein Vergleich mit anderen LRS-Förderprogrammen angestrebt wird.
1.1 Lese-Rechtschreibschwierigkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den Symptomen von LRS. Es wird der Begriff "Lese-Rechtschreibschwierigkeiten" anstelle von "LRS" oder "Legasthenie" bevorzugt, um negative Konnotationen zu vermeiden. Die Definition von LRS wird durch Bezugnahme auf Waldemar von Suchdoletz erläutert, wobei die Abgrenzung zu Intelligenzminderung, ungünstigen Lernbedingungen und anderen Störungen betont wird. Es werden typische Symptome im Lesen und Schreiben beschrieben, basierend auf der ICD-10 von 2006. Schließlich wird spekulativ auf mögliche Ursachen von LRS eingegangen, unter anderem auf das Drei-Ebenen-Modell von Frith und die Rolle der phonologischen Informationsverarbeitung.
2. Mögliche Fördermöglichkeiten bei LRS: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Fördermöglichkeiten für LRS, wobei der Fokus auf den Programmen "Lautarium" und "Phonit" liegt. Es werden deren Ansätze und Wirksamkeit kurz beschrieben, mit Betonung auf die Entwicklung phonologischer Bewusstheit und phonetischer Wahrnehmung. Der Unterschied in der Wirkungsweise und Eignung für unterschiedliche Altersgruppen wird herausgestellt. Des Weiteren werden die "Lautgetreue Rechtschreibförderung" von Carola Reuter-Liehr und das Marburger Rechtschreibtraining kurz vorgestellt, um den Übergang zum detaillierteren Fokus im folgenden Kapitel zu schaffen.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS), Legasthenie, Marburger Rechtschreibtraining (MRT), Förderprogramme, phonologische Bewusstheit, phonetische Wahrnehmung, orthografisches Wissen, Lautgetreue Rechtschreibförderung, Wirksamkeit, Grenzen, Potenziale.
Häufig gestellte Fragen zum Marburger Rechtschreibtraining (MRT)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Marburger Rechtschreibtraining (MRT) im Kontext von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Sie beleuchtet zunächst die Problematik von LRS, präsentiert verschiedene Fördermöglichkeiten und deren Wirksamkeit, und konzentriert sich dann detailliert auf das MRT. Die Arbeit untersucht die Grenzen und Potenziale des MRT und vergleicht es mit anderen LRS-Förderprogrammen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Definition und Charakterisierung von LRS, eine Übersicht verschiedener Förderprogramme (inkl. Lautarium und Phonit), eine detaillierte Betrachtung des MRT, eine Analyse der Wirksamkeit und Grenzen des MRT im Vergleich zu anderen Methoden und eine Erörterung der Potenziale des MRT für die LRS-Förderung. Es wird auch auf die Abgrenzung von LRS zu Intelligenzminderung und ungünstigen Lernbedingungen eingegangen, sowie auf mögliche Ursachen von LRS, basierend auf dem Drei-Ebenen-Modell von Frith.
Welche Förderprogramme werden neben dem MRT vorgestellt?
Neben dem Marburger Rechtschreibtraining werden die Programme „Lautarium“ und „Phonit“ sowie die „Lautgetreue Rechtschreibförderung“ von Carola Reuter-Liehr kurz vorgestellt und im Hinblick auf ihre Ansätze und Wirksamkeit verglichen. Der Fokus liegt jedoch auf dem MRT.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS), Legasthenie, Marburger Rechtschreibtraining (MRT), Förderprogramme, phonologische Bewusstheit, phonetische Wahrnehmung, orthografisches Wissen, Lautgetreue Rechtschreibförderung, Wirksamkeit, Grenzen, Potenziale.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (mit Unterkapitel zu Lese-Rechtschreibschwierigkeiten), Mögliche Fördermöglichkeiten bei LRS, Das Marburger Rechtschreibtraining (mit Unterkapiteln zu Ansatz und Wirksamkeit, Studienlage und Ergebnisse, und Abgrenzung zur Lautgetreuen Lese-Rechtschreibförderung), Grenzen und Potenziale des Marburger Rechtschreibtrainings, und Ausblick und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Definition von LRS wird verwendet?
Die Arbeit verwendet den Begriff "Lese-Rechtschreibschwierigkeiten" anstelle von "LRS" oder "Legasthenie", um negative Konnotationen zu vermeiden. Die Definition von LRS orientiert sich an Waldemar von Suchdoletz und berücksichtigt die Abgrenzung zu Intelligenzminderung, ungünstigen Lernbedingungen und anderen Störungen. Es werden typische Symptome im Lesen und Schreiben basierend auf der ICD-10 von 2006 beschrieben.
Wie wird die Wirksamkeit des MRT bewertet?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit des MRT im Vergleich zu anderen Methoden. Konkrete Ergebnisse und Studien werden im Kapitel zum MRT und dessen Abgrenzung zu anderen Förderprogrammen diskutiert. Die Bewertung der Wirksamkeit erfolgt sowohl durch die Analyse bestehender Studien als auch durch die Gegenüberstellung der Ansätze und Potenziale des MRT mit anderen Förderansätzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Marburger Rechtschreibtraining. Grenzen und Potenzial, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382231