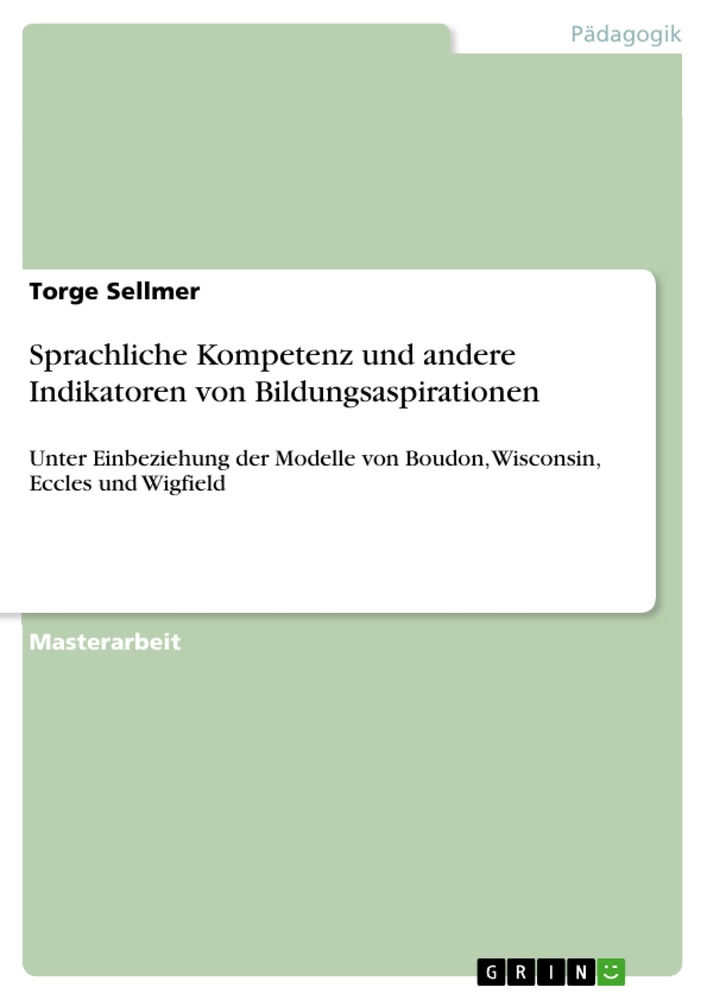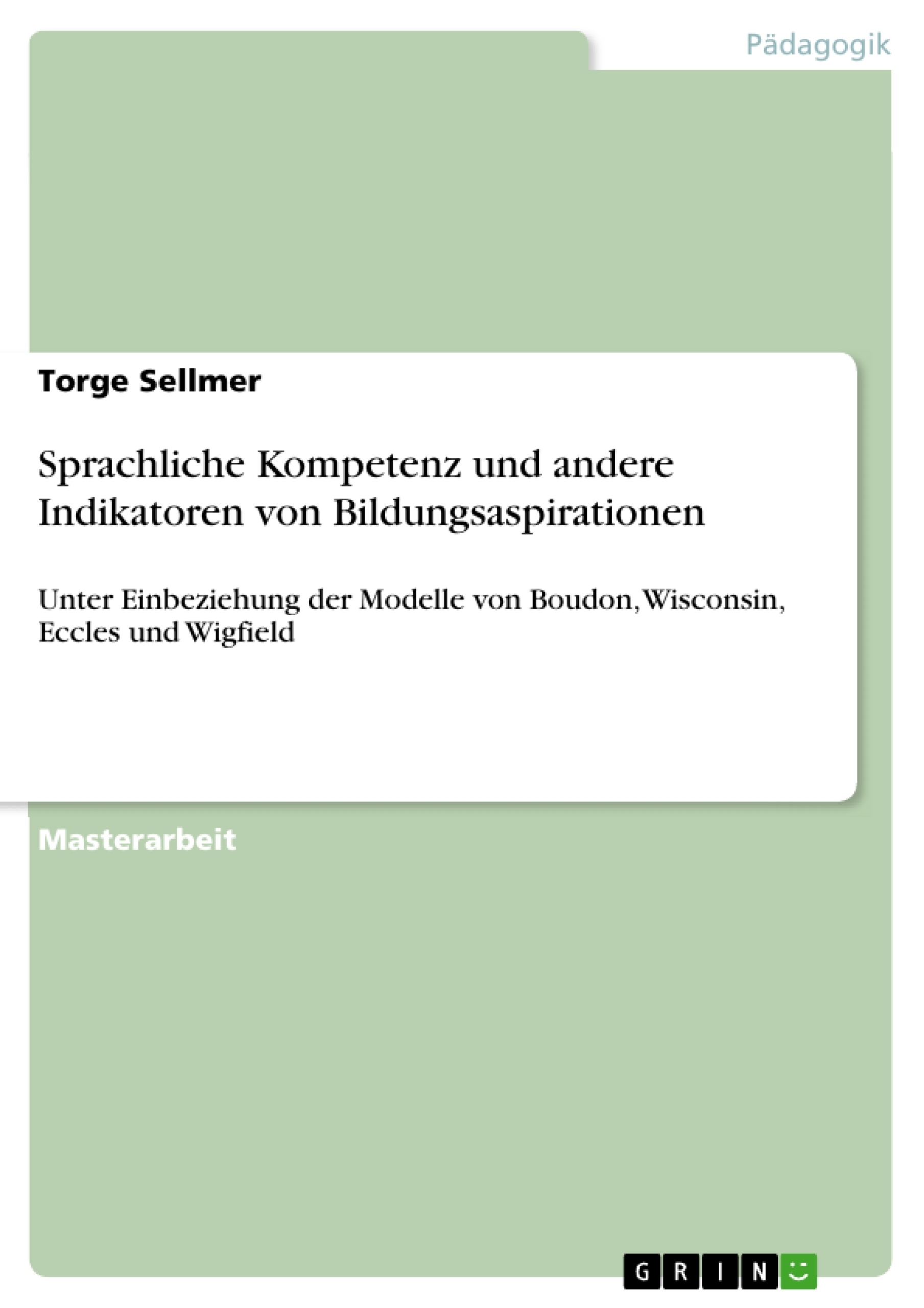Die vorliegende quantitative Studie widmet sich der Untersuchung der Determinanten von Bildungsaspirationen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund. Das primäre Anliegen besteht in der Beantwortung der Forschungsfrage: Besteht ein Zusammenhang zwischen den sprachlichen Fertigkeiten in der deutschen Sprache von Schüler:innen mit Migrationshintergrund und der Höhe ihrer Bildungsaspirationen? Auf der Grundlage des Modells der rationalen Wahl von Raymond Boudon, dem Wisconsin Modell und dem Erwartung-Wert-Modell der Leistungsmotivation von Eccles und Wigfield werden fünf Prädiktoren von Bildungsaspirationen identifiziert, zu denen der sozioökonomische Status, intrinsische und extrinsische Motivation, das Selbstkonzept und die Erwartungen der Eltern gehören.
Zusätzlich wird die sprachliche Kompetenz in der deutschen Sprache als ein möglicher Einflussfaktor untersucht. Die empirischen Daten von insgesamt 100 Schüler:innen mit Migrationshintergrund werden durch eine Kombination von Fragebogen und Sprachtest erhoben und mittels einer binär logistischen Regressionsanalyse auf statistische Signifikanz
analysiert. Nach einer gründlichen Auswertung der Ergebnisse werden drei von vier aufgestellten Hypothesen abgelehnt, da lediglich der Prädiktor der elterlichen Erwartungen einen bedeutsamen und positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß der Bildungsaspirationen der untersuchten Zielgruppe zeigt. Bei der Forschung sind zahlreiche Limitationen zu berücksichtigen, um die interpretative Genauigkeit der vorliegenden Befunde angemessen zu bewerten.
Einige der Einschränkungen sind eine begrenzte Stichprobengröße, ungeeignete Fragestellungen bei zwei der untersuchten Konstrukte im Fragebogen sowie mögliche Verzerrungen aufgrund subjektiver Interpretationen. In Bezug auf die praktische
Anwendbarkeit der Forschungsergebnisse ergibt sich die Implikation, dass eine verstärkte Einbindung der Eltern in den schulischen Alltag bei der Förderung der individuellen Bildungsaspirationen der Schüler:innen unterstützen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Gang der Untersuchung
- 2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand
- 2.1 Forschungsstand
- 2.2 Definition und Bedeutung von Bildungsaspirationen
- 2.3 Sprachliche Kompetenz
- 2.4 Schüler:innen mit Migrationshintergrund
- 3 Einflussfaktoren von Bildungsaspirationen
- 3.1 Das Modell der rationalen Wahl nach Raymond Boudon
- 3.2 Wisconsin Modell
- 3.3 Das Erwartung-Wert-Modell der Leistungsmotivation von Eccles und Wigfield
- 3.4 Ableitung der Fragestellung und Aufstellen von Hypothesen
- 4 Methode
- 4.1 Rekrutierung und Beschreibung der Stichprobe
- 4.2 Gütekriterien quantitativer Forschung
- 4.3 Auswertung des Fragebogens
- 4.4 Auswertung des C-Tests
- 4.5 Auswertung der logistischen Regressionsanalyse
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Deskriptive Auswertung
- 5.2 Inhaltliche Auswertung
- 6 Diskussion
- 6.1 Limitationen der Forschung
- 6.2 Theoretische und praktische Implikationen
- 6.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sprachlichen Fertigkeiten in Deutsch und Bildungsaspirationen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, die Relevanz der sprachlichen Kompetenz als Prädiktor für Bildungsaspirationen zu ermitteln. Die Studie stützt sich auf etablierte Modelle der Bildungsaspirationenforschung.
- Zusammenhang zwischen sprachlicher Kompetenz und Bildungsaspirationen
- Einflussfaktoren von Bildungsaspirationen (sozioökonomischer Status, Motivation, Selbstkonzept, elterliche Erwartungen)
- Anwendung des Modells der rationalen Wahl, des Wisconsin Modells und des Erwartungs-Wert-Modells
- Quantitative Untersuchung mittels Fragebogen und Sprachtest
- Bewertung der Limitationen und Implikationen der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bildungsaspirationen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund ein und formuliert die Forschungsfrage der Arbeit. Es skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Untersuchung.
2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema Bildungsaspirationen und definiert den Begriff. Es beschreibt die Bedeutung sprachlicher Kompetenz im Kontext von Bildung und Migration und charakterisiert die relevante Schüler:innengruppe. Es bildet die theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung.
3 Einflussfaktoren von Bildungsaspirationen: In diesem Kapitel werden verschiedene theoretische Modelle zur Erklärung von Bildungsaspirationen vorgestellt, darunter das Modell der rationalen Wahl nach Boudon, das Wisconsin-Modell und das Erwartungs-Wert-Modell von Eccles und Wigfield. Diese Modelle dienen zur Identifizierung relevanter Prädiktoren und zur Ableitung von Hypothesen für die empirische Studie. Der Fokus liegt auf der systematischen Integration bestehender Theorien in das Forschungsdesign.
4 Methode: Das Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie, inklusive der Rekrutierung der Stichprobe, der eingesetzten Messinstrumente (Fragebogen und C-Test), der statistischen Verfahren (logistische Regressionsanalyse) und der Gewährleistung der Gütekriterien. Es erläutert die Vorgehensweise zur Datenerhebung und -auswertung.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, sowohl deskriptiv als auch inhaltlich. Es beinhaltet die Auswertung der Fragebogendaten und der Ergebnisse des C-Tests sowie die Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse. Die Ergebnisse werden faktenbasiert und prägnant dargestellt.
6 Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen. Es analysiert die Limitationen der Forschung, zum Beispiel die Stichprobengröße oder potentielle Verzerrungen in der Datenerhebung. Es werden die theoretischen und praktischen Implikationen der Ergebnisse erörtert.
Schlüsselwörter
Bildungsaspirationen, Schüler:innen mit Migrationshintergrund, Sprachliche Kompetenz, Deutsch als Zweitsprache, Quantitative Forschung, Logistische Regressionsanalyse, Elterliche Erwartungen, Motivation, Selbstkonzept, sozioökonomischer Status.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Bildungsaspirationen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sprachlichen Fertigkeiten in Deutsch und Bildungsaspirationen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund. Das zentrale Ziel ist die Ermittlung der Relevanz sprachlicher Kompetenz als Prädiktor für Bildungsaspirationen.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf etablierte Modelle der Bildungsaspirationenforschung, darunter das Modell der rationalen Wahl nach Boudon, das Wisconsin-Modell und das Erwartungs-Wert-Modell von Eccles und Wigfield. Diese Modelle helfen, relevante Einflussfaktoren zu identifizieren und Hypothesen zu formulieren.
Welche Methoden wurden angewendet?
Es wurde eine quantitative Forschungsmethode eingesetzt. Die Datenerhebung erfolgte mittels Fragebogen und C-Test (Sprachtest). Die Datenanalyse umfasste deskriptive Auswertungen sowie eine logistische Regressionsanalyse.
Welche Einflussfaktoren auf Bildungsaspirationen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Einflussfaktoren, darunter den sozioökonomischen Status, die Motivation, das Selbstkonzept und die elterlichen Erwartungen der Schüler:innen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand, Einflussfaktoren von Bildungsaspirationen, Methode, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor, der theoretische Teil beschreibt relevante Modelle, der Methoden-Teil erläutert die Datenerhebung und -analyse, der Ergebnis-Teil präsentiert die gefundenen Zusammenhänge und die Diskussion wertet diese aus und zieht Schlussfolgerungen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der deskriptiven und inhaltlichen Auswertung der Fragebogendaten, des C-Tests und der logistischen Regressionsanalyse sind im Kapitel "Ergebnisse" detailliert dargestellt. Die Diskussion wertet diese im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen aus.
Welche Limitationen der Studie werden angesprochen?
Die Diskussion befasst sich mit den Limitationen der Forschung, wie z.B. der Stichprobengröße oder möglichen Verzerrungen in der Datenerhebung. Diese Einschränkungen werden kritisch reflektiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildungsaspirationen, Schüler:innen mit Migrationshintergrund, Sprachliche Kompetenz, Deutsch als Zweitsprache, Quantitative Forschung, Logistische Regressionsanalyse, Elterliche Erwartungen, Motivation, Selbstkonzept, sozioökonomischer Status.
Welche praktischen Implikationen ergeben sich aus der Studie?
Die Diskussion der Arbeit erläutert die theoretischen und praktischen Implikationen der Ergebnisse. Diese beziehen sich auf das Verständnis und die Förderung von Bildungsaspirationen bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund.
Wo finde ich den vollständigen Text der Arbeit?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht hier verfügbar. Diese FAQ bieten lediglich eine Zusammenfassung.
- Quote paper
- Torge Sellmer (Author), 2023, Sprachliche Kompetenz und andere Indikatoren von Bildungsaspirationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382167