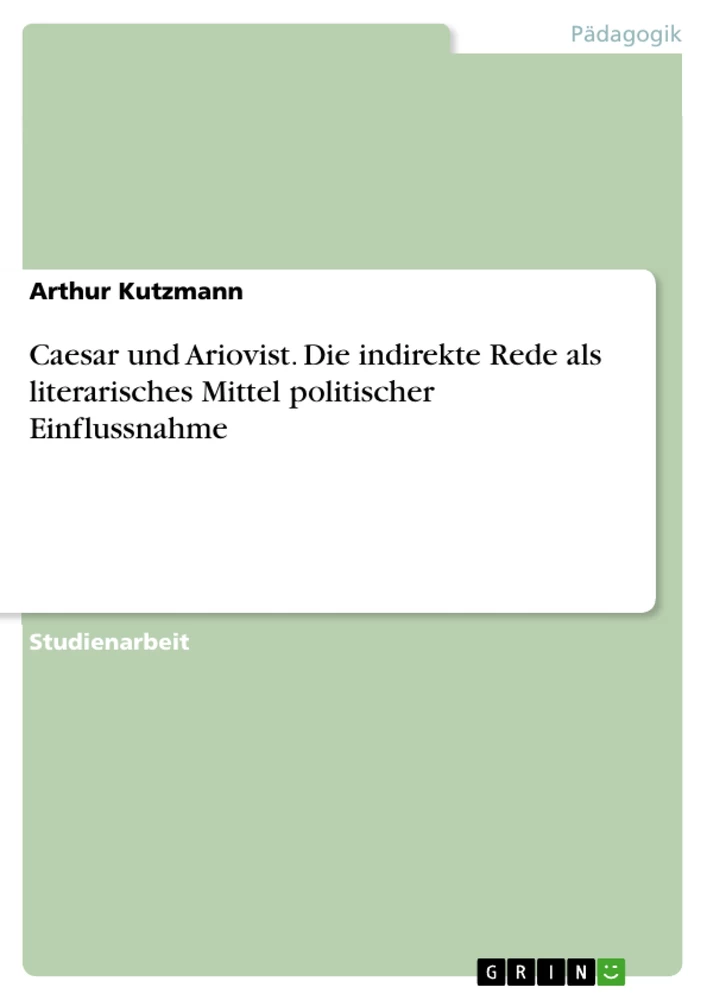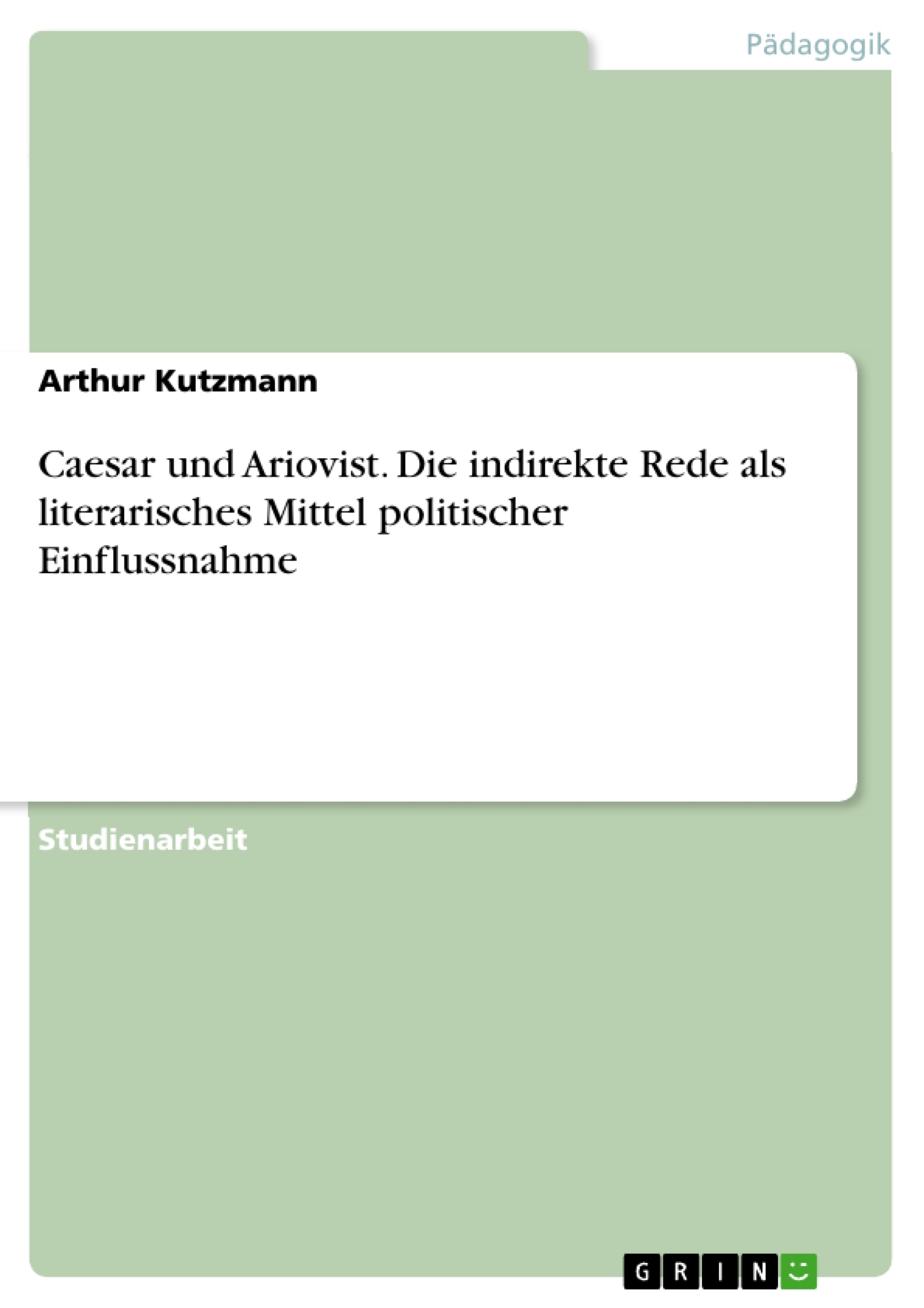Im Zentrum dieser fachwissenschaftlichen und -didaktischen Untersuchung steht mit der Textstelle 1, 35–(36) aus Caesars commentarii de bello Gallico ein eben solch funktional hochaufgeladenes Beispiel für eine Unterredung, die bis heute für den gymnasialen Lateinunterricht immer wieder verwertet wird. Dabei liegt der Fokus besonders auf Caesar selbst (Caes. Gal. 1,35), dessen von Ariovist nicht erwiderte Forderungen letztlich zum Schlagabtausch führen sollten sowie seiner sprachlich stilistischen Konstruktion eines bellum iustum.
Obwohl die kanonische Stellung der Caesar-Lektüre nie unbestritten war, bescheinigt gerade die Reformresistenz nicht nur ihr situatives Adaptionspotential, sondern vor allem ihren zeitlosen didaktischen Mehrwert für zentrale Elemente und Ziele des Lateinunterrichts. Letzteres ist daran festzumachen, dass sowohl Lehrkräfte als auch Schulbücher bis heute trotz gelegentlich aufflammender Kritik und der im Zuge der Kompetenzorientierung etablierten Liberalisierung der Autoren- und Textauswahl früher oder später auf Caesar und seine Schriften zurückgreifen, um die Sprach-, Text- und Kulturkompetenz und damit die sprachbildende und sog. historisch kommunikative Fähigkeit der SchülerInnen zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Fachwissenschaftliche Analyse von Caes. Gal. 1, 35–(36)
- 1. Grundlegendes zur Gattung commentarius
- 2. Funktionen indirekter Reden
- 3. Verortung der Textstelle im Werk
- 4. Text
- 5. Übersetzung Caes. Gal. 1,35 und sprachlich-stilistische Analyse
- III. Didaktische Überlegungen
- 1. Kompetenzbereiche
- a) Sprachkompetenz
- b) Textkompetenz
- c) Kulturkompetenz
- IV. Literatur
- V. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Textstelle Caesar, Gallierkrieg 1,35-36 unter fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Gesichtspunkten. Ziel ist es, die Funktion der indirekten Rede in diesem Abschnitt zu analysieren und deren didaktisches Potenzial für den Lateinunterricht aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf Caesars rhetorische Strategien zur politischen Einflussnahme und die Konstruktion eines "bellum iustum".
- Die Gattung commentarius bei Caesar und ihre spezifischen Merkmale.
- Die Funktion indirekter Reden als Mittel der Charakterisierung und politischen Propaganda.
- Die Konstruktion eines "bellum iustum" durch Caesar in der Textstelle.
- Didaktische Implikationen für den Lateinunterricht: Kompetenzorientierung und Originaltextlektüre.
- Sprachlich-stilistische Analyse der Textstelle.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die besondere Stellung Caesars im Lateinunterricht und dessen anhaltende Relevanz trotz Kompetenzorientierung. Sie hebt Caesars *commentarii de bello Gallico* als sprachlich und stilistisch wertvolles Material hervor, welches die Sprach-, Text- und Kulturkompetenz der Schüler fördert. Die Arbeit betont Caesars apologetische Absicht, den gallischen Krieg als gerechtfertigt darzustellen, um politisches Prestige zu erlangen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Kapitel 1,35-36 als Beispiel für Caesars rhetorische Strategien.
II. Fachwissenschaftliche Analyse von Caes. Gal. 1, 35–(36): Dieses Kapitel beginnt mit einer Auseinandersetzung mit der Gattung des *commentarius*, ihrem Ursprung und ihren Merkmalen im Vergleich zu anderen historischen Textformen. Es werden die Unterschiede zwischen Caesars Stil und dem anderer Historiker herausgearbeitet, insbesondere Caesars Fokus auf Objektivität und Bescheidenheit im Gegensatz zur Verwendung direkter Reden. Anschließend wird die Funktion indirekter Reden bei Caesar analysiert, wobei deren Rolle bei der Konstruktion von Feindbildern und der Selbstinszenierung Caesars als fairer Diplomat und erfolgreicher Feldherr im Mittelpunkt steht.
Schlüsselwörter
Caesar, Gallierkrieg, Indirekte Rede, Commentarius, Rhetorik, Politische Propaganda, Bellum Iustum, Didaktik, Lateinunterricht, Kompetenzorientierung, Sprachkompetenz, Textkompetenz, Kulturkompetenz, Meritokratisches Standesethos, Dignitas, Gloria.
Caesar, Gallierkrieg 1,35-36: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Textstelle Caesar, Gallierkrieg 1,35-36 unter fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Gesichtspunkten. Der Fokus liegt auf der Funktion der indirekten Rede in diesem Abschnitt und deren didaktischem Potenzial für den Lateinunterricht. Es wird untersucht, wie Caesar rhetorische Strategien zur politischen Einflussnahme und zur Konstruktion eines "bellum iustum" (gerechter Krieg) einsetzt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Gattung commentarius bei Caesar und ihre Merkmale; die Funktion indirekter Reden als Mittel der Charakterisierung und politischen Propaganda; die Konstruktion eines "bellum iustum" durch Caesar; didaktische Implikationen für den Lateinunterricht (Kompetenzorientierung und Originaltextlektüre); und eine sprachlich-stilistische Analyse der Textstelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: I. Einleitung; II. Fachwissenschaftliche Analyse von Caes. Gal. 1, 35–(36) (inkl. Grundlegendes zur Gattung commentarius, Funktionen indirekter Reden, Verortung der Textstelle im Werk, Text, Übersetzung und sprachlich-stilistische Analyse); III. Didaktische Überlegungen (inkl. Kompetenzbereiche: Sprachkompetenz, Textkompetenz, Kulturkompetenz); IV. Literatur; V. Anhang.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der Funktion der indirekten Rede in Caesar, Gallierkrieg 1,35-36 und die Aufzeigung des didaktischen Potenzials dieser Textstelle für den Lateinunterricht. Es soll gezeigt werden, wie Caesars rhetorische Strategien funktionieren und wie sie im Unterricht eingesetzt werden können.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Caesar, Gallierkrieg, Indirekte Rede, Commentarius, Rhetorik, Politische Propaganda, Bellum Iustum, Didaktik, Lateinunterricht, Kompetenzorientierung, Sprachkompetenz, Textkompetenz, Kulturkompetenz, Meritokratisches Standesethos, Dignitas, Gloria.
Wie wird Caesars Stil charakterisiert?
Die Arbeit hebt Caesars Fokus auf Objektivität und Bescheidenheit hervor, im Gegensatz zur Verwendung direkter Reden bei anderen Historikern. Sein Stil wird im Kontext der Gattung "commentarius" analysiert und mit anderen historischen Textformen verglichen.
Welche Rolle spielt die indirekte Rede?
Die indirekte Rede wird als Mittel der Charakterisierung und politischen Propaganda analysiert. Es wird untersucht, wie Caesar sie zur Konstruktion von Feindbildern und zur Selbstinszenierung als fairer Diplomat und erfolgreicher Feldherr einsetzt.
Welche didaktischen Implikationen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die didaktischen Implikationen für den Lateinunterricht, insbesondere im Hinblick auf Kompetenzorientierung und Originaltextlektüre. Es werden die Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Textstelle im Unterricht zur Förderung der Sprach-, Text- und Kulturkompetenz eingesetzt werden kann.
- Quote paper
- Arthur Kutzmann (Author), 2021, Caesar und Ariovist. Die indirekte Rede als literarisches Mittel politischer Einflussnahme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382160