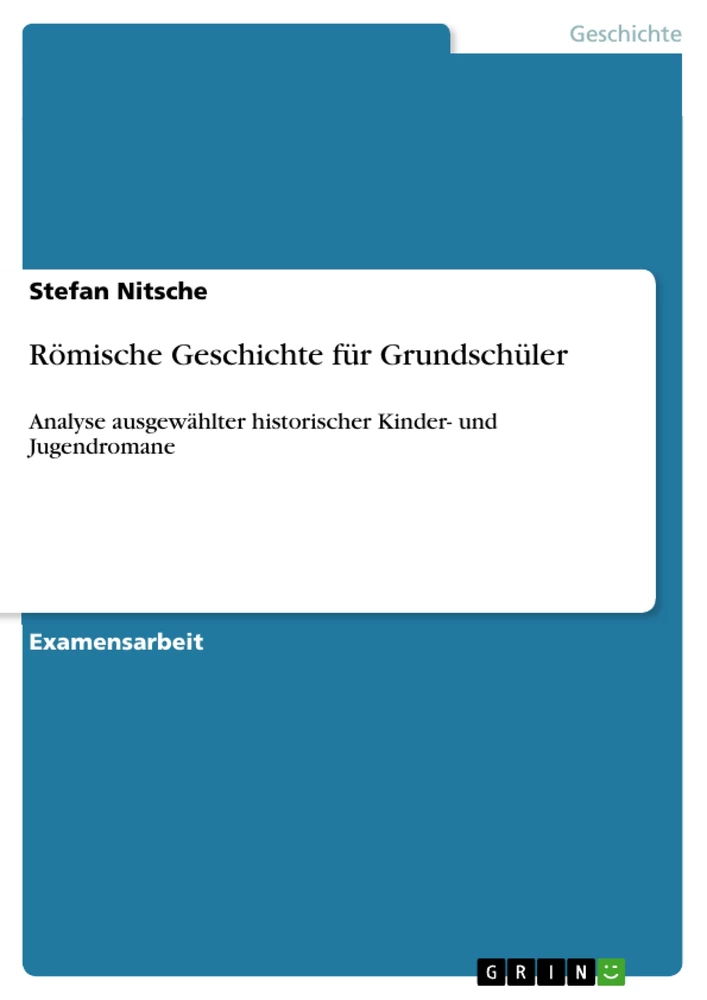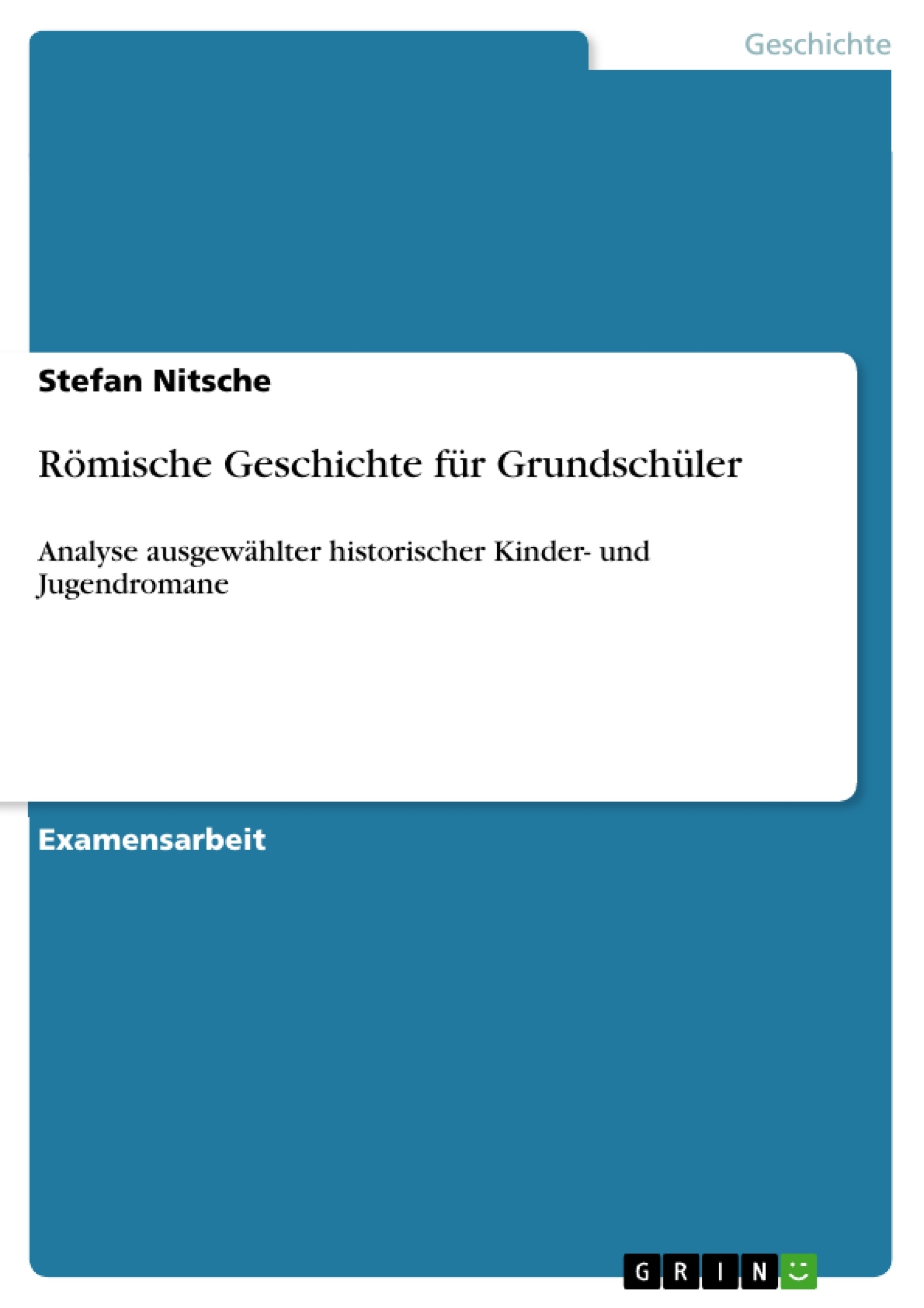Der Geschichtsunterricht ist heutzutage oftmals nicht kindgerecht und interessant genug gestaltet. Doch historisches Lernen kann auch anschaulich und für die Schüler erlebbar gestaltet werden: Und zwar schon in der Grundschule, wenn historische Themen im Sachunterricht behandelt werden.
Der größte Kritikpunkt am herkömmlichen Unterricht ist, dass die Neugier und Interessen der Kinder und Jugendlichen nicht berücksichtigt werden und sie immer mehr den Bezug zum Fach Geschichte verlieren. Allzu oft werden Ereignisse anhand des Schulbuchs einfach chronologisch abgearbeitet, ohne auf die Bedürfnisse und Fragen der Schüler einzugehen.
„Häufig kann die Schule die Begeisterung für die Sache nicht umsetzen in eine Begeisterung für das Fach. Da stellt sich die Frage, warum im Geschichtsunterricht nicht viel öfter auf Jugendbücher zurückgegriffen wird und diese als Medium zur Geschichtsvermittlung genutzt werden.“
Die Resultate der PISA-Studien geben weiteren Anlass, über eine Neugestaltung des Unterrichts nachzudenken. Da die deutschen Schüler vor allem in der Lesekompetenz schlechte Ergebnisse vorweisen, würde es sich doch geradezu anbieten, vermehrt historische Kinder- und Jugendbücher, die den Interessen der Schüler entgegenkommen, in den Unterricht zu integrieren. So kann einerseits die Kluft zwischen dem Schullesen und dem Freizeitlesen verringert werden, andererseits können Belehrung und Unterhaltung durch spannende historische Romane kombiniert werden.
Der Geschichtsunterricht und der Sachunterricht in der Grundschule bieten eine optimale Plattform dafür, die Freizeit- und Schullektüre näher aneinander heranzuführen: „Vielleicht ist das im Geschichtsunterricht sogar leichter als im Deutschunterricht. Hier verhindert gerade für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler die Bewertung oder Prüfung des Lesens durch Noten und Klassenarbeiten ein lustvolles Lesen. Im Geschichtsunterricht ist die „Entschulung“ des Lesens, die im Hinblick auf die Leseförderung so wichtig ist, vielleicht einfacher.“ Demnach ist es die Aufgabe der Schule, das Lesevergnügen der Kinder aufzubauen und zu verstärken und die Lesesozialisation zu beschleunigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historisches Lernen in der Grundschule
- 2.1 Was ist historisches Lernen?
- 2.2 Dimensionen des Geschichtsbewusstseins
- 2.2.1 Temporalbewusstsein
- 2.2.2 Wirklichkeitsbewusstsein
- 2.2.3 Historizitätsbewusstsein
- 2.2.4 Identitätsbewusstsein
- 2.2.5 Politisches Bewusstsein
- 2.2.6 Ökonomisch-Soziales Bewusstsein
- 2.2.7 Moralisches Bewusstsein
- 2.3 Historisches Lernen in der Grundschule
- 2.4 Ziele historischen Lernens
- 3. Historische Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht
- 3.1 Definition von historischer Kinder- und Jugendliteratur
- 3.2 Chancen und Gefahren von historischen Romanen
- 4. Begründung der Themenauswahl „Geschichte des alten Roms“
- 5. Analyse ausgewählter historischer Kinder- und Jugendbücher
- 5.1 Vorstellung des Kriterienkatalogs
- 5.1.1 Alltagsgeschichte
- 5.1.2 Förderung der Dimensionen des Geschichtsbewusstseins
- 5.1.3 Fachwissenschaftliche Korrektheit
- 5.1.4 Veranschaulichung und Vergegenwärtigung
- 5.1.5 Identifikation
- 5.1.6 Schülerinteressen und Lesemotivation
- 5.1 Vorstellung des Kriterienkatalogs
- 6. Analyse ausgewählter historischer Kinder- und Jugendbücher
- 6.1 Fiktiver Roman - Quintus in Gefahr (Hans-Dieter Stöver)
- 6.2 Zeitreise - Die Zeitenläufer. Verschwörung im alten Rom
- 6.3 Interaktive Zeitreise - Gefangen im alten Rom
- 6.4 Mitratekrimi – Falsches Spiel in der Arena (Fabian Lenk)
- 6.5 Roman mit Sachbuchelementen - Viel Spaß mit den Römern! (Freya Stephan-Kühn)
- 7. Vergleich der ausgewählten historischen Romane
- 8. Einsatz von historischen Romanen im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz historischer Kinder- und Jugendbücher im Grundschulunterricht, insbesondere im Hinblick auf die Geschichte des alten Roms. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie solche Bücher historisches Lernen fördern und die Lesekompetenz der Schüler stärken können. Die Arbeit analysiert verschiedene Romantypen und bewertet sie anhand eines Kriterienkatalogs.
- Förderung historischen Lernens in der Grundschule
- Analyse verschiedener Romantypen (z.B. fiktive Romane, Zeitreisen, Mitratekrimis)
- Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung historischer Kinder- und Jugendbücher
- Bedeutung von Alltagsgeschichte und der Dimensionen des Geschichtsbewusstseins
- Steigerung der Lesemotivation und Lesekompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung problematisiert den oft uninteressanten und wenig kindgerechten Geschichtsunterricht in der Grundschule. Sie betont die Bedeutung der Berücksichtigung der Schülerinteressen und die Notwendigkeit, historische Themen anschaulich und erlebbar zu gestalten. Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten, historische Kinder- und Jugendbücher als Medium zur Geschichtsvermittlung zu nutzen, um die Lesekompetenz zu fördern und die Kluft zwischen Schul- und Freizeitlektüre zu verringern. Die Arbeit fokussiert sich auf Romane und die Geschichte des alten Roms als Beispielthema.
2. Historisches Lernen in der Grundschule: Dieses Kapitel definiert historisches Lernen als einen bewussten und unbewussten Prozess der Konfrontation mit Geschichte. Es beschreibt das alltagsweltliche Geschichtsbewusstsein und die sieben Dimensionen des Geschichtsbewusstseins nach Hans-Jürgen Pandel (Temporal-, Wirklichkeits-, Historizitäts-, Identitäts-, politisches, ökonomisch-soziales und moralisches Bewusstsein). Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Förderung dieses Geschichtsbewusstseins im Grundschulunterricht.
3. Historische Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und die didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes historischer Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht. Es werden Chancen und Risiken, die mit der Verwendung historischer Romane verbunden sind, erörtert, um eine fundierte Grundlage für die spätere Analyse der ausgewählten Bücher zu schaffen.
4. Begründung der Themenauswahl „Geschichte des alten Roms“: Dieses Kapitel begründet die Wahl des Themas "Geschichte des alten Roms" für die nachfolgende Analyse. Es setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, ob diese Thematik für Grundschulkinder relevant und interessant ist, und argumentiert für die Möglichkeit, auch scheinbar weit entfernte historische Epochen für Kinder zugänglich zu machen. Hier wird die Relevanz für didaktische Ansätze begründet.
5. Analyse ausgewählter historischer Kinder- und Jugendbücher: Kapitel 5 präsentiert einen Kriterienkatalog zur Bewertung der ausgewählten historischen Kinder- und Jugendbücher. Dieser Katalog umfasst Aspekte wie die Darstellung von Alltagsgeschichte, die Förderung der Dimensionen des Geschichtsbewusstseins, die fachwissenschaftliche Korrektheit, die Veranschaulichung und Vergegenwärtigung, Identifikationspotential und die Berücksichtigung der Schülerinteressen und Lesemotivation. Dieser Katalog dient als Grundlage für die Analyse der einzelnen Romane in Kapitel 6.
6. Analyse ausgewählter historischer Kinder- und Jugendbücher: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Romantypen, die sich mit der Geschichte des alten Roms befassen. Es untersucht jeweils Aspekte wie Alltagsgeschichte, Förderung des Geschichtsbewusstseins, fachwissenschaftliche Korrektheit, Identifikation, Veranschaulichung und Lesemotivation. Die einzelnen Unterkapitel befassen sich jeweils mit einem Roman und dessen didaktischen Möglichkeiten.
7. Vergleich der ausgewählten historischen Romane: Dieses Kapitel vergleicht die in Kapitel 6 analysierten Romane im Hinblick auf ihre Stärken und Schwächen bezüglich des historischen Lernens und der Lesemotivation. Es zieht eine Bilanz der untersuchten Romane anhand des zuvor definierten Kriterienkatalogs und zieht daraus Schlussfolgerungen für den Einsatz im Unterricht.
8. Einsatz von historischen Romanen im Unterricht: Das Kapitel 8 widmet sich der konkreten didaktischen Umsetzung des Einsatzes historischer Romane im Unterricht. Es bietet didaktische Modelle und Vorschläge, wie man die Bücher in den Unterricht integrieren und die Schüler aktiv ins Lernen einbeziehen kann. Es werden praktische Tipps zur Unterrichtsgestaltung gegeben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einsatz Historischer Kinder- und Jugendbücher im Grundschulunterricht (am Beispiel des alten Roms)
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einsatz historischer Kinder- und Jugendbücher im Grundschulunterricht, insbesondere zur Vermittlung der Geschichte des alten Roms. Es geht darum, aufzuzeigen, wie diese Bücher historisches Lernen fördern und die Lesekompetenz der Schüler stärken können.
Welche Aspekte werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Romantypen (fiktive Romane, Zeitreisen, Mitratekrimis etc.) und bewertet sie anhand eines speziell entwickelten Kriterienkatalogs. Dieser Katalog berücksichtigt Aspekte wie die Darstellung von Alltagsgeschichte, die Förderung des Geschichtsbewusstseins (nach Pandel), die fachwissenschaftliche Korrektheit, die Veranschaulichung, Identifikationspotenzial und die Lesemotivation.
Welche Dimensionen des Geschichtsbewusstseins werden betrachtet?
Die Arbeit bezieht sich auf die sieben Dimensionen des Geschichtsbewusstseins nach Hans-Jürgen Pandel: Temporalbewusstsein, Wirklichkeitsbewusstsein, Historizitätsbewusstsein, Identitätsbewusstsein, politisches Bewusstsein, ökonomisch-soziales Bewusstsein und moralisches Bewusstsein. Die Analyse der Bücher untersucht, inwieweit diese Dimensionen angesprochen und gefördert werden.
Welche Bücher werden konkret analysiert?
Die Arbeit analysiert mehrere historische Kinder- und Jugendbücher zum Thema antikes Rom, darunter "Quintus in Gefahr" (Hans-Dieter Stöver), "Die Zeitenläufer. Verschwörung im alten Rom", "Gefangen im alten Rom", "Falsches Spiel in der Arena" (Fabian Lenk) und "Viel Spaß mit den Römern!" (Freya Stephan-Kühn). Die Auswahl repräsentiert verschiedene Romantypen.
Wie wird die Relevanz des Themas "altes Rom" begründet?
Die Arbeit argumentiert für die Relevanz des Themas "altes Rom" für Grundschulkinder, auch wenn es sich um eine scheinbar weit entfernte Epoche handelt. Es wird dargelegt, wie auch solche Themen anschaulich und kindgerecht aufbereitet werden können, um Interesse und Lernmotivation zu wecken.
Welchen Kriterienkatalog verwendet die Arbeit?
Der Kriterienkatalog bewertet die Bücher anhand folgender Aspekte: Alltagsgeschichte, Förderung der Dimensionen des Geschichtsbewusstseins, fachwissenschaftliche Korrektheit, Veranschaulichung und Vergegenwärtigung, Identifikationspotenzial, Schülerinteressen und Lesemotivation.
Welche didaktischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit bietet neben der Analyse der Bücher auch didaktische Vorschläge und Modelle zur Integration historischer Romane in den Grundschulunterricht. Es werden praktische Tipps zur Unterrichtsgestaltung gegeben, um den Einsatz der Bücher effektiv zu gestalten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zum Einsatz historischer Romane im Unterricht, basierend auf dem Vergleich der analysierten Bücher und dem entwickelten Kriterienkatalog. Es werden Stärken und Schwächen der einzelnen Romantypen im Hinblick auf historisches Lernen und Lesemotivation herausgearbeitet.
Welche Probleme des Geschichtsunterrichts werden angesprochen?
Die Einleitung der Arbeit problematisiert den oft uninteressanten und wenig kindgerechten Geschichtsunterricht in der Grundschule. Es wird die Notwendigkeit betont, Schülerinteressen zu berücksichtigen und historische Themen anschaulich und erlebbar zu gestalten.
Wie kann diese Arbeit für Lehrkräfte nützlich sein?
Diese Arbeit bietet Lehrkräften einen fundierten Überblick über den Einsatz historischer Kinder- und Jugendbücher im Unterricht. Sie liefert einen Kriterienkatalog zur Auswahl geeigneter Bücher, analysiert verschiedene Romantypen und gibt konkrete didaktische Tipps zur Unterrichtsgestaltung.
- Quote paper
- Stefan Nitsche (Author), 2008, Römische Geschichte für Grundschüler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138174