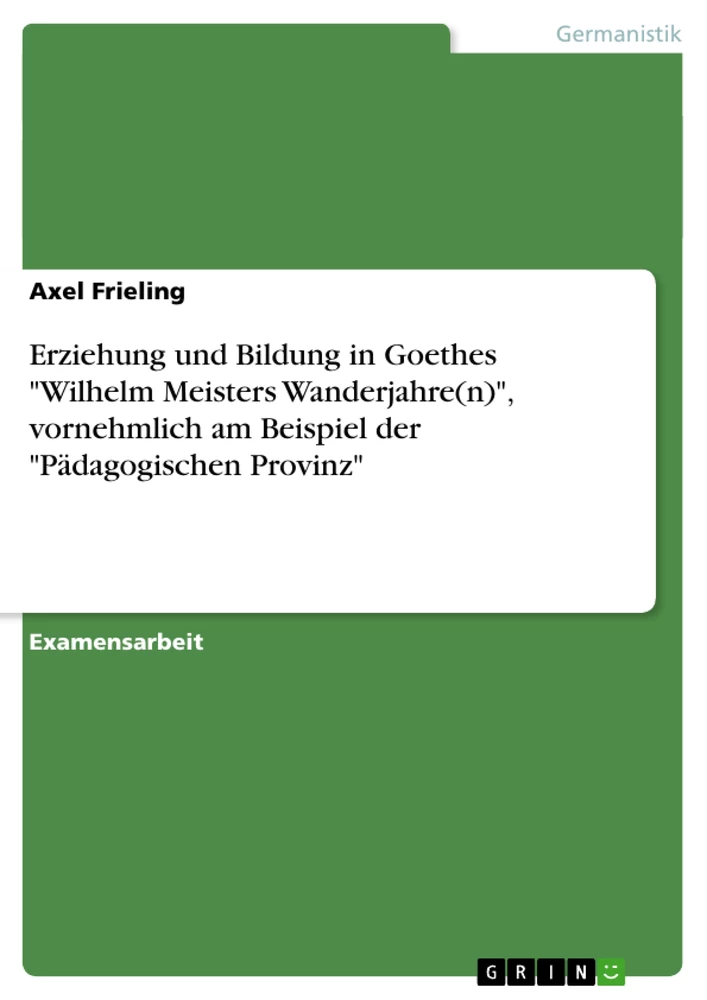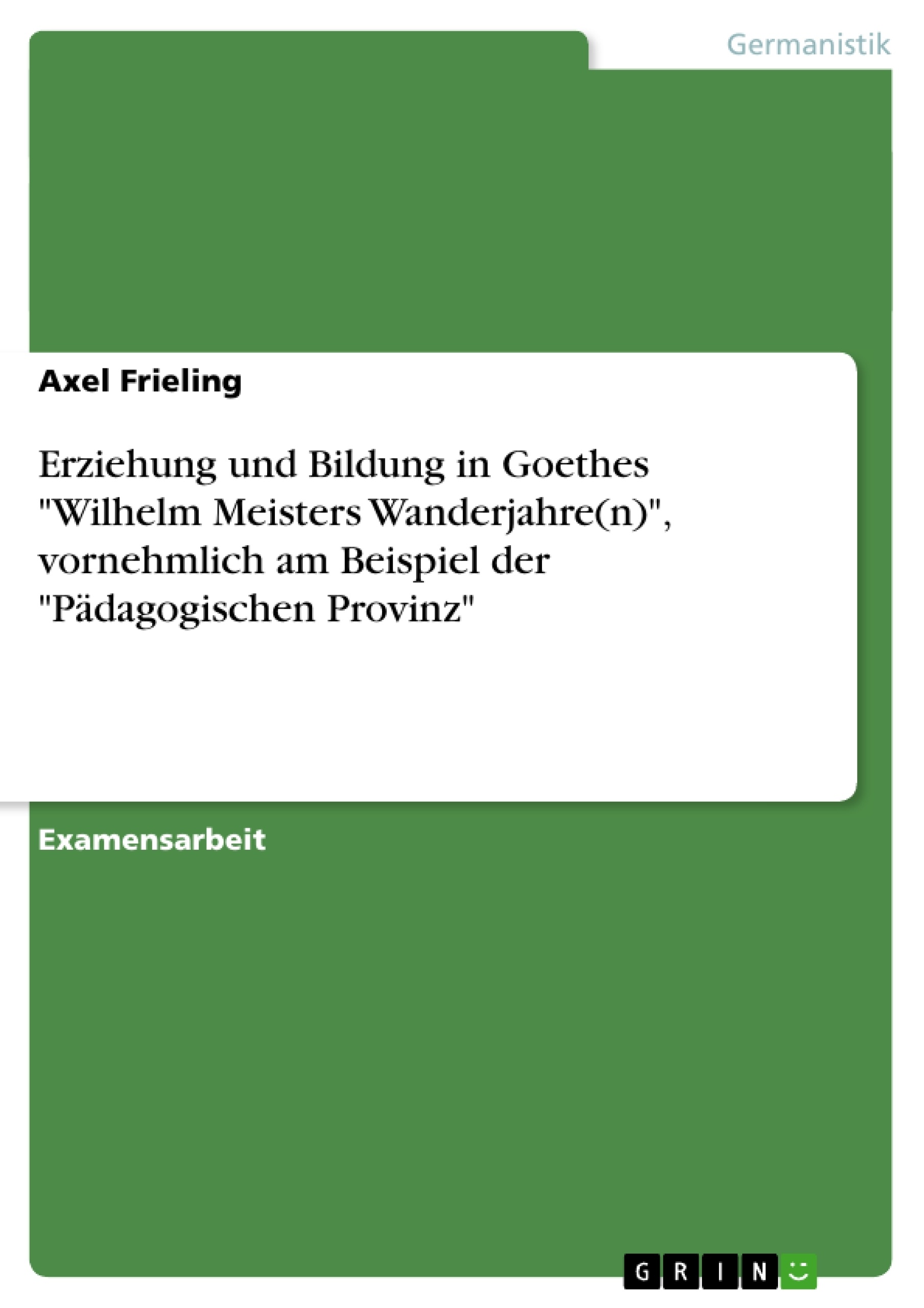Johann Wolfgang von Goethe unterschied ganz im Sinne heutiger erziehungswissenschaftlicher Terminologie bereits sehr fein zwischen den Konzepten "Erziehung" einerseits und "Bildung" andererseits. Die Formel "Erziehung zur Bildung" deutet sein Begriffsverständnis an: Ersteres zielt als Werkzeug auf Letzteres als Endpunkt und finales Ideal allen pädagogischen Handelns.
Die Goetheschen Bildungsvorstellungen aktualisieren sich leitmotivisch, wie man weiß, in Dramen, Romanen und der Lyrik, durchweben also gewissermaßen das Gesamtwerk. Die entsprechende Forschungsliteratur kann schon quantitativ kaum noch überblickt werden. Demgegenüber bleiben die dezidiert pädagogischen Aspekte des literarischen Werkes und übrigens auch des sozial- und kulturpolitischen Schaffens des Staatsfunktionärs Goethes merkwürdig unberücksichtigt. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag dazu, dieses Missverhältnis aufzuheben. Vornehmlich am Beispiel Goethes Vision einer "Pädagogischen Provinz", wie sie in dem Roman "Wilhelm Meisters Wanderjahre" entfaltet wird, weist sie nach, dass Goethe in ständiger Auseinandersetzung mit den pädagogischen Strömungen seiner Zeit sowie auf der Grundlage eines vielschichtigen Bildungsbegriffs originäre Vorstellungen einer wirksamen, pragmatischen Erziehung entwickelte und literarisch gestaltete.
Inhaltsverzeichnis
- I Einführung
- 1. Einleitung
- 1.1 Bildungs- und Erziehungsdenken in den „Wanderjahren“
- 1.2 Bildung und Erziehung im Leben des Dichters
- 2. Bildung versus Erziehung
- 3. Überlegungen zur Methode
- 4. Goethe als Wissenschaftstheoretiker und systematischer Denker
- 1. Einleitung
- II Bildung
- 1. WMW im Umbruch der Zeiten
- 2. Bildung als Funktion der Gemeinschaft
- 2.1 Der Auswandererbund
- 3. Formale und inhaltliche Bildung
- 3.1 Der Lebensberuf
- 4. Entelechie
- 4.1 Biologisierung des Humanen
- 4.2 Dämon
- 4.3 Tyche
- 5. Wilhelm
- 5.1 Methoden
- 5.1.1 Die Wanderung
- 5.1.2 Stationen
- 5.1.2.1 Ordnungen und Sittlichkeit
- 5.1.2.2 Erfolge
- 5.1.3 Bildsamkeit
- 5.2 Entsagung
- 5.2.1 Begrenzungen
- 5.2.2 Zufälle
- 5.3 Tätigkeit
- 5.3.1 Tat und Sittlichkeit
- 5.3.2 Tat und Sinn
- 5.3.3 Weg und Ziel
- 5.4 Entsprechungen
- 5.4.1 Schranken
- 5.4.2 Streben und Wirkung
- 5.1 Methoden
- III Die pädagogische Provinz
- 1. Ehrfurcht
- 1.1 Oben
- 1.2 Unten
- 1.3 Mitte
- 2. Stufen
- 2.1 Imagination
- 2.2 Symbole
- 2.3 Befreiung im Denken
- 2.4 Die oberste Ehrfurcht
- 3. Die Pädagogische Provinz im Kontext des Romans
- 4. Erziehung
- 4.1 Formen
- 4.1.1 Die Lehrer
- 4.1.1.1 Lehrer und Lehre
- 4.1.1.2 Übertragungen von der Lehre auf die Lehrer
- 4.1.2 Der Aufbau des Internats
- 4.1.1 Die Lehrer
- 4.2 Erziehungsstil
- 4.3 Sittlichkeitserziehung
- 4.3.1 Funktion der Gebärden
- 4.4 Individualerziehung und Anlage
- 4.5 Berufspädagogik
- 4.5.1 Kunsterziehung als Berufserziehung
- 4.6 Ökonomische Elementarerziehung
- 4.6.1 Schulische Elementarerziehung
- 4.7 Vorbilder
- 4.7.1 Goethe und Pestalozzi
- 4.1 Formen
- IV Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bildungs- und Erziehungskonzeption, die in Johann Wolfgang von Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und dessen Fortsetzung „Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden“ (im Folgenden: WMW) dargestellt wird. Im Fokus steht die Analyse dieser Konzeptionen im Kontext des Epochenwandels von der „Weimarer Klassik“ zum aufkommenden Maschinenzeitalter, sowie deren Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Bildungs- und Erziehungswesens.
- Die Entwicklung der Bildungs- und Erziehungsideen in Goethes Werk
- Die Rolle des Individuums in der Gesellschaft und seine Bedeutung für die Gemeinschaft
- Die Herausforderungen des Epochenwandels und die Anpassung von Bildungs- und Erziehungskonzepten
- Die Bedeutung der „Pädagogischen Provinz“ in Goethes WMW
- Die Formen und Stile der Erziehung in Goethes Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung des Textes stellt den historischen Kontext der Bildungs- und Erziehungsdiskussionen im 18. und 19. Jahrhundert dar und beleuchtet die Bedeutung von „Bildung“ als Lebenskonzept im Werk Goethes. Kapitel II untersucht die Entwicklung der Bildungs- und Erziehungskonzeption in den „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ und WMW im Kontext des Epochenwandels. Die Kapitel III analysiert die „Pädagogische Provinz“ in WMW als Modell für eine neue Form der Erziehung, die sowohl die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen als auch die Anforderungen der Gesellschaft berücksichtigt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Formen der Erziehung, der Erziehungsstil und die Rolle von Vorbildern.
Schlüsselwörter
Bildung, Erziehung, „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, „Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden“, Epochenwandel, Weimarer Klassik, „Pädagogische Provinz“, Sittlichkeitserziehung, Individualerziehung, Berufspädagogik.
- 1. Ehrfurcht
- Quote paper
- Axel Frieling (Author), 1996, Erziehung und Bildung in Goethes "Wilhelm Meisters Wanderjahre(n)", vornehmlich am Beispiel der "Pädagogischen Provinz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13808