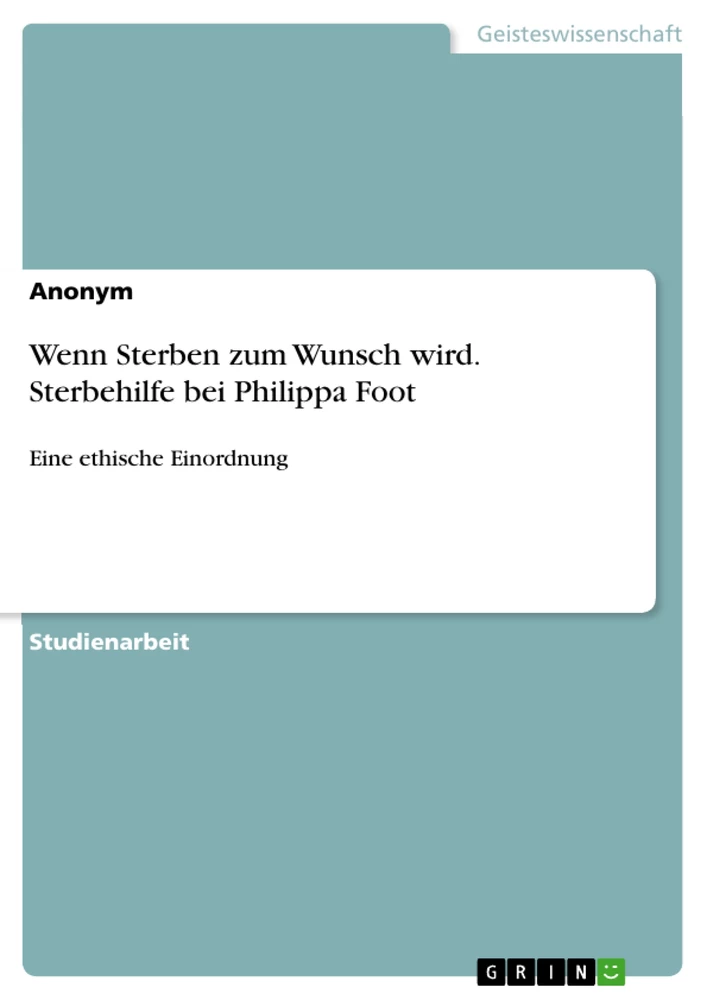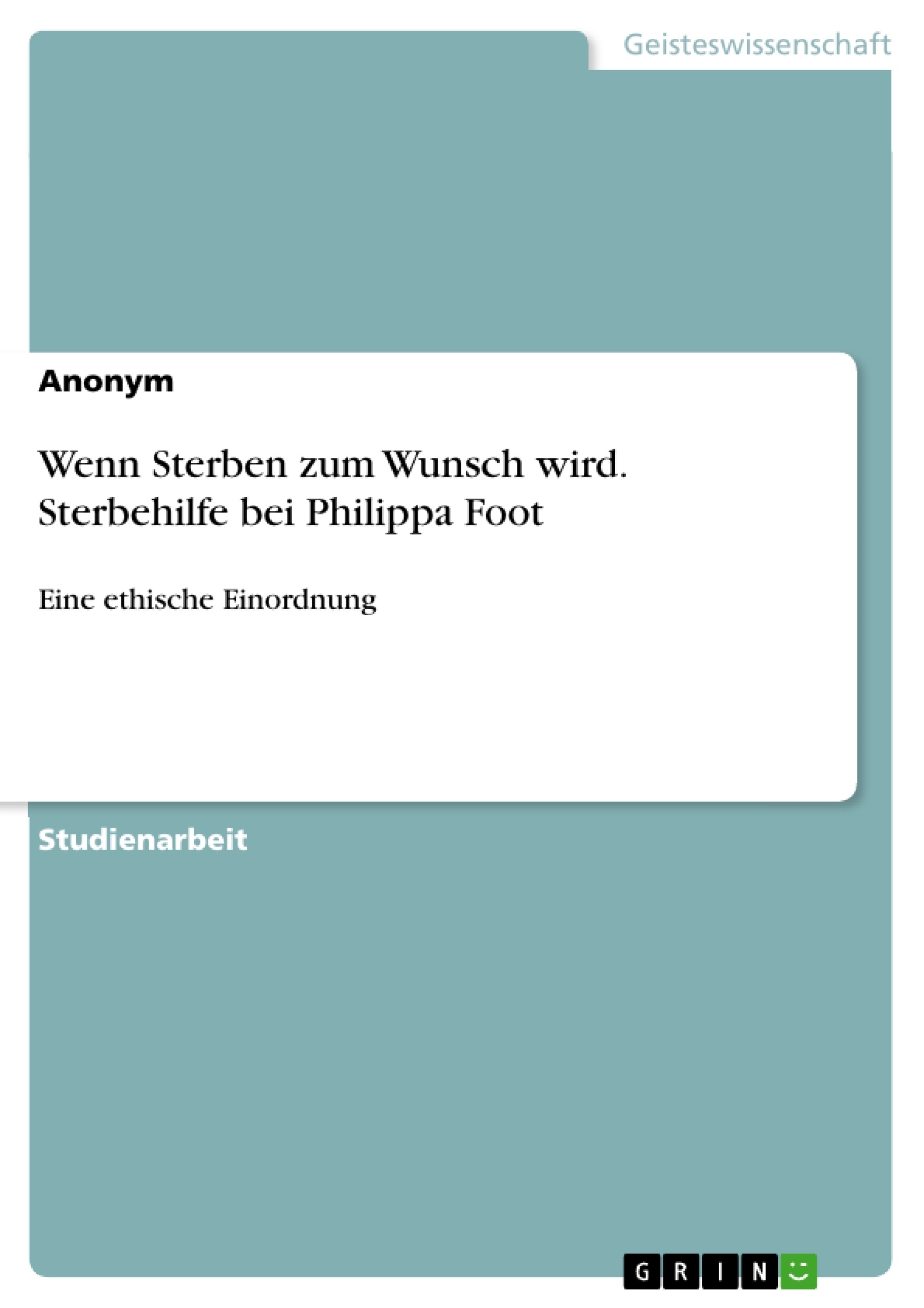„Wer hilft mir beim Sterben?“ – Die Antwort auf diese Frage hat vor allem bei unheilbar Kranken und leidenden Menschen eine wichtige und entscheidende Bedeutung. Denn was, wenn die Schmerzen und das Leid nicht mehr auszuhalten sind und ein inniger Wunsch nach dem baldigen Tod besteht?
Vor allem im Bereich des philosophischen Diskurses rund um die Sterbehilfe-Debatte zeigt sich ein weites Spektrum an Meinungen und Überzeugungen, ob die Sterbehilfe überhaupt ethisch gerechtfertigt werden kann.
In folgender Arbeit soll dieser Frage nachgegangen werden, wobei auch auf die passiv-aktiv Unterscheidung eingegangen werden soll. Im Fokus sollen dabei die Überlegungen der britischen Philosophin Philippa Foot stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sterbehilfe
- Die Unterscheidung in aktive, passive und indirekte Sterbehilfe
- Sterbehilfe und Euthanasie
- Freiwillige, nicht-freiwillige und unfreiwillige Sterbehilfe
- Rechtliche Einordnung
- Ethische Untersuchung
- Sterbehilfe bei Philippa Foot
- Sterbehilfe im Kontext von Gerechtigkeit und Nächstenliebe
- Die Grenzen des aktiven und passiven
- Sterbehilfe durch Ärzte
- Sterbehilfe- ja oder nein?
- Gesellschaftliche Folgen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der ethischen Einordnung der Sterbehilfe, insbesondere im Hinblick auf die Überlegungen der britischen Philosophin Philippa Foot. Die Arbeit analysiert verschiedene Arten der Sterbehilfe, ihre rechtliche Einordnung und die ethischen Implikationen, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeit, Nächstenliebe und dem hippokratischen Eid.
- Die Unterscheidung zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe
- Die ethische Debatte um Sterbehilfe im Kontext von Gerechtigkeit und Nächstenliebe
- Die Rolle des Arztes bei der Sterbehilfe
- Die gesellschaftlichen Folgen der Sterbehilfe
- Philippa Foot's Philosophie der Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Sterbehilfedebatte im Kontext von unheilbaren Krankheiten und dem Wunsch nach Selbstbestimmung über den eigenen Tod. Sie beleuchtet die aktuelle Situation in Deutschland, die schwierige rechtliche Situation und die kontroversen gesellschaftlichen Debatten.
- Sterbehilfe: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Sterbehilfe und unterscheidet zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe. Es befasst sich mit dem Zusammenhang von Sterbehilfe und Euthanasie sowie mit den verschiedenen Formen der Sterbehilfe (freiwillig, nicht-freiwillig, unfreiwillig) und der rechtlichen Einordnung.
- Ethische Untersuchung: Dieser Abschnitt beleuchtet die ethischen Aspekte der Sterbehilfe. Er analysiert Philippa Foot's Überlegungen zur Sterbehilfe und diskutiert die ethischen Implikationen im Kontext von Gerechtigkeit und Nächstenliebe.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Euthanasie, Philippa Foot, Ethik, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Recht, Gesellschaft, Selbstbestimmung, Tod, Suizid, Arzt, Krankheit, Leid, Hippokratischer Eid.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Wenn Sterben zum Wunsch wird. Sterbehilfe bei Philippa Foot, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1380741