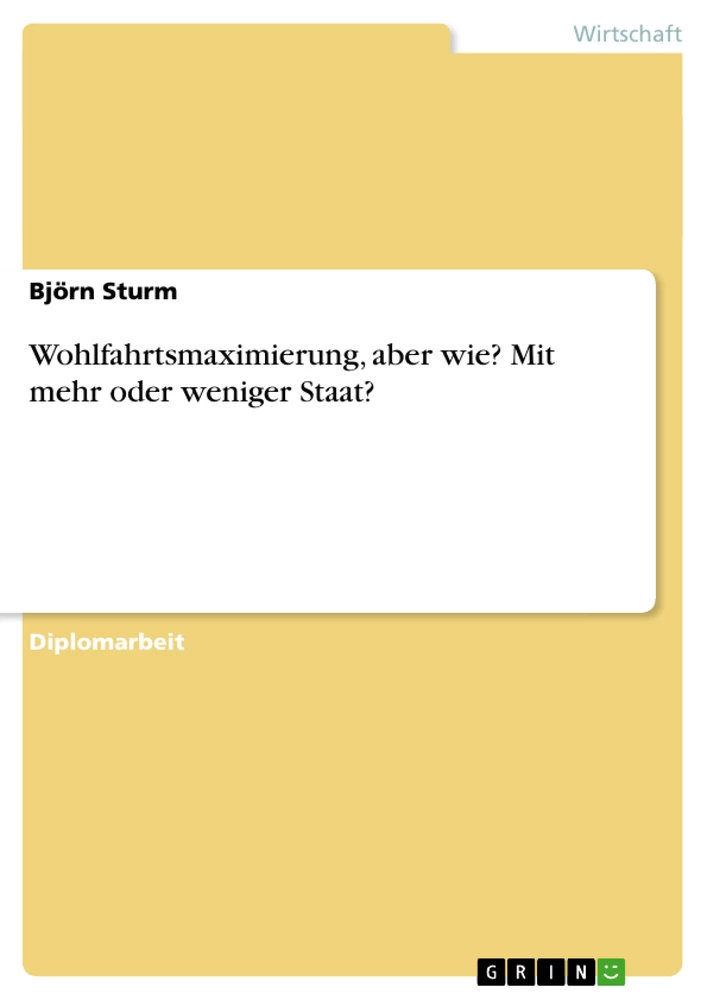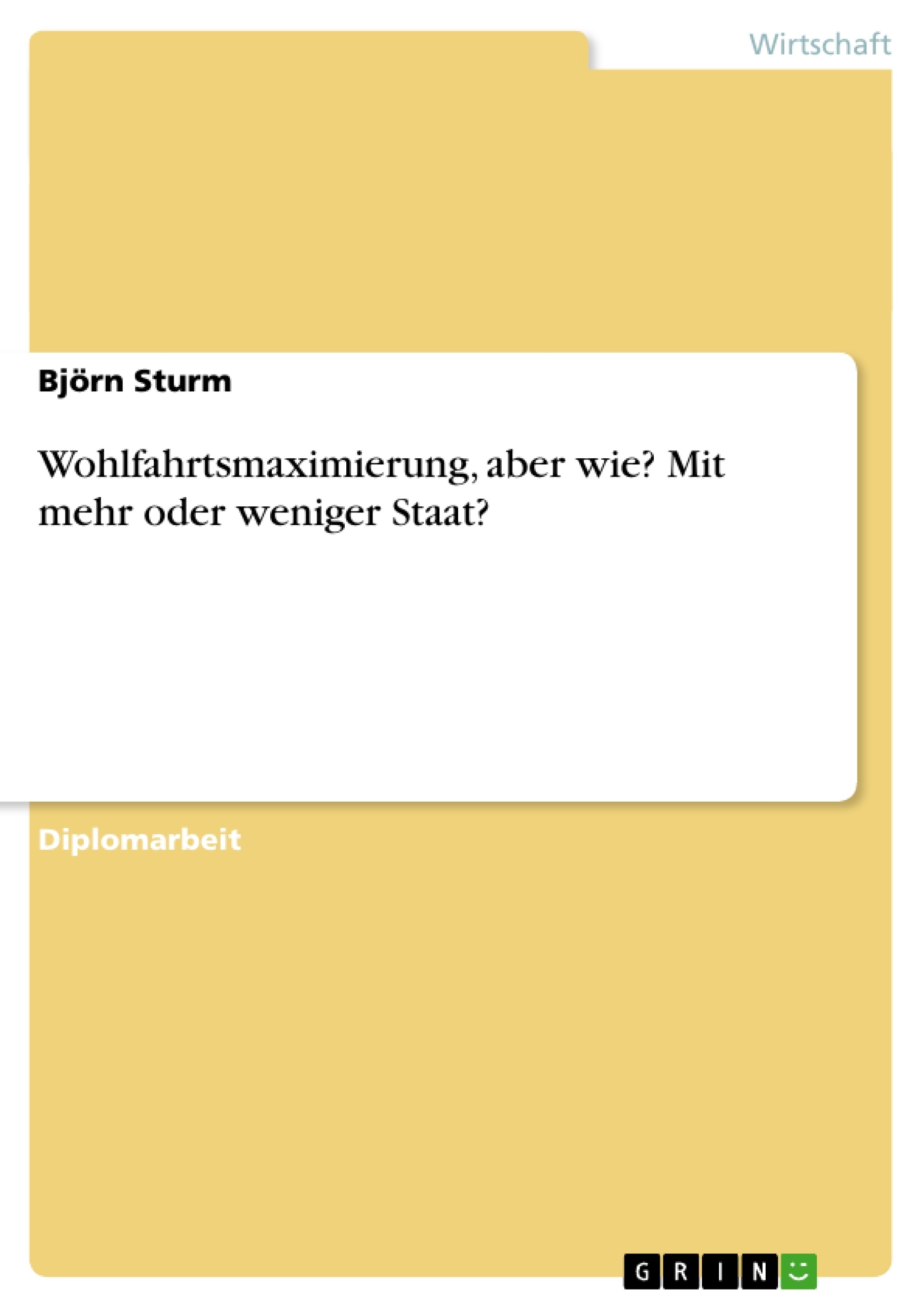Diese Arbeit hat zum Ziel insbesondere auf mögliche Formen gravierenden Marktversagens einzugehen. Im Zuge dessen werden die jeweils geltenden Annahmen hervorgehoben und die daraus folgenden volkswirtschaftlichen Resultate vor dem Hintergrund der Wohlfahrt zusammengefasst. Durch eine Vielzahl von Beispielen wird ferner das Gefahrenpotential, das von Marktversagen ausgeht, praxisorientiert aufgezeigt. Die vorliegende Arbeit befasst sich zudem mit den staatlichen Koordinationsmechanismen, die die Unterbindung respektive Heilung von Marktversagen anstreben. Sie sucht jedoch zugleich nach Hinweisen, wo kontraproduktive Leistungen des Staatsapparats aus einem Marktversagen noch weitaus schlimmere Staats- oder Politikversagen generieren. Diese Arbeit richtet sich sowohl an Theoretiker als auch an Menschen mit praktischer Orientierung, die gleichermaßen einen Einstieg in die Materie suchen.
Die Hauptfragen, die diese Arbeit zu antworten versucht sind: Welche Marktversagen verursachen volkswirtschaftliche Wohlfahrtsverluste? Was unternimmt der Staat explizit gegen wohlfahrtsmindernde Marktversagen? Verfügen Staat und Politik über heilende Hände bei der Behebung von Marktversagen oder gibt es Grenzen, die auch durch staatliche Aktivitäten nicht durchbrochen werden können? Warum wirken sich staatliche Fehlleistungen bei der Bekämpfung von Marktversagen wohlfahrtsmindernd aus? Besteht die Möglichkeit, dass sich Markt und Staat sogar selbst im Weg stehen können? Falls ja, welche Lösung ist dann aus volkswirtschaftlicher Sicht überhaupt anzustreben?
Inhalt
Danksagungen
Abbildungsverzeichnis
1. Executive Summary
2. Der Markt
2.1 Einleitung
2.2 Nachfragebildung
2.2 Angebotsbildung
2.3 Gleichgewichtsmarkt
3. Idealtypische Marktkonstellation
3.1 Polypol bei vollkommener Konkurrenz
3.2 Annahmen
3.3 Resultate
3.4 Praktische Relevanz
4. Gravierende Ausprägungen des Marktversagens
4.1 Externe Kosten
4.1.1 Annahmen
4.1.2 Resultate
4.1.3 Praktische Relevanz
4.2 Adverse Auslese
4.2.1 Annahmen
4.2.2 Resultate
4.2.3 Praktische Relevanz
4.3 Natürliches Monopol
4.3.1 Annahmen
4.3.2 Resultate
4.3.3 Praktische Relevanz Wohlfahrtsmaximierung, aber wie? Mit mehr oder weniger Staat?
4.4 Öffentliche Güter
4.4.1 Annahmen
4.4.2 Resultate
4.4.3 Praktische Relevanz
5. Weiterführende Fälle
5.1 Monopson
5.1.1 Annahmen
5.1.2 Resultate
5.1.3 Praktische Relevanz
5.2 Bilaterales Monopol
5.2.1 Annahmen
5.2.2 Resultate
5.2.3 Praktische Relevanz
6. Der Staat als helfende Hand?
6.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Selbststeuerung
6.1.1 Reallokationspolitik
6.1.2 Redistributionspolitik
6.1.3 Stabilitätspolitik
6.2 Staatsversagen
6.3 Politikversagen
6.3.1 Probleme antizyklischer Konjunkturpolitik
6.3.2 Zunehmende Staatsverschuldung
7. Fazit: Markt oder Staat?
Literaturverzeichnis
Danksagungen
Ich danke dem Freistaat Bayern und den Bibliotheken in Bayern, insbesondere der Fach- hochschulbibliothek Coburg, die mir die schnelle, unkomplizierte sowie kostenfreie Nutzung der Fernleihe ermöglicht haben.
Ich danke dem Freistaat Bayern und der Hochschule für mein Studium in Coburg und allen die mir das Studium in Coburg und seinen Abschluss ermöglicht haben.
Ich danke ganz besonders meiner Mutter und meinem leider verstorbenen Vater, die mich jederzeit aufopfernd unterstützt und an mich geglaubt haben.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Nachfragekurve
Abbildung 2: Ertragsverlauf
Abbildung 3: Kostenverlauf
Abbildung 4: Angebotskurve
Abbildung 5: Marktgleichgewicht
Abbildung 6: Vollkommene Konkurrenz
Abbildung 7: Wohlfahrtsberechnung
Abbildung 8: Berücksichtigung externer Kosten
Abbildung 9: Externe Kosten
Abbildung 10: Wohlfahrtsverlust bei externen Kosten
Abbildung 11: Adverse Auslese
Abbildung 12: Angebotsmonopol
Abbildung 13: Optimierungsregel Monopol
Abbildung 14: Fixkostendominanz
Abbildung 15: Polypol versus Angebotsmonopol
Abbildung 16: Wohlfahrtsverlust bei Angebotsmonopol
Abbildung 17: Optimierungsregel Monopson
Abbildung 18: Monopson
Abbildung 19: Wohlfahrtsverlust bei Monopson
Abbildung 20: Bilaterales Monopol
Abbildung 21: Pigou-Steuer
Abbildung 22: Öffentliches Monopol
Abbildung 23: Mindest- und Höchstpreise
Abbildung 24: Mindestpreise auf dem EU-Agrarmarkt
Abbildung 25: Preisindex des BSP
Abbildung 26: Verbraucherindex April 2009
Abbildung 27: Verbraucherindex 2008
Abbildung 28: Originäre Phillips-Kurve
Abbildung 29: Abgeleitete Phillips-Kurve
Abbildung 30: Monetaristische Phillips-Kurve
Abbildung 31: Idealtypischer Konjunkturverlauf
Abbildung 32: Crowding-Out
1. Executive Summary
Wir leben in einer Volkswirtschaft, d. h. inmitten vielfältiger Einrichtungen und Verfahren, mit denen eine Gesellschaft Güter zur Bedürfnisbefriedigung produziert und letztlich verteilt. Gleichzeitig leben wir jedoch auch in einer Marktwirtschaft, einem Wirtschaftssystem, bei dem Märkte die Vielzahl der individuellen Pläne und Entscheidungen der einzelnen Haushalte und Unternehmen koordinieren. Dabei implizieren Märkte das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. In diesem Kontext wird der Marktmechanismus durch Angebot, Nachfrage und Preis gesteuert. Der Marktmechanismus ist jedoch keine Garantie für vollendende Funktionalität auf den Märkten. Fehlleistungen können die bestmögliche Verwendung der knappen Ressourcen verhindern und Wohlfahrtsverluste innerhalb von Volkswirtschaften herbeiführen. Die Rede ist von Märkten, die in speziellen Fällen mangelhaft sind oder schlichtweg versagen. Doch überall dort, wo Marktversagen volkswirtschaftliche Wohlfahrts- verluste herbeiführen, versuchen andere Koordinationsmechanismen dieses Unheil zu be- kämpfen. Die Rede ist von staatlichen Organisationen, die als Vertreter des Gemeinwohls aktiv in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Doch auch staatliche Aktivitäten zur Behebung von Marktversagen sind nicht davor gefeit, das angestrebte Ziel letztlich zu verfehlen. Denn auch der Staatsapparat funktioniert nicht immer perfekt, so dass Fehlleistungen staatlicher Organisationen aus einem Marktversagen sehr wohl ein weitaus schlimmeres Staatsversagen herbeiführen können.
Diese Arbeit hat daher zum Ziel insbesondere auf mögliche Formen gravierenden Marktver- sagens einzugehen. Im Zuge dessen werden die jeweils geltenden Annahmen hervorgehoben und die daraus folgenden volkswirtschaftlichen Resultate vor dem Hintergrund der Wohlfahrt zusammengefasst. Durch eine Vielzahl von Beispielen wird ferner das Gefahrenpotential, das von Marktversagen ausgeht, praxisorientiert aufgezeigt. Die vorliegende Arbeit befasst sich zudem mit den staatlichen Koordinationsmechanismen, die die Unterbindung respektive Hei- lung von Marktversagen anstreben. Sie sucht jedoch zugleich nach Hinweisen, wo kontrapro- duktive Leistungen des Staatsapparats aus einem Marktversagen noch weitaus schlimmere Staats- oder Politikversagen generieren. Diese Arbeit richtet sich sowohl an Theoretiker als auch an Menschen mit praktischer Orientierung, die gleichermaßen einen Einstieg in die Ma- terie suchen.
Die Hauptfragen, die diese Arbeit zu antworten versucht sind: Welche Marktversagen verur- sachen volkswirtschaftliche Wohlfahrtsverluste? Was unternimmt der Staat explizit gegen wohlfahrtsmindernde Marktversagen? Verfügen Staat und Politik über heilende Hände bei der Behebung von Marktversagen oder gibt es Grenzen, die auch durch staatliche Aktivitäten nicht durchbrochen werden können? Warum wirken sich staatliche Fehlleistungen bei der Bekämpfung von Marktversagen wohlfahrtsmindernd aus? Besteht die Möglichkeit, dass sich Markt und Staat sogar selbst im Weg stehen können? Falls ja, welche Lösung ist dann aus volkswirtschaftlicher Sicht überhaupt anzustreben?
2. Der Markt
2.1 Einleitung
Aus volkswirtschaftlicher Sicht wird unter dem Begriff Markt der ökonomische Ort ver- standen, an dem Angebot und Nachfrage zusammentreffen. Doch bevor wir uns den markt- wirtschaftlichen Mechanismen widmen, sollten zunächst wichtige volkswirtschaftliche Be- griffe, die fester Bestandteil dieser Arbeit sind, erläutert werden. Demnach entsprechen Güter und Produktionsfaktoren spezifischen Wirtschaftsobjekten des wirtschaftlichen Handelns. In Anbetracht stetiger Güterknappheit werden grundsätzlich knappe und freie Güter unter- schieden. Diese Güterknappheit resultiert aus den begrenzten Ressourcen Boden, Arbeit und Kapital sowie eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten. Freie Güter (z.B. Luft) sind frei erhältlich und kein Bestandteil wirtschaftlichen Handelns. Knappe Güter unterteilen sich in Konsum-, Investitions- und Sachgüter, Dienstleistungen, Individual-, Kollektivgüter sowie meritorische und demeritorische Güter.1 Wirtschaftssubjekte sind Haushalte, Unternehmen, Staat und Ausland, die wirtschaftliche Transaktionen ausführen und folglich Elemente des Wirtschaftsprozesses sind. Haushalte kaufen bzw. fragen auf der einen Seite Güter nach und offerieren andererseits Produktionsfaktoren. Unter Produktionsfaktoren sind alle Mittel zu verstehen, die an der Erstellung von Gütern beteiligt sind. Unternehmen hingegen produzieren Güter, bieten diese an und verkaufen sie schließlich. Zudem werden Produktionsfaktoren nachgefragt und gekauft. Der Güter- bzw. Faktorpreis gilt hierbei als Koordinationsinstru- ment. Dieser Preis sorgt dafür, dass sich angebotene und nachgefragte Menge entsprechen. Aufgrund von Eigeninteresse versuchen Haushalte und Unternehmen ihre festgesetzten Planungen auf Güter- und Faktormärkten durchzusetzen.2 Durch mathematisch formulierte Modelle soll nunmehr die Gesetzmäßigkeit von Nachfrage und Angebot sachgerecht unter- sucht werden.
2.2 3achfragebildung
Das Nachfrageverhalten ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft: Im Fall einer Preis- steigerung ergibt sich ein Substitutionseffekt. Die Nachfrager werden versuchen, das über- teuerte Gut zu substituieren, respektive durch ein anderes zu ersetzen. Demgemäß ergibt sich z. B. bei einer Erhöhung der Butterpreisen eine Erhöhung der Margarinenachfrage. Je mehr die Nachfrager ein bestimmtes Gut konsumieren, desto weniger schätzen sie jedoch jede zu- sätzliche Einheit. Hierbei sprechen wir vom ersten Gossen’schen Gesetz - das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Oder auf andere Weise ausgedrückt: „Der Nutzenzuwachs von 3 auf 4 Bier ist geringer als der Nutzenzugewinn von 2 auf 3 Bier.“3 Das Tauschverhalten von Gütereinheiten wird immer über den Preis angegeben. Da die Nachfrager versuchen, den Grenznutzen pro Geldeinheit zu maximieren, gilt: „Solange pro aufgewendeter Geldeinheit der Grenznutzen einer Einheit eines Gutes höher ist als der eines anderen, erhöht er den Grenznutzen durch Umschichtung der Nachfrage von einem Gut auf ein anderes.“4 Das Optimum ist schließlich erreicht, wenn der Grenznutzen pro Geldeinheit in allen Ver- wendungsrichtungen gleich groß ist. Hierbei sprechen wir vom zweiten Gossen‘schen Gesetz - das Gesetz vom Ausgleich der Grenznutzen.5
Die dargestellte Nachfragefunktion (Abbildung 1) gibt Auskunft darüber, welche Mengen die Nachfrager zu unterschiedlichen Preisen zu kaufen bereit sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 3achfragekurve
(eigene Darstellung in Anlehnung an Bartling/Luzius, 2008, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, S. 56)
Die Menge x (Abszisse) sowie der Preis p (Ordinate) symbolisieren zusammen ein einziges Gut, das von allen Haushalten zusammen in einer Periode nachfragt wird. Dabei besteht Kausalität zwischen Preis p (Ursache) und Menge x (Wirkung). Folglich entspricht p der unabhängigen Variable und x der abhängigen Variable. Aufgrund des kausalen Zusammen- hangs hat ein hoher Preis pA eine niedrigere Nachfragemenge xA zur Folge. Umgekehrt be- deutet ein niedriger Preis pB gleichzeitig eine höhere Nachfragemenge xB. Die Gesamtnach- frage ergibt sich schließlich aus der Aggregation aller geplanten Konsummengen der Nach- frager.
2.3 Angebotsbildung
Auch bei Bildung des Angebots besteht Kausalität zwischen Preis und angebotener Menge.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Ertragsverlauf
(eigene Darstellung in Anlehnung an Eisenhut, 2008, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, S. 35)
Die zentrale Frage, die sich Produzenten stellen, lautet: Inwieweit verändert sich das Angebot, wenn sich der Preis eines Gutes verändert? In diesem Zuge nimmt das Ertragsgesetz eine signifikante Rolle ein. „Wird der Einsatz eines Produktionsfaktors bei Konstanz der Menge der übrigen Faktoren erhöht, so nimmt der Output (Ertrag) zunächst mit steigenden, dann mit fallenden Grenzerträgen zu, bis schliesslich der Output sinkt, der Grenzertrag also negativ wird.“6 Aus dem dargestellten Ertragsverlauf (Abbildung 2) lassen sich sodann die Kosten (fixe und variable Kosten) ableiten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Kostenverlauf
(eigene Darstellung in Anlehnung an Eisenhut, 2008, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, S. 35)
Während Fixkosten unabhängig von der Produktionsmenge sind, hängen variable Kosten un- mittelbar von der Höhe der zu produzierenden Gütermenge ab. Die Totalkosten werden zunehmend kleiner, solange im Intervall der steigenden Grenzerträge produziert wird. Je flacher die Totalkostenfunktion ausfällt, desto geringer werden die zusätzlichen Kosten je Produktionseinheit. Bei Preissteigerungen wird die Produktion so lange ausgedehnt, bis die Grenzkosten mit dem höheren Marktpreis wieder konform gehen. Bei Preissenkungen wird die Produktion stattdessen so lange heruntergefahren, bis sich Preis und Grenzkosten ent- sprechen. Die Angebotsfunktion ergibt sich schließlich aus dem steigenden Ast der Grenz- kostenfunktion.7
Wie bereits bei der Nachfragebildung erfolgt auch die Angebotsbildung in einem Diagramm bestehend aus Preis p und Menge x. In diesem Fall konzentrieren wir uns jedoch auf die Menge, die von allen Unternehmen zusammen in einer Periode angeboten wird. Hierbei be- steht abermals Kausalität zwischen Preis p (Ursache) und Menge x (Wirkung). Somit gehen Preisänderungen einher mit Mengenänderungen, die wie folgt dargestellt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 Angebotskurve
(eigene Darstellung in Anlehnung an Bartling/Luzius, 2008, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, S. 57)
Bei einem hohen Preis pC ist die Gesamtheit aller Unternehmen bereit, eine höhere Menge xC am Markt anzubieten. Dementgegen wird bei einem geringeren Preis pD eine deutlich geringere Menge xD offeriert. Die Summe aller geplanten Produktionsmengen kennzeichnet letztlich das Gesamtangebot.
2.4 Gleichgewichtsmarkt
Um die Wirkungszusammenhänge von Nachfrage und Angebot darzulegen, bedarf es der Zu- sammenlegung von Angebot und Nachfrage in einem weiteren Preis-Mengen-Diagramm (Abbildung 5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 Marktgleichgewicht
(eigene Darstellung in Anlehnung an Frank, 2009, Vorlesungsunterlagen, www.fh-coburg.de/X_drive)
Da Nachfrage und Angebot vom Preis des Gutes abhängig sind, kommt es zu einem Inter- dependenzproblem. Generell sind Unternehmen an der Durchsetzung hoher Preise, hingegen Haushalte an niedrigen Preisen interessiert. Wie bereits dargelegt, bieten Unternehmen bei hohen Preisen zugleich höhere Mengen an. In diesem Fall fragen die Haushalte jedoch nur wenig bis gar nichts auf dem Gütermarkt nach.8 Daraus resultiert ein Überangebot der Produktionsmenge (Angebotsüberhang), das durch Preisreduktion der Unternehmen ver- ringert werden kann. Senken die Unternehmen den Preis jedoch zu stark, führt dies zu einer Übernachfrage der Haushalte (Nachfrageüberhang). Im Marktgleichgewicht, bestehend aus Gleichgewichtspreis pG und Gleichgewichtsmenge xG, treten die soeben genannten Markt- ungleichgewichte allerdings nicht auf. „Der marktwirtschaftliche Preismechanismus lenkt die Produktionsfaktoren in die beste Verwendung (effiziente Allokation), sorgt für eine marktge- rechte Güter- und Einkommensverteilung (Distribution), und koordiniert die Märkte, d. h. sorgt für einen marktgerechten Interessenausgleich zwischen Nachfragern und Anbietern.“9 Durch das Zusammenspiel der Marktkräfte kommt es zur freien Bildung der Marktpreise, bei gleichzeitig größter Menge, die auf dem Markt umgesetzt werden kann.
3. Idealtypische Marktkonstellation
3.1 Polypol bei vollkommener Konkurrenz
Als idealtypische Marktkonstellation kristallisiert sich das Polypol bei vollkommener Konkurrenz10 (Abbildung 6) heraus. Im Polypol steht eine Vielzahl an Nachfragern einer Vielzahl an Anbietern gegenüber.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 Vollkomme Konkurrenz
(eigene Darstellung in Anlehnung an Frank, 2009, Vorlesungsunterlagen, www.fh-coburg.de/X_drive)
Wie bereits unter 1.4 Gleichgewichtsmarkt gezeigt, kommt es zu keinen Marktungereimt- heiten in Form von Angebots- oder Nachfrageüberhängen. Die Wirtschaftspläne von Anbie- tern und Nachfragern sind vereinbar, denn keiner der Marktteilnehmer fühlt sich veranlasst, die eingeschlagenen Wirtschaftspläne zu korrigieren.11 Die Marktteilnehmer verfügen im Polypol jedoch über keine bedeutsame Marktmacht. Unter Marktmacht sind Marktteilnehmer zu verstehen, die dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum, Preise oder andere Be- dingungen festlegen können. Unter diesen Festlegungen finden indes Markttransaktionen statt, die zum relativen Nachteil anderer oder zum eigenen relativen Vorteil geltend gemacht werden können. Die Summe von Marktangebot und -nachfrage ergibt sich schließlich aus der Aggregation der geplanten Produktionsmengen auf Anbieterseite sowie Konsummengen auf Nachfragerseite.
3.2 Annahmen
Während auf oligopolistischen und monopolistischen Märkten Wohlfahrtverluste entstehen, wird im Polypol bei vollkommener Konkurrenz das wirtschaftspolitische Oberziel Wohl- fahrtsmaximierung erreicht.12 Dieses Ziel ist jedoch nur unter spezifischen Annahmen reali- sierbar. Demnach bedarf es einem zweiseitigen Polypol, in dem viele Nachfrager auf viele Anbieter treffen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang vom vollkommenen Wettbewerb. Des Weiteren werden ausschließlich homogene Güter gehandelt, d. h. die Käufer erachten die Güterarten als identisch. Bei Homogenität der Güter bestehen keine Unterschiede hinsichtlich Zeit, Raum, Güterqualität und Präferenzstruktur der Käufer. Ferner müsste das Kriterium der vollständigen Markttransparenz erfüllt sein. Die Anbieter und Nachfrager sind demnach über alle marktrelevanten Fakten informiert. Diese Voraussetzung beinhaltet sämtliche Informatio- nen zu Preisen, Mengen, aber auch Produktions- und Kostenstrukturen.13 Als weitere Voraus- setzung ist die umfassende Vertragsfreiheit anzusehen, die jedem Einzelnen allgemeine Hand- lungsfreiheiten ermöglicht. Für Anbieter gelten ferner keine Mobilitätseinschränkungen, so dass freier Marktzutritt sowie -austritt jederzeit möglich sind. Potentielle Marktversagen durch die Bildung natürlicher Monopole oder externer Kosten sind infolgedessen kategorisch ausgeschlossen. Schließlich verhalten sich sämtliche Marktteilnehmer jederzeit rational. Aus einer Auswahl an Handlungsoptionen wird folglich diejenige ausgewählt, die zum höchsten Zielerreichungsgrad führt, respektive den Präferenzwert maximiert.
3.3 Resultate
Im Polypol bei vollkommener Konkurrenz verhalten sich Anbieter und Nachfrager gleicher- maßen als Mengenanpasser, da aufgrund fehlender Marktmacht keiner der Marktteilnehmer tatsächlich Einfluss auf die Preisbildung hat. Ferner führt der fehlende Leistungswettbewerb kaum zur „Realisierung wachstumsfördernden technischen Fortschritts“14. Die Folge: Schlaf- mützenkonkurrenz15 mit innovationslosen Märkten. Im Marktgleichwicht - bestimmt durch xG und pG - wird die Summe der Konsumenten- und Produzentenrenten (Abbildung 7) maxi- miert. Die Konsumentenrente entspricht der Ausgabenersparnis der Konsumenten, die zu höheren Preisen als dem Gleichgewichtspreis gekauft hätten. Unter Produzentenrente wird hingegen der Mehrerlös der Produzenten verstanden, die zu niedrigeren Preisen als dem Gleichgewichtspreis angeboten hätten.
Bei der Berechnung der Wohlfahrt (W) gelten folgende Prinzipien:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7 Wohlfahrtsberechnung
(eigene Darstellung in Anlehnung an Frank, 2009, Vorlesungsunterlagen, www.fh-coburg.de/X_drive)
Aus den Marktergebnissen lässt sich ableiten, dass vollkommene Konkurrenz sowohl statische Allokationseffizienz als auch Wohlfahrtsmaximierung gewährleistet. Bei z. B. staat- licher Preisfixierung wäre der effizienzsichernde Preismechanismus jedoch außer Kraft ge- setzt.16 Hierbei können einerseits höhere Mindestpreise (oberhalb des Marktgleichgewichts) oder andererseits niedrigere Höchstpreise (unterhalb des Marktgleichgewichts) festgesetzt werden.
3.4 Praktische Relevanz
Doch sind Marktgleichgewichte, wie sie bei vollkommener Konkurrenz suggeriert werden, tatsächlich realistisch? „In der Realität werden Marktgleichgewichte selten erreicht, und, wenn einmal, dann meist nur für kurze Dauer.“17 Zwar entwickeln sich Märkte generell in Richtung des Gleichgewichts, aufgrund teils wirklichkeitsferner Modellannahmen ist diese Marktform jedoch kritisch zu hinterfragen. Angenommen alle erhältlichen Güter unterliegen einer strengen Gleichartigkeit, ist Wettbewerb durch Produktdifferenzierung schlichtweg un- denkbar. Heterogene Produkte18 fördern hingegen den Wettbewerb und geben allen Unter- nehmen die Möglichkeit, sich bewusst auf dem Markt zu positionieren. Ebenfalls präsentiert sich die Voraussetzung der völligen Marktransparenz nicht wirklichkeitskonform. Statt völ- liger Informationstransparenz, stehen Informationsasymmetrien zwischen den Marktteilneh- mern an der Tagesordnung. Die gestellten Annahmen sind auf den Märkten somit schlicht und ergreifend nicht zu realisieren und disqualifizieren das Polypol bei vollkommener Konkurrenz als wettbewerbspolitisches Leitbild. In speziellen Ausnahmefällen kommt es sogar zu gravie- renden Ausprägungen von Marktversagen, auf die im weiteren Verlauf dieser Arbeit einge- gangen werden soll.
4. Gravierende Ausprägungen des Marktversagens
4.1 Externe Kosten
Im Zuge von Produktion und Konsum entstehen z. B. umweltbedeutsame Emissionen, die „letztlich Schadenswirkungen bei Menschen, Tieren, Pflanzen, unbelebter Natur oder Kulturgütern hervorrufen“19 können. Führen wir uns diese Problematik anhand eines Beispiel vor Augen: Steigt der Einsatz fossiler Brennstoffe, steigt umso stärker der Kohlendioxydgehalt der Atmosphäre. Weltweit betrachtet führt dieser Umstand zur Klimaerwärmung und Polschmelze sowie Erhöhung der Ozeane. Der Treibhauseffekt tangiert als negativer externer Effekt nicht den Einzelnen sondern die gesamte Menschheit.
4.1.1 Annahmen
Idealtypisch sind externe Kosten K'extern wie folgt einzubeziehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8 Berücksichtigung externer Kosten
(eigene Darstellung in Anlehnung an Frank, 2009, Vorlesungsunterlagen, www.fh-coburg.de/X_drive)
Unter Einbeziehung externer Kosten (Abbildung 9) ergeben sich höhere Preise pV bei ge- ringerer Nachfrage xV. Die Problematik, die von externen Kosten ausgeht, beruht auf der Tat- sache, „dass die volkswirtschaftlichen Kosten (z. B. für die Abfallbeseitigung) bei Produktion und Konsum mancher Güter nicht vollständig in die privaten Kosten- und Ertragsrechnungen eingehen.“20
[...]
1 Vgl. Frank, W.; [Volkswirtschaftslehre - Grundlagen, 2008]; S. 12
2 Vgl. Bartling, H./Luzius, F.; [Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, 2008]; S. 55ff.
3 Frank, W.; [Volkswirtschaftslehre - Grundlagen, 2008]; S. 47
4 Eisenhut, P.; [Aktuelle Volkswirtschaftslehre 2006/2007, 2006]; S. 32
5 Vgl. Eisenhut, P.; [Aktuelle Volkswirtschaftslehre 2006/2007, 2006]; S. 32
6 Eisenhut, P.; [Aktuelle Volkswirtschaftslehre 2006/2007, 2006]; S. 34
7 Eisenhut, P.; [Aktuelle Volkswirtschaftslehre 2006/2007, 2006]; S. 35f.
8 Vgl. Frank, W.; [Volkswirtschaftslehre - Grundlagen, 2008]; S. 43
9 Frank, W.; [Volkswirtschaftslehre - Grundlagen, 2008]; S. 24
10 Der Begriff Polypol steht für polloi (viele) bzw. polein (verkaufen).
11 Vgl. Bartling, H./Luzius, F.; [Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, 2008]; S. 59
12 Vgl. Frank, W.; [Volkswirtschaftslehre - Grundlagen, 2008]; S. 75
13 Vgl. Hildmann, G.; [Mikroökonomie, 2005]; S. 120
14 Frank, W.; [Volkswirtschaftslehre - Grundlagen, 2008]; S. 76
15 Sofern Unternehmen keinen Anreiz auf die Durchführung von Innovationen oder Veränderungen haben, wird diese Wettbewerbssituation als Schlafmützenkonkurrenz bezeichnet.
16 Daraus resultierende Effizienz- und Verteilungswirkungen werden unter Punkt 5.1.1 Reallokationspolitik am Beispiel des EU-Agrarmarkts genauer erläutert.
17 Bartling, H./Luzius, F.; [Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirt- schaftspolitik, 2008]; S. 60
18 Heterogenität steht in diesem Zusammenhang für Produkte, die sich in Form, Farbe oder Verpackung differen- zieren.
19 Bartling, H./Luzius, F.; [Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, 2008]; S. 133
20 Bartling, H./Luzius, F.; [Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, 2008]; S. 135
- Citar trabajo
- Björn Sturm (Autor), 2009, Wohlfahrtsmaximierung, aber wie? Mit mehr oder weniger Staat?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138057