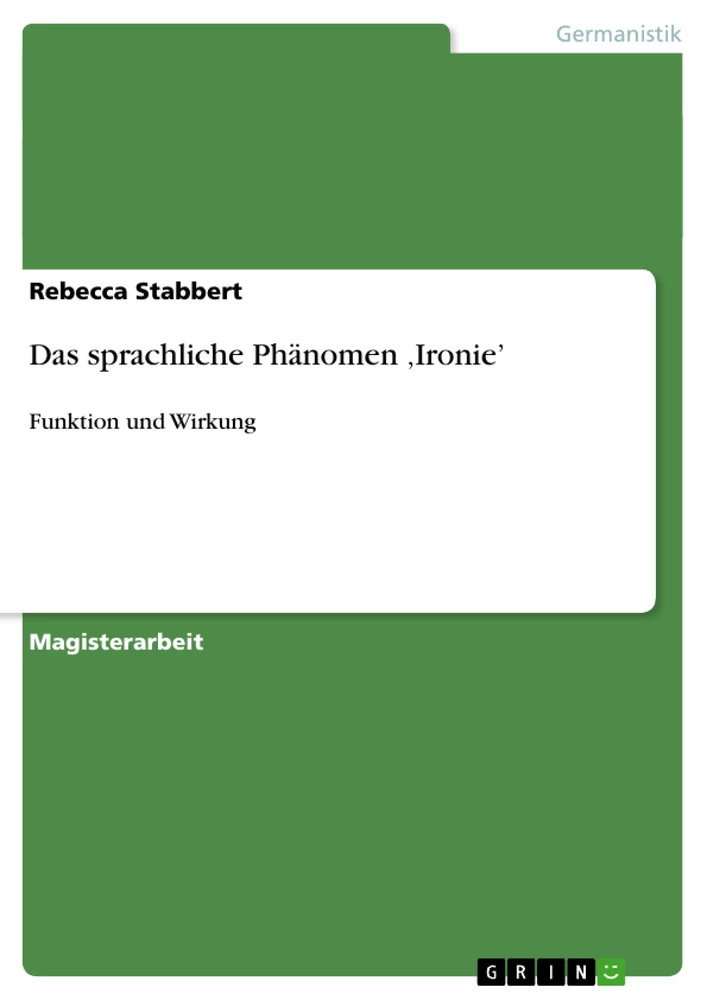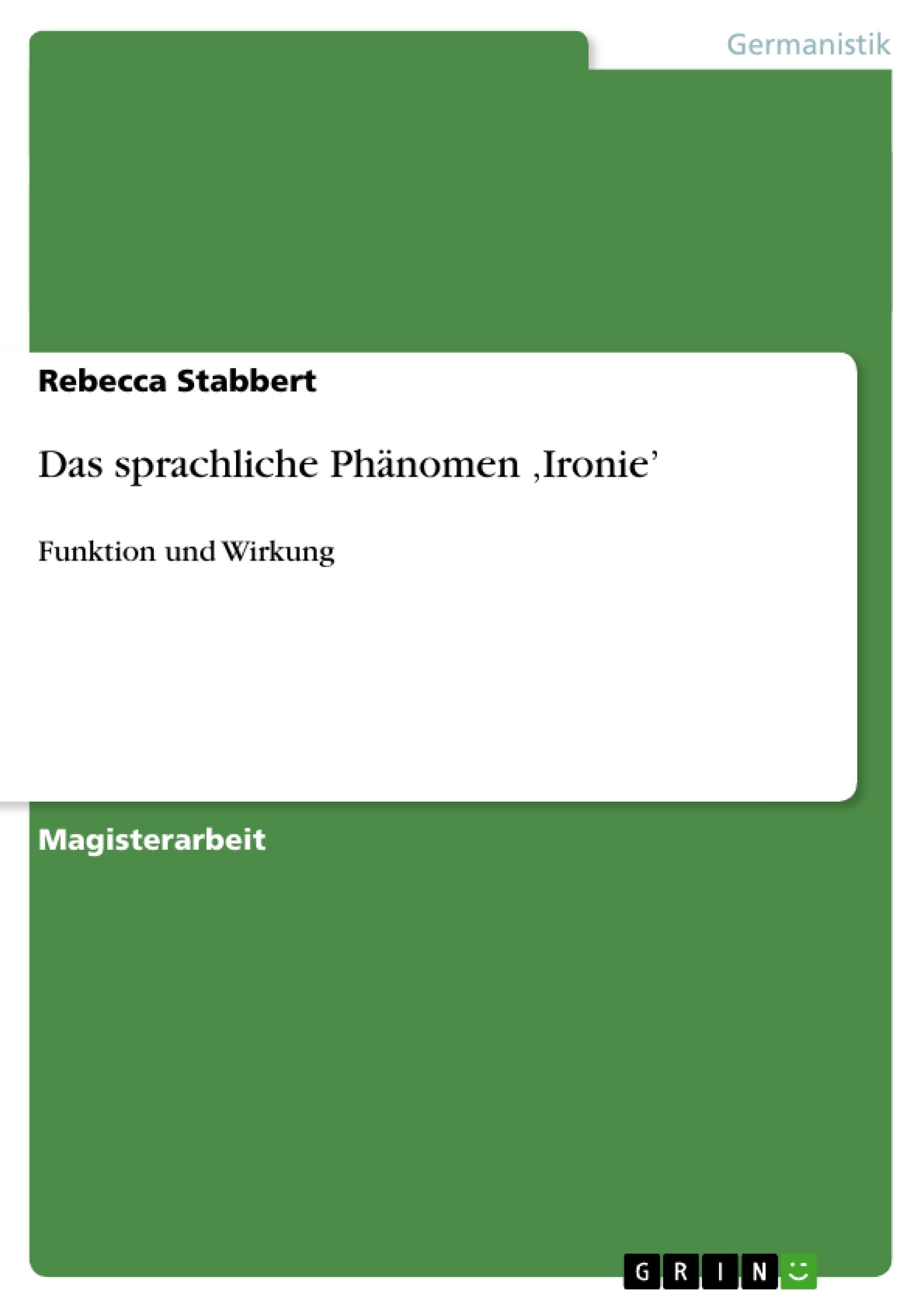„Dann solltest du auch sagen, was du meinst“, fuhr der Schnapphase fort. „Das tue ich ja“, widersprach Alice rasch; „wenigstens – wenigstens meine ich, was ich sage – und das kommt ja wohl aufs gleiche heraus.“ „Ganz und gar nicht“, sagte der Hutmacher. „Mit dem selben Recht könntest du ja sagen: ‚Ich sehe, was ich esse’ ist das gleiche wie ‚Ich esse, was ich sehe’!“
Lewis Carroll, Alice im Wunderland (zitiert nach Lapp 1997²: 11)
Die Kommunikation zwischen Menschen dient nicht nur ausschließlich dazu Informationen auszutauschen, sondern darüber hinaus Meinungen und Ansichten zu vermitteln. Die Übermittlung kann zum einen auf direktem Weg über die wörtliche Formulierung vollzogen werden oder auf indirektem Weg, indem der Sprecher neben der wörtlichen Bedeutung eine zusätzliche transportiert. Diese Eigenschaft beinhaltet unter anderem das Phänomen der Ironie. Sowohl in der Alltagskommunikation als auch in der Literatur findet sie Verwendung. Darum besteht seit der Antike ein hohes Interesse an der Erklärung ihres Auftretens und ihrer Begreifbarkeit. Eine Vielzahl von Theorieansätzen der Ironie bemüht sich, das sprachliche Phänomen in ihrer Komplexität zu erfassen und transparent zu machen.
Statt eines homogenen Ironiebegriffes, der empirisch nutzbar wäre, verfügt die Wissenschaft bislang lediglich über eine Aneinanderreihung bestimmter Kriterien, deren Geltungsbereich und deren Interaktion unklar bleiben. (Prestin 2000: 1)
Darin wird die Schwierigkeit eines übereinstimmenden Begriffes deutlich. Auch die vorliegende Arbeit erhebt nicht den Anspruch eine vollständige und endgültige Ironieauffassung zu formulieren. Vielmehr verfolgt sie das Ziel, die bisherigen Erkenntnisse zu einem Gesamtbild zu integrieren, welches Aussagen über die Funktionen von Ironie in Printmedien enthält und mögliche Wirkungen im Zusammenhang mit den Kontextbedingungen beschreibt. Denn beim Verständnis der Ironie muss der Rezipient auf ein bestimmtes Hintergrundwissen zurückgreifen, um das zu verstehen, was der Produzent übermitteln möchte.
Das Phänomen Ironie bereichert die menschliche Kommunikation, indem sie ermöglicht, trotz der Übermittlung von Kritik, das Gesicht des Ironisierten zu wahren, etwas anderes mitzuteilen als die wörtliche Bedeutung und mit der Äußerung Humor zu erzeugen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung in die Arbeit
- 1.2. Gliederung der Arbeit
- I. Theoretischer Hintergrund
- 2. Begriffsdefinition der Ironie
- 2.1. Begriffsursprung und -entwicklung der Ironie
- 2.2. Abgrenzung der Ironie zu anderen Stilformen
- 3. Ironiesignale
- 4. Linguistische Ironietheorien
- 4.1. Implikaturtheorie nach Grice
- 4.1.1. Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen
- 4.1.2. Generelle und partikuläre Implikaturen
- 4.1.3. Ironie als konversationelle partikuläre Implikatur
- 4.2. Sprechakttheorie nach Austin und Searle
- 4.2.1. Ironie als indirekter Sprechakt
- 4.2.2. Ironie als uneigentlicher Sprechakt
- 4.3. Neuere Theorieansätze der Ironie
- 4.3.1. Lapps Modell der Ironie als zweistufige Simulation
- 4.3.2. Die Pretense Theory von Clark und Gerrig
- 4.3.3. Die Echoic Mention Theory von Sperber und Wilson
- 4.3.4. Die Allusional Pretense Theory von Kumon-Nakamura
- 4.4. Zusammenfassung der Theorien
- 4.1. Implikaturtheorie nach Grice
- 2. Begriffsdefinition der Ironie
- II. Ironie in Printmedien – Eine Analyse
- 5. Das Korpusmaterial
- 6. Charakteristika der Zeitungen
- 7. Die Darstellungsformen Kommentar, Kolumne und Glosse
- 8. Verwendungsmotivation von Ironie in Printmedien
- 8.1. Wirkungen der Ironie
- 8.2. Funktionen der Ironie
- 8.2.1. Funktion der Negativen Bewertung
- 8.2.2. Funktion des Spiegels
- 8.2.3. Funktion des Ästhetischen Humors
- 8.2.4. Funktion der Höflichkeit
- 8.3. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, bestehende Erkenntnisse über Ironie zu einem umfassenden Bild zusammenzuführen, welches die Funktionen von Ironie in Printmedien beleuchtet und deren Wirkung im Kontext beschreibt. Die Arbeit untersucht die Komplexität des Ironieverständnisses und die Rolle des Hintergrundwissens des Rezipienten.
- Begriffsdefinition und Abgrenzung der Ironie
- Linguistische Theorien der Ironie
- Ironie in Printmedien (Kommentare, Kolumnen, Glossen)
- Wirkungen und Funktionen von Ironie
- Kontextualisierung des Ironieverständnisses
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Schwierigkeiten bei der Definition von Ironie. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit als die Integration bestehender Erkenntnisse zu einem Gesamtbild, das die Funktionen und Wirkungen von Ironie in Printmedien beschreibt. Die Einleitung betont die Rolle des Kontextes und des Hintergrundwissens des Rezipienten für das Verständnis von Ironie.
2. Begriffsdefinition der Ironie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Ironie, beleuchtet ihren Ursprung und ihre Entwicklung und grenzt sie von anderen Stilmitteln ab. Es wird die Problematik eines einheitlichen, empirisch anwendbaren Ironiebegriffs herausgestellt, welche die Arbeit zu bewältigen versucht. Die verschiedenen Facetten des Begriffs werden eingehend analysiert.
3. Ironiesignale: Dieses Kapitel befasst sich mit den linguistischen Merkmalen, die Ironie signalisieren können. Es werden verschiedene sprachliche Indikatoren untersucht, die auf Ironie hinweisen können, und ihre Rolle im Prozess des Ironieverstehens erläutert. Der Fokus liegt darauf, wie diese Signale vom Rezipienten erkannt und interpretiert werden.
4. Linguistische Ironietheorien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene linguistische Theorien, die versuchen, das Phänomen der Ironie zu erklären. Es werden die Implikaturtheorie nach Grice, die Sprechakttheorie nach Austin und Searle sowie neuere Ansätze wie Lapps Modell der zweistufigen Simulation, die Pretense Theory und die Echoic Mention Theory detailliert erläutert und miteinander verglichen. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Theorien werden analysiert.
5. Das Korpusmaterial: Dieses Kapitel beschreibt das verwendete Korpus an Texten aus Printmedien, das für die Analyse der Ironieverwendung herangezogen wurde. Es wird die Auswahl der Texte begründet und die Methodik der Korpusanalyse dargelegt. Die Zusammensetzung des Korpus wird detailliert beschrieben.
6. Charakteristika der Zeitungen: In diesem Kapitel werden die spezifischen Merkmale der Zeitungen, aus denen das Korpus stammt, untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf stilistische und inhaltliche Aspekte, die die Verwendung von Ironie beeinflussen könnten. Es wird auf den Kontext der jeweiligen Publikationen eingegangen.
7. Die Darstellungsformen Kommentar, Kolumne und Glosse: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Ironie in verschiedenen journalistischen Darstellungsformen wie Kommentaren, Kolumnen und Glossen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Unterschiede in der Verwendung von Ironie in Abhängigkeit von der jeweiligen Textsorte und ihrem kommunikativen Zweck. Die Analyse berücksichtigt die spezifischen stilistischen Merkmale der jeweiligen Form.
8. Verwendungsmotivation von Ironie in Printmedien: Dieses Kapitel befasst sich mit den Gründen für die Verwendung von Ironie in Printmedien. Es werden die Wirkungen und Funktionen von Ironie untersucht, wie z.B. negative Bewertung, Spiegelung der Realität, ästhetischer Humor und Höflichkeit. Die Analyse beleuchtet die komplexen kommunikativen Ziele, die mit der Verwendung von Ironie erreicht werden sollen.
Schlüsselwörter
Ironie, Linguistik, Pragmatik, Implikatur, Sprechakt, Printmedien, Kommentar, Kolumne, Glosse, Kommunikation, Wirkung, Funktion, Kontext, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Ironie in Printmedien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Verwendung von Ironie in Printmedien, insbesondere in Kommentaren, Kolumnen und Glossen. Sie verbindet theoretische Erkenntnisse über Ironie mit einer empirischen Analyse von Textbeispielen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Funktionen und Wirkungen von Ironie in Printmedien zu zeichnen. Sie untersucht die Komplexität des Ironieverständnisses und die Rolle des Kontextes und des Hintergrundwissens des Lesers.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf linguistische Theorien der Ironie, darunter die Implikaturtheorie (Grice), die Sprechakttheorie (Austin und Searle) und neuere Ansätze wie Lapps Modell der zweistufigen Simulation, die Pretense Theory und die Echoic Mention Theory. Diese Theorien werden verglichen und kritisch bewertet.
Wie wird Ironie in der Arbeit definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit befasst sich ausführlich mit der Definition von Ironie, ihrem Ursprung und ihrer Entwicklung. Sie grenzt Ironie von anderen Stilmitteln ab und diskutiert die Herausforderungen bei der Entwicklung eines einheitlichen, empirisch anwendbaren Ironiebegriffs.
Welche Rolle spielen Ironiesignale?
Die Arbeit analysiert linguistische Merkmale, die auf Ironie hinweisen können (Ironiesignale). Sie untersucht, wie diese Signale vom Leser erkannt und interpretiert werden und wie sie zum Verständnis von Ironie beitragen.
Welches Korpusmaterial wurde verwendet?
Die Arbeit basiert auf einem Korpus von Texten aus Printmedien (Kommentare, Kolumnen, Glossen). Die Auswahl der Texte und die Methodik der Korpusanalyse werden detailliert beschrieben.
Wie werden die untersuchten Zeitungen charakterisiert?
Die Arbeit untersucht die spezifischen Merkmale der Zeitungen, aus denen das Korpus stammt, hinsichtlich stilistischer und inhaltlicher Aspekte, die die Verwendung von Ironie beeinflussen könnten.
Wie wird Ironie in den verschiedenen Textsorten (Kommentar, Kolumne, Glosse) verwendet?
Die Arbeit analysiert die Verwendung von Ironie in Kommentaren, Kolumnen und Glossen und untersucht Unterschiede in der Verwendung von Ironie abhängig von der jeweiligen Textsorte und deren kommunikativem Zweck.
Welche Wirkungen und Funktionen von Ironie werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Wirkungen und Funktionen von Ironie in Printmedien, z.B. negative Bewertung, Spiegelung der Realität, ästhetischer Humor und Höflichkeit. Die Analyse beleuchtet die komplexen kommunikativen Ziele, die mit der Verwendung von Ironie erreicht werden sollen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ironie, Linguistik, Pragmatik, Implikatur, Sprechakt, Printmedien, Kommentar, Kolumne, Glosse, Kommunikation, Wirkung, Funktion, Kontext, Rezeption.
- Quote paper
- Rebecca Stabbert (Author), 2009, Das sprachliche Phänomen ‚Ironie’, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138055