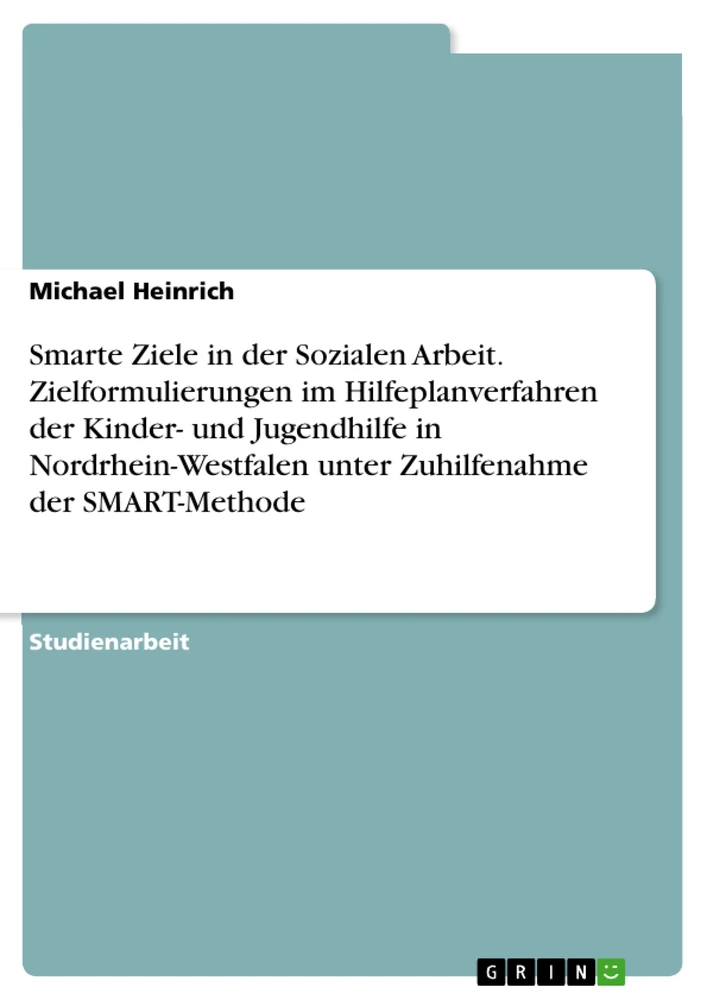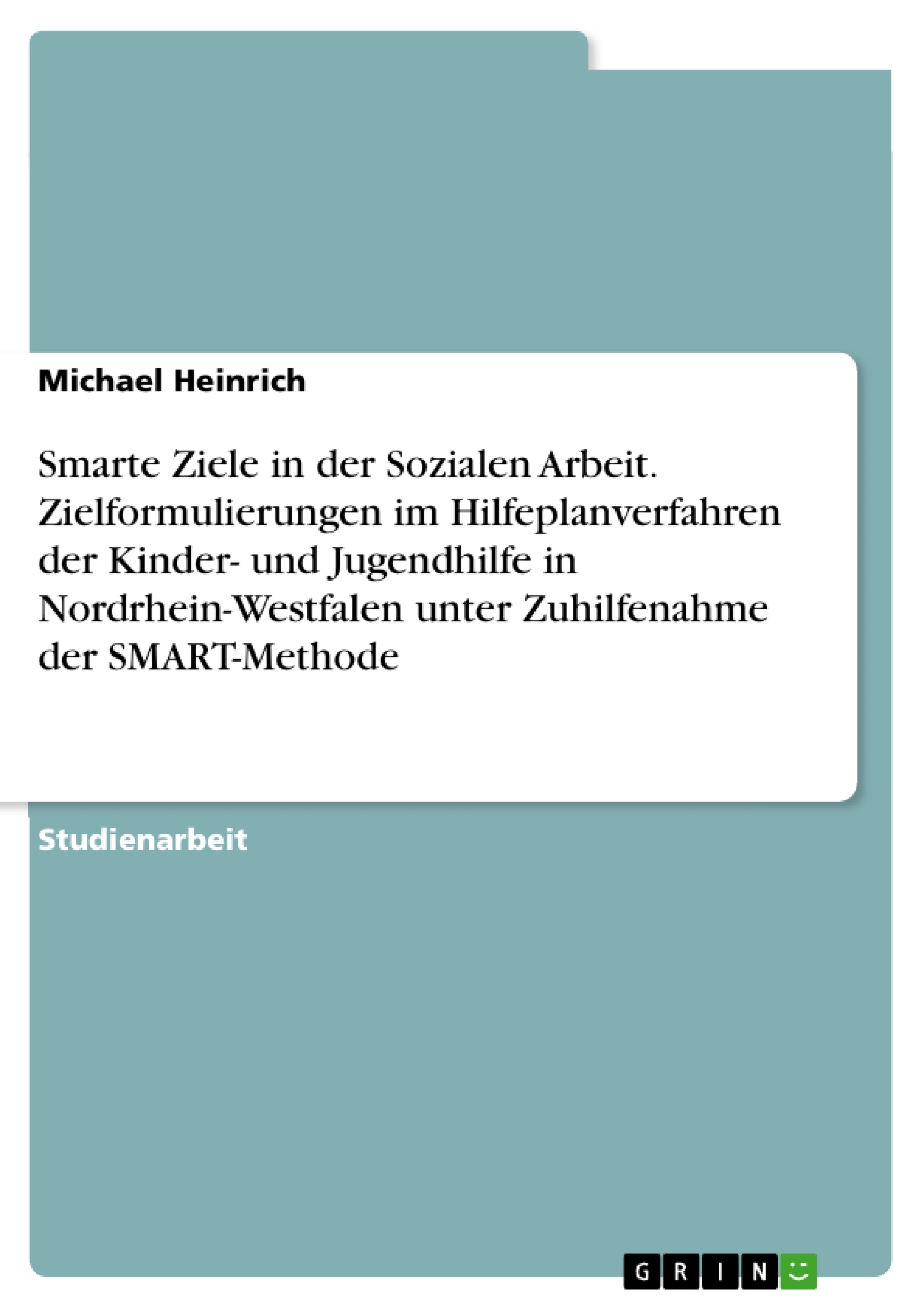Die vorliegende Arbeit thematisiert die Formulierung von Zielen im Hilfeplanverfahren unter Zuhilfenahme des SMART-Konzepts.
Der Studierende arbeitet im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) im Auftrag des Jugendamtes und ist bei einem freien Träger mit Sitz in Bottrop beschäftigt. Er wird im Rahmen der Jugendhilfe von Jugendämtern des Ruhrgebietes beauftragt Familien, Jugendliche und Kinder in unterschiedlichen kritischen Lebenslagen zu unterstützen. Zur Auftragsklärung und der Ermittlung des Hilfebedarfs findet vor Beginn der praktischen Hilfen ein so genanntes Hilfeplangespräch statt. Während dieser Hilfeplangespräche werden mit allen beteiligten Teilnehmer*innen Ziele für die weitere praktische Hilfe vereinbart, formuliert und schriftlich festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung und Definition
- Institution
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Hilfeplan
- Die Beteiligten des Hilfeplanverfahrens
- Hilfeerbringer
- Hilfeempfänger
- Das Hilfeplangespräch
- Die Beteiligten des Hilfeplanverfahrens
- Die SMART-Methode
- Specific / spezifisch
- Measurable / messbar
- Accepted/ akzeptabel
- Realistic/realisierbar
- Timely/zeitlicher Rahmen
- Durchführung in der Praxis
- Fallbeschreibung
- Die Zielvereinbarung
- Gestaltung eines Ziels nach den Smart-Kriterien
- Spezifisch
- Messbar
- Akzeptabel
- Realisierbar
- Zeitlicher Rahmen
- Das SMART-Ziel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Formulierung von Zielen im Hilfeplanverfahren der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen unter Anwendung der SMART-Methode. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des SMART-Konzepts in der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Die Arbeit beschreibt den Prozess der Zielvereinbarung im Hilfeplangespräch und analysiert die einzelnen SMART-Kriterien anhand eines Fallbeispiels.
- SMART-Methode in der Jugendhilfe
- Zielformulierung im Hilfeplanverfahren
- Fallbeispiel aus der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH)
- Analyse der SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch, terminiert)
- Praktische Anwendung der SMART-Methode
Zusammenfassung der Kapitel
Zielsetzung und Definition: Diese Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: die Formulierung von Zielen im Hilfeplanverfahren unter Verwendung der SMART-Methode. Sie skizziert den Arbeitsbereich des Autors in der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und die Rolle von Hilfeplangesprächen bei der Zielvereinbarung. Der Fokus liegt auf der Präzisierung eines Hilfeplanziels mithilfe der SMART-Methode, anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis.
Institution: Dieses Kapitel beschreibt die Kinder- und Jugendhilfe FLOW gGmbH, einen freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, in dem der Autor arbeitet. Es beleuchtet die Unternehmensgeschichte, die Philosophie (FLOW steht für Flexible, Lebenswelt orientierte, Offene und Wertschätzende Hilfen), die Größe und die verschiedenen Standorte in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Der Abschnitt betont den konfessionslosen Charakter und die Bedeutung der Mitarbeiterorientierung.
Sozialpädagogische Familienhilfe: [Es wird angenommen, dass dieses Kapitel die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) im Detail beschreibt, einschließlich der Zielgruppen, Methoden und Arbeitsweisen. Da der Text nicht ausreichend Informationen dazu enthält, kann keine detaillierte Zusammenfassung erstellt werden.]
Hilfeplan: Dieses Kapitel behandelt den Hilfeplanprozess. Es beschreibt die beteiligten Personen (Hilfeerbringer und Hilfeempfänger) und den Ablauf des Hilfeplangesprächs, in dem Ziele gemeinsam definiert und schriftlich festgehalten werden. Der Fokus liegt auf der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Bedeutung der gemeinsamen Zielfindung im Rahmen der Hilfeplanung.
Die SMART-Methode: Dieses Kapitel erläutert die SMART-Methode (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) detailliert. Es erklärt jedes einzelne Kriterium und seine Bedeutung für die Formulierung von klaren, messbaren und erreichbaren Zielen. Es dient als theoretische Grundlage für die praktische Anwendung im Folgeabschnitt.
Durchführung in der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel, in dem die SMART-Methode auf ein konkretes Hilfeplanzielt angewendet wird. Es umfasst eine Fallbeschreibung, die Zielvereinbarung, und eine schrittweise Gestaltung eines SMART-Ziels, wobei jedes Kriterium einzeln analysiert und erklärt wird. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung der theoretischen Grundlagen aus dem vorherigen Kapitel.
Schlüsselwörter
SMART-Methode, Hilfeplanverfahren, Jugendhilfe, Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Zielformulierung, Nordrhein-Westfalen, Fallbeispiel, Zielvereinbarung, Hilfeplangespräch, praktische Umsetzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Formulierung von Zielen im Hilfeplanverfahren
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Formulierung von Zielen im Hilfeplanverfahren der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen unter Anwendung der SMART-Methode. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des SMART-Konzepts in der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die SMART-Methode in der Jugendhilfe, die Zielformulierung im Hilfeplanverfahren, ein Fallbeispiel aus der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), die Analyse der SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch, terminiert) und die praktische Anwendung der SMART-Methode. Es werden der Hilfeplanprozess, die beteiligten Personen (Hilfeerbringer und Hilfeempfänger) und der Ablauf des Hilfeplangesprächs beschrieben.
Was ist die SMART-Methode und wie wird sie angewendet?
Die SMART-Methode (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dient zur Formulierung klarer, messbarer und erreichbarer Ziele. Jedes Kriterium (spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch, zeitlich begrenzt) wird detailliert erklärt und anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis angewendet. Die Arbeit zeigt Schritt für Schritt, wie ein SMART-Ziel gestaltet wird.
Welche Rolle spielt die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)?
Die SPFH dient als praktischer Anwendungsbereich der SMART-Methode. Ein Fallbeispiel aus der SPFH illustriert die konkrete Anwendung der Zielformulierung mit Hilfe der SMART-Kriterien im Hilfeplangespräch.
Wer sind die Beteiligten im Hilfeplanverfahren?
Am Hilfeplanverfahren sind Hilfeerbringer (z.B. Sozialpädagogen) und Hilfeempfänger (z.B. Familien) beteiligt. Der Hilfeplanprozess beinhaltet ein gemeinsames Gespräch zur Definition und schriftlichen Festlegung der Ziele.
Welche Institution wird in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt die Kinder- und Jugendhilfe FLOW gGmbH, einen freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Es werden die Unternehmensgeschichte, die Philosophie, die Größe und die verschiedenen Standorte erläutert.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt kurz den Inhalt jedes Kapitels, beginnend mit der Zielsetzung und Definition über die Institution, die Sozialpädagogische Familienhilfe, den Hilfeplan, die SMART-Methode bis hin zur Durchführung in der Praxis und dem Fazit. Der Fokus liegt jeweils auf den zentralen Inhalten und der Verknüpfung der einzelnen Kapitel.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: SMART-Methode, Hilfeplanverfahren, Jugendhilfe, Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Zielformulierung, Nordrhein-Westfalen, Fallbeispiel, Zielvereinbarung, Hilfeplangespräch, praktische Umsetzung.
- Quote paper
- Michael Heinrich (Author), 2017, Smarte Ziele in der Sozialen Arbeit. Zielformulierungen im Hilfeplanverfahren der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen unter Zuhilfenahme der SMART-Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1380241