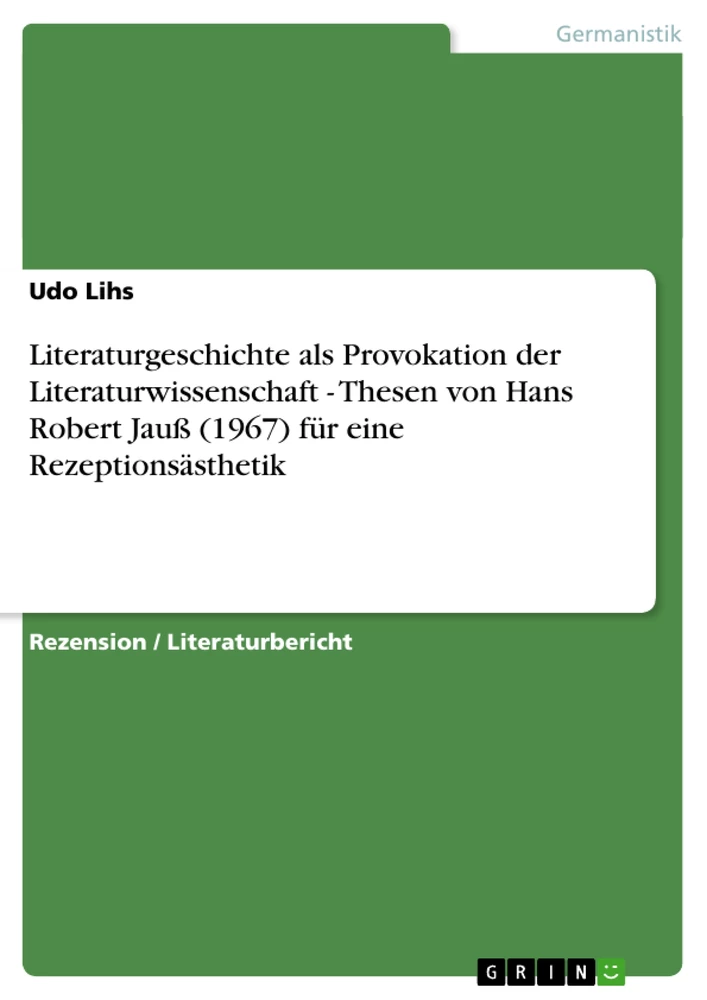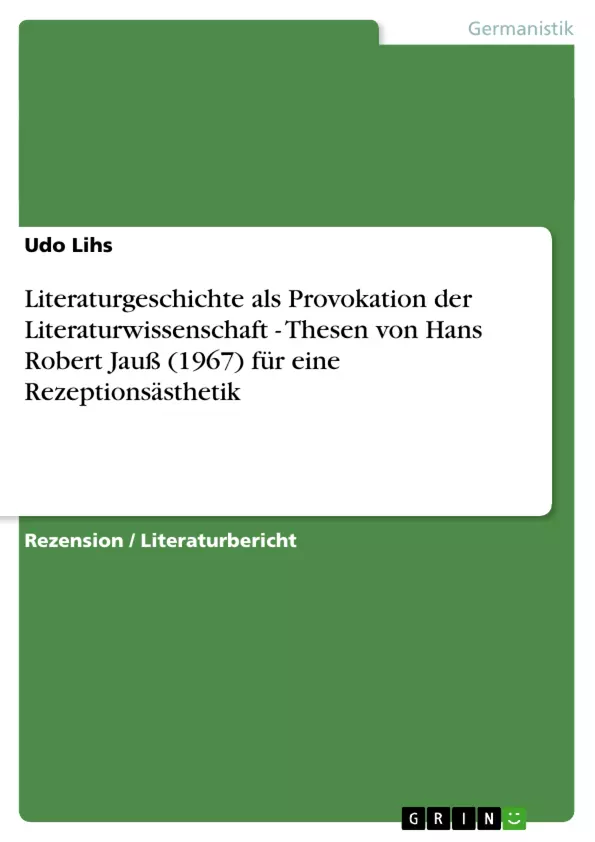Luthers Geist, bestehende, festgefahrene Strukturen zu kritisieren, ruhte ggf. in Hans Robert Jauß, der in der Vorlesung „Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft“ versucht, die Vorstellung von Literaturgeschichte seiner Zeit zu kritisieren; Literaturgeschichte, mit dem Ziel, „an der Geschichte der Dichtwerke die Idee der nationalen Individualität auf ihrem Weg zu sich selbst darzustellen“ (Jauß, 1970: S. 144, vgl. auch: S. 149, S. 152) scheint in Vergessenheit zu geraten, so Jauß. Die als antiquiert eingestufte Literaturgeschichte wird durch die Veröffentlichung von „pseudohistorischen Sammelwerken“ (Enzyklopädien, Handbüchern, Interpretationsreihen) verdrängt. Jauß bemängelt, dass, insofern Literaturgeschichte betrieben wird, so beschränkt sich diese lediglich auf die die ideale, objektive und chronologische Ordnung und Sortierung der Werke nach Gattung oder Autor („und dann und wann ein weißer Elefant“3). Die Literaturgeschichte seiner Zeit beschränkt sich häufig auf die Kanonisierung von Werken Diese traditionellen Ansätze der Literaturwissenschaft, sind „keine Geschichte“4, sondern „Pseudogeschichte“5, so Jauß. Jauß will die Literaturgeschiche nicht neu schreiben, aber ein Umdenken hervorbringen, eine neue Perspektive in die Literaturgeschichte einbringen, die Perspektive des Lesers. Die Dimensionen Rezeption, Wirkung und Nachruhm eines literarischen Werkes werden, so Jauß, in der Literaturgeschichte vernachlässigt.
1. Einleitung
Die Geschichte der Literatur wird häufig in Einklang mit einem Kanon an Schriftstellern gebracht. Walter von der Vogelweide, Luther, Lessing, Goethe, Schiller, Kant, Brecht, Mann…. Sie haben „Literaturgeschichte“ geschrieben, sagt man und werden heute zu Recht in Autorenlexika verewigt und gewürdigt. Die Geschichte der Literatur ist häufig auch eine Geschichte des Zeitgeistes der jeweiligen Epoche. Es wird in den Vorlesungsverzeichnissen der Universitäten von der „Literatur des Mittelalters“ gesprochen und Werke, wie das „Nibelungenlied“ oder „Tristan und Isolde“ gelten als Repräsentanten einer höfischen, ritterlichen Dichtkunst, während Walther von der Vogelweide zum Repräsentanten einer Idee der Minne wird. Im der frühen Neuzeit, sagt die Literaturgeschichte, entwickeln sich pluralistische Tendenzen, von der Literatur der Reformation bis zur Literatur des Barock, von Luther bis zu Opitz, über Lessing in der Aufklärung, bis zu Goethe im Sturm und Drang, über die Romantik, weiter zum Biedermeier, vom Vormärz zum Naturalismus, vom Expressionismus zur Moderne, jeweils gibt es gar Schwierigkeiten Periodisierungen klar zu verdeutlichen, aber, wie auch immer, es gibt sie. Jeweils werden Gattungen und ihre spezifischen Ausformungen in den jeweiligen Epochen untersucht, als wäre die Zeitgeschichte eine Epochengeschichte. Wir wissen heute: Epochenbegriffe sind häufig ein Anachronismen. Das Mittelalter hat sich gewiss nicht als Mittelalter verstanden, die Reformation, die Luther in Gang brachte, war nicht als Reformation durchdacht und geplant, sie war eine Reaktion auf die Missstände in der römischen Einheitskirche. Luther wollte keine Epoche einläuten, er wollte mit seinem Thesenanschlag v.a. Kritik vergegenwärtigen, in dem Sinne: Provokation betreiben, nicht der Provokation willen, sondern um die Christenheit an die Schrift, die Bibel heranzuführen, um Leser zu produzieren. So schrieb Luther Geschichte, indem er an die Leser dachte.
2. Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft
Luthers Geist, bestehende, festgefahrene Strukturen zu kritisieren, ruhte ggf. in Hans Robert Jauß, der in der Vorlesung „Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft“ versucht, die Vorstellung von Literaturgeschichte seiner Zeit zu kritisieren; Literaturgeschichte, mit dem Ziel, „an der Geschichte der Dichtwerke die Idee der nationalen Individualität auf ihrem Weg zu sich selbst darzustellen“1 scheint in Vergessenheit zu geraten, so Jauß. Die als antiquiert eingestufte Literaturgeschichte wird durch die Veröffentlichung von „pseudohistorischen Sammelwerken“2 (Enzyklopädien, Handbücher, Interpretationsreihen) verdrängt. Jauß bemängelt, dass, insofern Literaturgeschichte betrieben wird, so beschränkt sich diese lediglich auf die die ideale, objektive und chronologische Ordnung und Sortierung der Werke nach Gattung oder Autor („und dann und wann ein weißer Elefant“3 ). Die Literaturgeschichte seiner Zeit beschränkt sich häufig auf die Kanonisierung von Werken Diese traditionellen Ansätze der Literaturwissenschaft, sind „keine Geschichte“4, sondern „Pseudogeschichte“5, so Jauß. Jauß will die Literaturgeschiche nicht neu schreiben, aber ein Umdenken hervorbringen, eine neue Perspektive in die Literaturgeschichte einbringen, die Perspektive des Lesers. Die Dimensionen Rezeption, Wirkung und Nachruhm eines literarischen Werkes werden, so Jauß, in der Literaturgeschichte vernachlässigt:
„(…) Qualität und Rang eines literarischen Werks ergeben sich weder aus seinen biografischen oder historischen Entstehungsbedingungen, noch allein aus seiner Stelle im Folgeverhältnis der Gattungsentwicklung, sondern aus den schwer faßbaren Kriterien von Wirkung, Rezeption und Nachruhm.“6
Erst durch die Interaktion des produzierenden Subjekts (des Autors) mit dem konsumierenden Subjekt (mit dem Leser) wird Literatur (und Kunst) zur Geschichte, v.a. dann wenn Vergangenes kritisch reproduziert wird, wenn Werke, die in der Vergangenheit veröffentlicht wurden, im Zuge der Zeit bis in die Gegenwart noch reflektiert werden. Jauß verweist damit auf Zusammenhänge zwischen den Werken in den jeweiligen Epochen, die in der Darstellung von Epochen, die nacheinander gereiht werden, als hätten sie miteinander nichts zu tun, unterschlagen werden. Natürlich ist die Aufklärung keine Epoche an sich, sie ist eine Reaktion auf bestehende Strukturen, sie ist Kritik an Verhältnissen der Kirche. Wenn Kant für den „Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen“7 plädiert, so ist er Kirchenkritiker, die eher eine Dogmatik, eine Demut an Gott voraussetzt, um Ethik oder Moral zu formulieren. Im Zuge der Zeit wird Kant immer wieder rezipiert, z.B. von Schopenhauer. Natürlich wurde in der Zeit der Aufklärung nicht nur zeitgenössische Literatur von Kant, Lessing oder Gellert gelesen, Aufklärung ist, um mit Jauß zu sprechen, Rezeption der Antike. Viele Fabeldichter, wie z.B. Lessing, greifen auf Aesop zurück, verstehen Fabeln im Rahmen ihrer Sozialisation, im Rahmen ihres Verstandes, der im Zeitgeist vorherrschte.
[...]
1 Jauß, 1970: S. 144, vgl. auch: S. 149, S. 152
2 Ebd. S. 145
3 Ebd. S. 146
4 Ebd.
5 Ebd. S. 172
6 Ebd. S. 147
7 Berlinische Monatsschrift, 1784, Nr. 2, S. 481-494
- Quote paper
- Udo Lihs (Author), 2008, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft - Thesen von Hans Robert Jauß (1967) für eine Rezeptionsästhetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138008