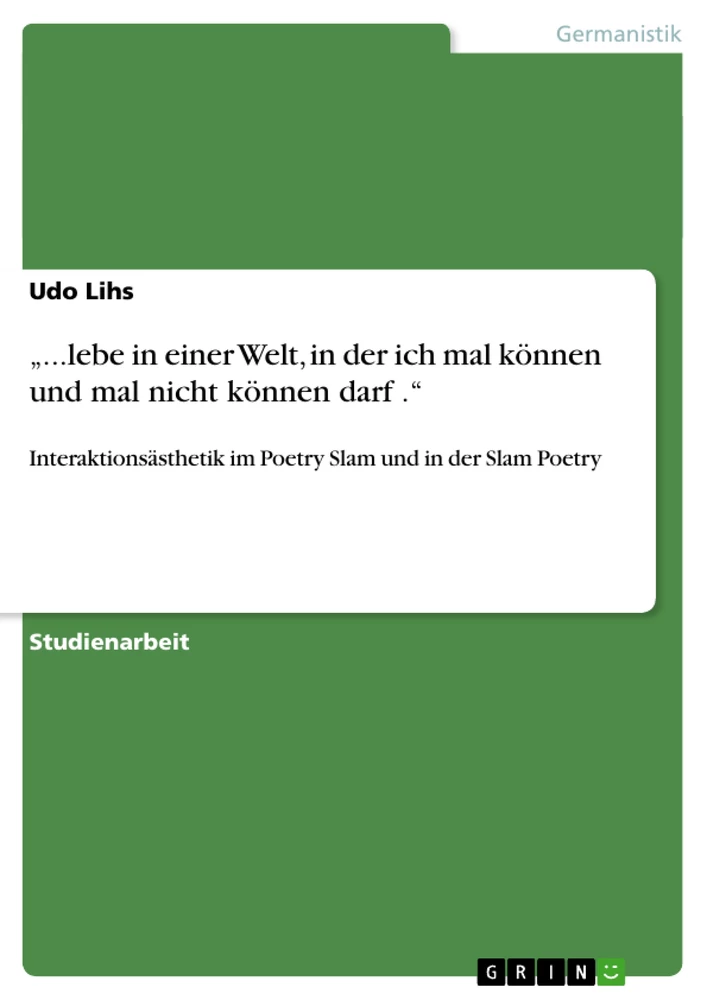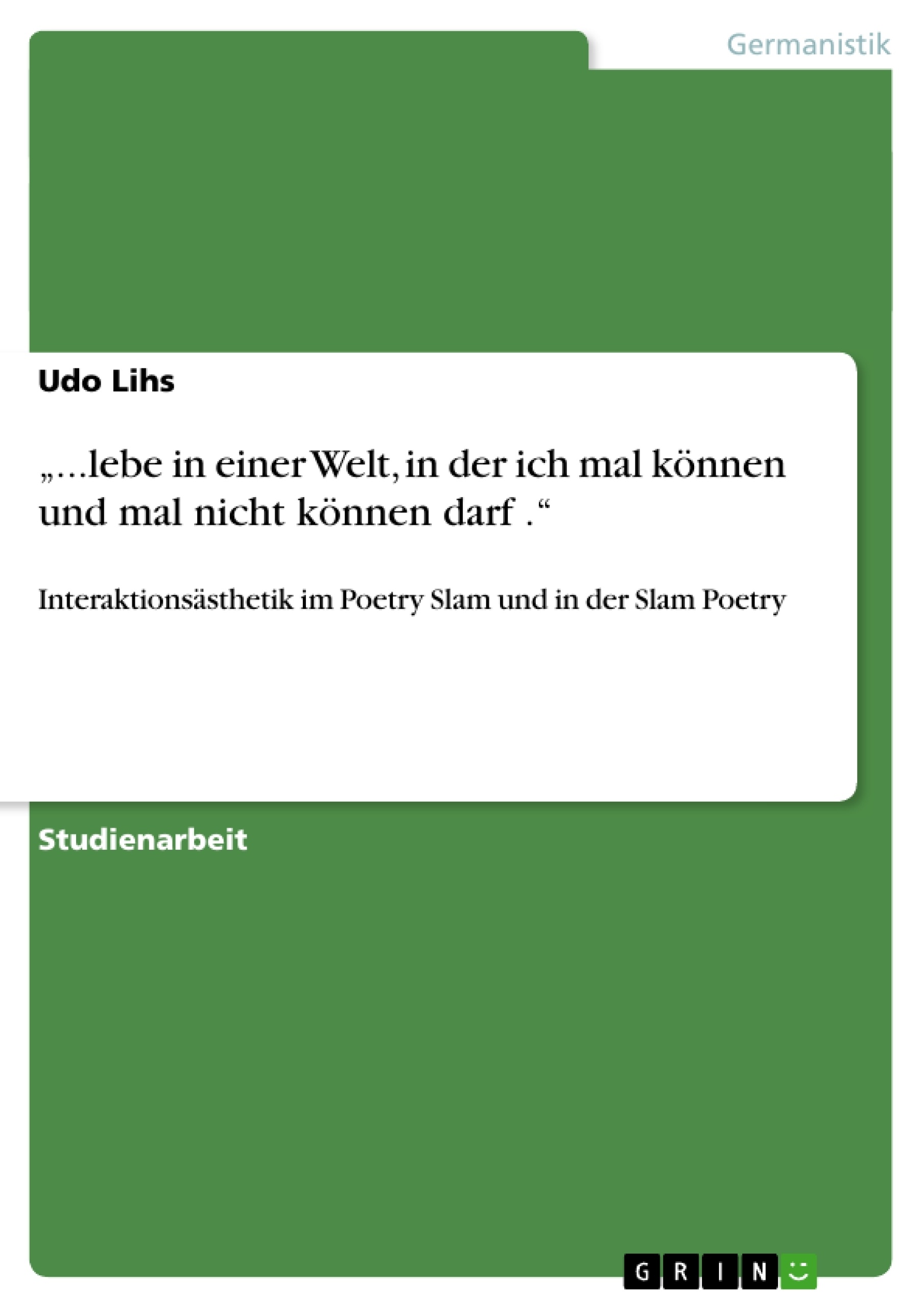Diese Hausarbeit wird sich in Ansätzen mit dem Phänomen "Poetry Slam" inhaltlich, analytisch und vor allem interpretativ auseinandersetzen. Konzentrieren wird sich diese Arbeit auf die Geschichte des Poetry Slams, auf Interaktion in den Veranstaltungen, sowie auf die Ästhetik der Literatur, die in der Regel auf der Bühne nicht nur vorgetragen, sondern „performt“ und damit „gelebt“ wird. Dabei wird sich diese Arbeit auf Boris Preckwitz berufen, der sich als Germanist mit dem Phänomen „Poetry Slam“ theoretisch und praktisch beschäftigt hat.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort
2 Poetry Slam und Slam Poetry: Eine Einführung
3 Die Geschichte des Poetry Slams
4 Interaktion im Poetry Slam
5 Die Ästhetik der Slam Poetry
6 Fazit
7 Literatur
1 Vorwort
„Ich kann nicht alle Kämpfe, die das Leben für mich bereithält, gewinnen, aber ich kann das versuchen, solange ich lebe, lebe in einer Welt, in der ich mal können und mal nicht können darf.“
Michael Ebeling[1]
Die Musik stimmt leise die ersten Takte an. „Micha“ weiß: Es wird knapp. Er hat nur noch wenige Sekunden, um seinen Text zu präsentieren und er kämpft, er redet, redet und redet als ginge es um die Welt, als würde er die Welt verändern wollen und vielleicht, ja vielleicht will er das sogar und vielleicht verändert er jemanden im Publikum. Wer weiß das so genau? Die Musik drängt sich mehr und mehr in den Text und vermengt sich mit dem Text zur Dramatik, die kein Theater besser liefern könnte. „Micha“ beendet seine Performance mit der Botschaft, in einer Welt leben zu wollen, in der er „mal können, mal nicht können darf“. Das Publikum ist begeistert. Michael Ebeling verlässt mit tobendem Applaus die Bühne. Das Publikum schreit, klatscht, pfeift, als hätte „Micha“, wie ihn alle nennen, die Revolution, die Freiheit ausgerufen, doch nichts weiter ist geschehen, als dass ein „Poetry Slammer“ „klar gemacht hat“, dass er versucht, die Welt zu verändern, indem er sein Leben lebt und versucht, die Herausforderungen des Lebens, die es zu leben gilt, zu bestehen.
Poetry Slam begeistert seit Jahren die Szene. „Micha“ ist nur ein Beispiel. Seit Jahrzehnten versuchen Slammer aus aller Welt und in dieser Welt ein Publikum mit Gedichten oder Geschichten, mit Literatur zu begeistern. Seit Jahrzehnten versuchen Performer; Erzähler und Dichter Lyrik, Prosa oder Kunst darzustellen, als hätte sie die Literatur, die Worte im Blut. Wir finden „Slammer“ in Cafés, in Clubs oder in den vielen Bars dieser Welt. Dort versuchen sie mal professionell, mal eher schlecht, als recht zu verdeutlichen, was in ihnen vorgeht und in der Regel ist es diese Welt, diese Gesellschaft, die sie versuchen, zu verändern, zu gestalten oder wenigstens zu verstehen oder von ihr zu erzählen.
Diese Hausarbeit wird sich mit dem Phänomen „Poetry Slam“ inhaltlich, analytisch und vor allem interpretativ in Ansätzen auseinandersetzen. Konzentrieren wird sich diese Arbeit auf die Geschichte des Poetry Slams, auf Interaktion in den Veranstaltungen, die landläufig als „Poetry Slam“ ausgeschrieben werden, sowie auf die Ästhetik der Literatur, die in der Regel auf der Bühne nicht nur vorgetragen, sondern „performt“ und damit „gelebt“ wird. Dabei wird sich diese Arbeit auf Boris Preckwitz berufen, der sich als Germanist mit dem Phänomen „Poetry Slam“ theoretisch und praktisch beschäftigt hat. Im Endeffekt wird diese Hausarbeit der folgenden These nachgehen:
Poetry Slam ist eine Offkultur, die, historisch gewachsen, in der Interaktion mit dem Publikum als „Poetry Slam“, mit den Kunstgriffen der Literatur, mit bestimmten verbalen, nonverbalen, rhetorischen oder literarischen Mitteln als „Slam Poetry“ wirkt, wodurch der „Slam“ an sich Erfolge zeigt und zur Avantgarde der Mittelschicht wird.
2 Poetry Slam und Slam Poetry: Eine Einführung
Was ist „Poetry Slam“? In der Regel ist der „Poetry Slam“ ein Wettstreit, in der Poeten um das „beste Gedicht“ kämpfen, würde man platt und laienhaft sagen. Damit trifft man das Phänomen „Poetry Slam“ aber keinesfalls, mit dieser Definition reduziert man das Phänomen „Poetry Slam“ es auf einen Literaturwettstreit. Poetry Slam zu begreifen, zu verstehen oder gar zu definieren ist relativ schwer, denn Literaturwettbewerbe gibt es, seitdem es Dichter gibt und ob die Poeten im Format „Poetry Slam“ tatsächlich Dichter sind, mag bezweifelt werden, denn in den Veranstaltungen, die sich „Poetry Slams“ nennen, finden wir häufig neben Poesie, neben guter, gelungener poetischer Lyrik und Prosa auch politische Reden oder Statements, die in der Regel nicht unter dem Feld „Poesie“ eingeordnet werden, eher in Felder wie „politische Rede“, „Referat“ oder „Vortrag“.
Poetry Slam definiert sich durch das Vortragen einer speziellen Poesie, der Slam Poetry. In der Regel versucht die Poetry des Poetry Slams dadurch Slam Poetry zu sein, indem sie typische literarische Kunstgriffe, in der Regel rhetorische Mittel nutzt, wie Alliterationen, Metapher oder Paradoxien oder indem Erzählungen eine Dramatik oder Komik erfahren, was sie aber nicht eindeutig als „Slam Poetry“ definiert, denn Dramatik finden wir z.B. auch in Tragödien. In der Regel wird die Slam Poetry vor allem durch die „Performance“ des Textes zum oralen, mündlich aufgeführten Slam Poetry, denn im Poetry Slam geht es neben der Poetry an sich vielmehr darum, die Poesie, den Text, authentisch, angemessen und vor allem kraftvoll darzustellen, eben einen Text „zu slammen“. Lautstärke, Prosodie, Bewegung, Mimik und Gestik spielen eine Rolle, wie Schnelligkeit, Langsamkeit oder Pausen. Gute „Slammer“ sprechen gar das Publikum an, beziehen es ein, werden dadurch „gut“, eine Interaktion und Partizipation des Publikums herzustellen. Im Endeffekt spielt Interaktion eine Rolle, ein Zusammenspiel zwischen Publikum und Autor, wobei gleichzeitig die Ästhetik der Poesie, der Slam Poetry einfließen muss, denn das Publikum reagiert nur positiv, wenn der Text dem Publikum gefällt, tut es das nicht, schläft es ein. Poetry Slam ist daher Interaktionsästhetik, die kunstvolle, kraftvolle Darbietung von Literatur auf der Bühne in der Wechselwirkung mit dem Publikum.
Es ist schwierig, „Slam“ zu übersetzen, denn das Wort „Slam“ wird im Englischen, wie im Deutschen vielfältig benutzt und jeweils semantisch umgedeutet. Preckwitz zählt Beispiele auf:[2] Slam wird mit „schlagen“, „zuschlagen“ oder „zuknallen“ übersetzt. Der „Slam“ ist aber auch als „Stich“ im Skat bekannt, auch als „Volltreffer“ im Baseball oder als „Schlagabtausch“ im Boxring. Der „Grand Slam“ ist ein Turnier im Tennis. Poetry Slam ist daher ein sportlicher Schlagabtausch der Poeten? Ein Wettbewerb, ein Turnier unter Poeten? In dem Sinn ist der Poetry Slam teilweise zu verstehen, als literarischer Wettstreit im Veranstaltungsformat, eine Art „Festival der Literatur“, vergleichbar mit Filmfestspielen oder Musikwettbewerbe. Der „Slam“, das ist aber mehr, das ist aber auch die Bewegung, das Netzwerk der „Slammer“, der Austausch der Poeten und die weltweite Kooperation der Cafés, Bars, Clubs und Hallen. Dabei ist zu sagen, dass jeder zum „Slammer“ werden kann. Es gibt keine Elite, jeder kann „slammen“, insofern er „Slam Poetry“ vortragen und „performen“ kann, genau diese Qualität der Performance entscheidet beim Poetry Slam „Slam Poetry“ bezeichnet, so Preckwitz, eine „publikumsbezogene, wettkampfgerechte Form der Performance Poetry“[3] Es geht also im Poetry Slam darum, einen Text, einen poetischen, literarischen Text, was auch immer das sei, das sei freigestellt, Poetry kann weit ausgelegt werden, möglichst authentisch, kraftvoll, einschlagend und ergreifend, d.h. ästhetisch in der Interaktion mit dem Publikum vorzutragen. Das Publikum ist zu begeistern, zu schockieren, zu erfreuen oder gar in einen „literarischen Orgasmus“[4] zu versetzen. Damit steht das Publikum in der Aufgabe, zu reagieren, d.h. in die Interaktion durch die Reaktion auf die Poesie mit dem Poeten zu treten, der daraufhin flexibel reagieren kann und z.B. im Freestyle, d.h. in der ungeplanten Performance von Gedanken sogar tiefgehend das Publikum zum Inhalt der Poetry machen kann. Es darf gejubelt, gebrüllt, geschrien, bestätigt, geklatscht oder geweint werden. Das geht natürlich nur, wenn das Publikum auch ergriffen ist, d.h. die „Slam“ muss „einschlagen“, um „treffsicher“ den Geschmack des Publikums treffen, das nicht nur unterhalten werden will, sondern vor allem reagieren und mitleiden, mitfühlen, Poesie erleben will. In dem Sinn muss die Poesie eben Poesie im Sinne einer Ästhetik sein, um „Slam Poetry“ zu sein. Die Worte müssen fein gewählt werden, rhetorische Mittel kommen zum Einsatz, genauso wie Bewegung, Körpersprache und Ausstrahlung. Lautstärke, Höhe und Tiefe der Stimme entscheiden im Endeffekt nicht nur über den Erfolg des „Slammers“, sondern auch über den Erfolg der Poetry, die vorgetragen wird. Zwischen Interaktion und Ästhetik, zwischen Kooperation und Performance-Kunst bewegt sich der Poetry Slam auf einer Gradwanderung. Partizipation und Ausdruck müssen sich in einer Authentizität wiederfinden. Günstig ist e, wenn ein „Slammer“ wirklich daran glaubt, was er sagt und damit ein Publikum nicht nur unterhalten, sondern auch überzeugen will und auch verstanden werden kann.
In dem Sinne ist die Poetry in Poetry Slams für die Literaturwissenschaft bedeutend, denn jeder „Poetry Slam“ zeigt ein Stück Vielfalt der Literatur im 21. Jahrhundert. Im Poetry Slam finden wir die neue „Poesie von heute“, die Geschichten und Erzählungen der Gegenwart, der unmittelbaren Gegenwart. Damit ist jeder von uns angehalten, Zeitzeuge einer literarischen Bewegung zu sein.
[...]
[1] Schluß in Michael Ebelings Beitrag „Ich“, vorgetragen im „WDR Poetry Slam“, 11.03.2007
http://www.wdr.de/tv/poetryslam/videos/20070311_video_michael_ebeling.jsp?buch=47&seite=1&status=1
[2] vgl. Preckwitz, 1997: S. 19ff
[3] ebd.:S. 22
[4]
- Quote paper
- Udo Lihs (Author), 2008, „...lebe in einer Welt, in der ich mal können und mal nicht können darf .“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138007