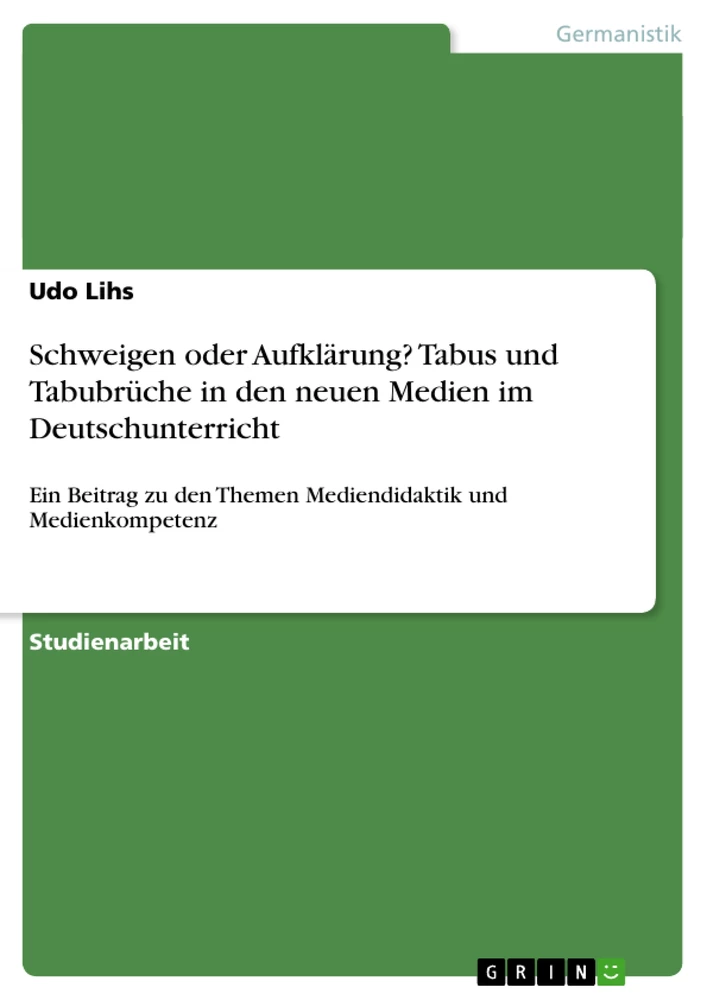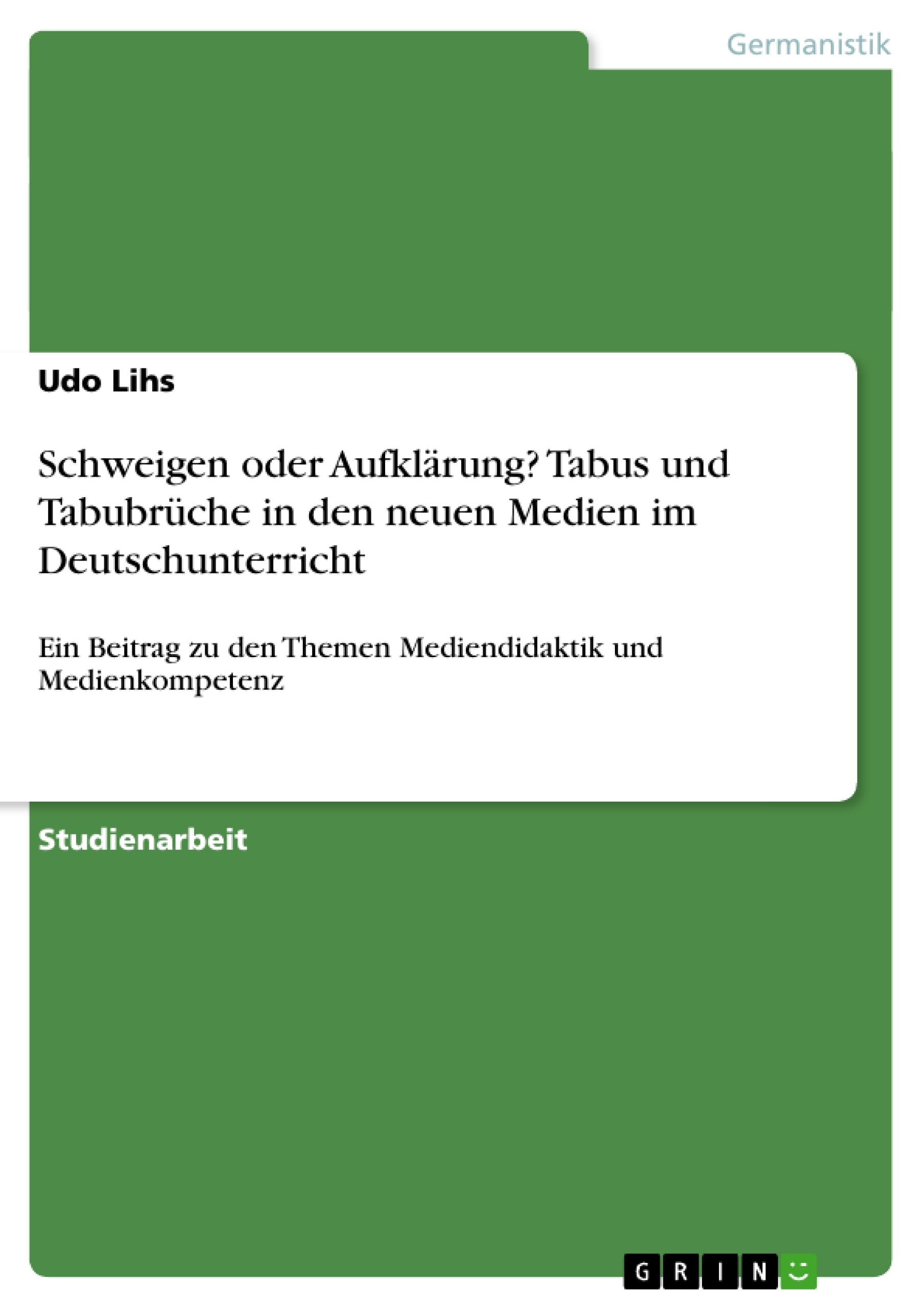Tabus bestimmen den Lebensalltag in der Gesellschaft. Sie regulieren soziale Prozesse, manifestieren Normen, Normativitäten und universelle Rechte und Gesetze. Sie verhindern individuelle oder kollektive Übertretungen von moralischen Geboten und ethischen Bedenken. Sie verhindern in diesem Sinne die Anomie und führen zu Stabilität und Sicherheit in einer Gemeinschaft.
Es steht fest, dass manifestierte Tabus traditionell von Generation zu Generation weitergetragen werden, interessanterweise auch dann, wenn gar das Sprechen über das jeweilige Tabu selbst ein Tabu ist, wobei unter dem Stichwort „Grenzen setzen“ Tabus in weitesten Sinn Themen in der Sozialpädagogik, wie in der Erziehungswissenschaft sind. Fraglich bleibt in den jeweiligen pädagogischen Tabudiskursen, ob man mit Kindern und Jugendlichen über Tabus, z.B. über Inzest, Sex mit Tieren oder über brutale, blutige Gewalt reden sollte, sie über Tabus und über die Gefahren von Tabulosigkeiten aufzuklären hat? Insofern man das tut, steht die Frage im Raum, ob die jeweilige Aufklärung nicht schon ein Tabubruch ist, inwiefern man durch jene Aufklärung, die ggf. gar zu einer „Belehrung“ von „oben herab“ verkommen kann, Kinder und Jugendliche dazu bewegt, Erfahrungen mit Tabus machen zu wollen, was im Endeffekt kontraproduktiv wäre. So ist es z.B. häufig zu beobachten, dass, insofern man Kinder und Jugendliche vor Horrorvideos warnt, diese dann gezielt zu diesen greifen, weil sie den Horror und damit die Tabus selbst erfahren wollen.
Von Soziologen, wie z.B. Niklas Luhmann, wird behauptet, Erziehung sei sinnlos, da Kinder sich selbst aufgrund von Erfahrungen in sozialen Systemen lernen:
„Elementares Lernen vollzieht sich unabsichtlich-beiläufig aufgrund von Erfahrungen (…)“
Welche Erfahrungen machen Kinder und Jugendliche im 21. Jhd.? Fakt ist, dass wir in einer „Mediengesellschaft“ leben, d.h. alte und neue Medien beeinflussen das Leben von Kindern und Jugendlichen. War es für das Kind und für den Jugendlichen früher schwierig, an Horror- oder Sexvideos heranzukommen, da Videotheken Bereiche für Kinder und Jugendliche verschlossen hielten, ist es heute eine Leichtigkeit für Kinder und Jugendliche auf Internetportalen tabulose Inhalte herunterzuladen oder direkt anzusehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2.1. Was ist ein Tabu? - Tabus im weitläufigen Sinn
2.2. Was ist ein Tabu? - Tabus im engeren Sinn
3. Was gibt es da zu verstehen? - Sachanalytische Zugänge: Tabus und Tabubrüche in den neuen Medien im Vergleich zu den alten Medien
4. Bedingungsanalytische Vorüberlegungen für den Unterricht
5. Konsequenzen: Sollen Tabus und Tabubrüche im Unterricht behandelt werden, oder nicht?
6. Didaktische Reflexionen - Was kann Schule leisten, insofern Tabus und Tabubrüche in den neuen Medien thematisiert werden?
7. Methodische Überlegungen
8. Analyse einer Lehreinheit
Literatur
1. Vorwort
Tabus bestimmen den Lebensalltag in der Gesellschaft. Sie regulieren soziale Prozesse, manifestieren Normen, Normativitäten und universelle Rechte und Gesetze. Sie verhindern individuelle oder kollektive Übertretungen von moralischen Geboten und ethischen Bedenken. Sie verhindern in diesem Sinne die Anomie und führen zu Stabilität und Sicherheit in einer Gemeinschaft.
Es steht fest, dass manifestierte Tabus traditionell von Generation zu Generation weitergetragen werden, interessanterweise auch dann, wenn gar das Sprechen über das jeweilige Tabu selbst ein Tabu ist, wobei unter dem Stichwort „Grenzen setzen“ Tabus in weitesten Sinn Themen in der Sozialpädagogik, wie in der Erziehungswissenschaft sind. Fraglich bleibt in den jeweiligen pädagogischen Tabudiskursen, ob man mit Kindern und Jugendlichen über Tabus, z.B. über Inzest, Sex mit Tieren oder über brutale, blutige Gewalt reden sollte, sie über Tabus und über die Gefahren von Tabulosigkeiten aufzuklären hat? Insofern man das tut, steht die Frage im Raum, ob die jeweilige Aufklärung nicht schon ein Tabubruch ist, inwiefern man durch jene Aufklärung, die ggf. gar zu einer „Belehrung“ von „oben herab“ verkommen kann, Kinder und Jugendliche dazu bewegt, Erfahrungen mit Tabus machen zu wollen, was im Endeffekt kontraproduktiv wäre. So ist es z.B. häufig zu beobachten, dass, insofern man Kinder und Jugendliche vor Horrorvideos warnt, diese dann gezielt zu diesen greifen, weil sie den Horror und damit die Tabus selbst erfahren wollen.
Von Soziologen, wie z.B. Niklas Luhmann, wird behauptet, Erziehung sei sinnlos, da Kinder sich selbst aufgrund von Erfahrungen in sozialen Systemen lernen:
„ Elementares Lernen vollzieht sich unabsichtlich-beil ä ufig aufgrund von Erfahrungen ( … ) “1 Welche Erfahrungen machen Kinder und Jugendliche im 21. Jhd.? Fakt ist, dass wir in einer „Mediengesellschaft“ leben, d.h. alte und neue Medien beeinflussen das Leben von Kindern und Jugendlichen. War es für das Kind und für den Jugendlichen früher schwierig, an Horror- oder Sexvideos heranzukommen, da Videotheken Bereiche für Kinder und Jugendliche verschlossen hielten, ist es heute eine Leichtigkeit für Kinder und Jugendliche auf Internetportalen tabulose Inhalte herunterzuladen oder direkt anzusehen.
Die hier vorgetragenen Gedanken führen schließlich zu der Frage, inwiefern der uneingeschränkte Zugang zu Tabulosigkeiten im Internet bzw. in den neuen Medien, z.B. in Handys, eine Gefahr für Kinder und Jugendliche sind und wie Unterricht, wie speziell der Deutschunterricht hier eingreifen kann. Hierbei sollen zwei Modelle kontrastiert werden, die in mediendidaktischen Diskursen immer wieder eine Rolle spielen: Die Individualisierung und die Medialisierung. Am Ende der Hausarbeit soll eine Lehreinheit kritisch analyisiert und reflektiert werden.
2.1. Was ist ein Tabu? - Tabus im weitläufigen Sinn -
Harro Müller-Michaels betont: Tabus sind…
„… Meidungsgebote f ü r Reden und Handlungen ( … ), deren Verletzung mit Ausschluss aus der Gemeinschaft bedroht ist. “2
Ein Tabu unterliegt daher der Durchsetzungsmacht Einzelner oder dem Konsens einer Gruppe, einer Gesellschaft, einer Kultur oder einer Religion. Tabus sind in dem Sinne keine individuelle Angelegenheit, sondern spiegeln in dem Sinne nur in Gruppen, in Gemeinschaften und Gesellschaft eine Rolle.
Matthis Kepser definiert Tabus im weitläufigen Sinn als:
„ Handlungsverdikte “
und als
„ symbolische Interaktionen, von denen behauptet wird, dass sie gegen verbindliche Konventionen versto ß en “3
Kepser kategorisiert Tabus als Worttabus („Das sagt man [so] nicht.“)4, Handlungstabus („Das tut man nicht“)5, thematische Tabus („Darüber redet man nicht.“) und Darstellungstabus („Das zeigt man nicht.“).
Tabus sind zu unterscheiden von Verboten, Gesetzen und Regeln. Tabus sind häufig Verstöße gegen z.B. das StGB oder das JSchG. ABER: Nicht jeder Verstoß gegen ein Gesetz oder gegen eine Regel ist ein Tabu („z.B. Lehrer beleidigen“). Tabus gehen mit Normativitäten einer Gesellschaft einher. Wer ein Tabu bricht, gilt als „komisch“, „anormal“6, als „pervers“ oder „krank“. Kinder und Jugendliche, die Tabus brechen, gelten als „verhaltensauffällig“, „deviant“ oder gar als „verwahrlost“7. Eine ganze Generation, die "Jugend" wird gar als "sexuell verwahrlost" stereotypisiert. Tabus prägen den „Zeitgeist“ einer Gesellschaft. Tabus können im Laufe der Geschichte und in Zeiten von Umbrüchen verschwinden oder relativiert werden. Was früher ein Tabu war, kann heute „Alltäglichkeit“ oder „Normalität“ geworden sein. Man redet von "Wertewandel", Kritiker reden gar vom "Werteverfall". Tabus erscheinen in der Gemeinschaft, in der das Tabu gilt, als selbstverständlich und müssen nicht rational begründet werden.
Die Sicherung gemeinsamer Wertüberzeugungen, die Stabilisierung der Gemeinschaft, die soziale Kontrolle und der Schutz vor Gefahren gehören zu den grundlegenden Funktionen der Tabus.
2.2. Was ist ein Tabu? - Tabus im engeren Sinn -
Matthis Kepser kategorisiert Tabus8 im engeren Sinne als…
- …Religiöse Tabus (Missachtung von religiösen Symbolen und Plätzen)
- …Eigentums-Tabus (Diebstahl, Gespräche über Einkommen und Besitz)
[...]
1 Luhmann, Niklas: „Soziologische Aufkl ä rung 1: Aufs ä tze zur Theorie sozialer Systeme Soziologische Aufkl ä rung 1 “ , VS Verlag für Sozialwissenschaften; Auflage: 7. A., 2005: S. 118
2 Müller-Michaels, Harro: „ Tabus in Lebenswelten u. Literatur “, in: „ Deutschunterricht “, Jg. 57 (2004), H. 5: „ Tabu “: S. 6
3 Kepser, Matthis: „ Wo sind die Grenzen? Der Tabudiskurs in den Medien und seine Bedeutung f ü r den Deutschunterricht “. In: Jonas, Hartmut; Josting, Petra (Hrsg.): „Medien im Deutschunterricht 2004 “ . Jahrbuch, München, Kopaed 2005: S. 38
4 In diesem Zusammenhang wird häufig der Begriff „political correctness“ benutzt, vgl. dazu: Kraft, Helmut: „Tabu. Magie und soziale Wirklichkeit “, Düsseldorf, Walter 2004: S. 17-31
5 Die Frage „ Was soll ich tun? “ gehört zu den Grundfragen der Philosophie. Die Moral gibt auf diese Frage Antworten. Die Ethik versucht die Moral zu hinterfragen (Moralphilosophie) .
6 Vgl. hierzu: Foucault, Michel: „Die Anormalen. Vorlesungen am Coll è ge de France (1974-1975)“, Frankfurt am Main, Suhrkamp 2003
7 So bezeichnet z.B. Jakob Pastötter (Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung) Jugendliche, die Pornografie konsumieren, als „sozial - “ und „sexuell verwahrlost“, vgl.: Neudecker, Siegrid: „ Zwischen Porno und erster Liebe “, In: „ DIE ZEIT - WISSEN “, Nr. 3, März/April 2009: S. 24
8 vgl. Kepser, 2005: S. 40
- Quote paper
- Udo Lihs (Author), 2009, Schweigen oder Aufklärung? Tabus und Tabubrüche in den neuen Medien im Deutschunterricht , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138004