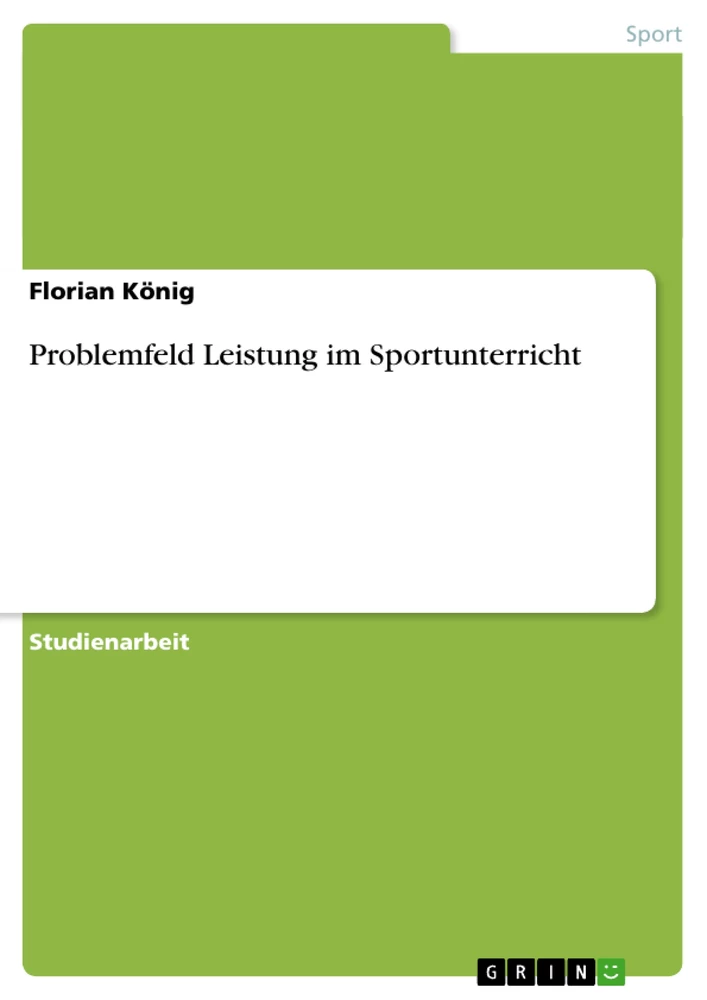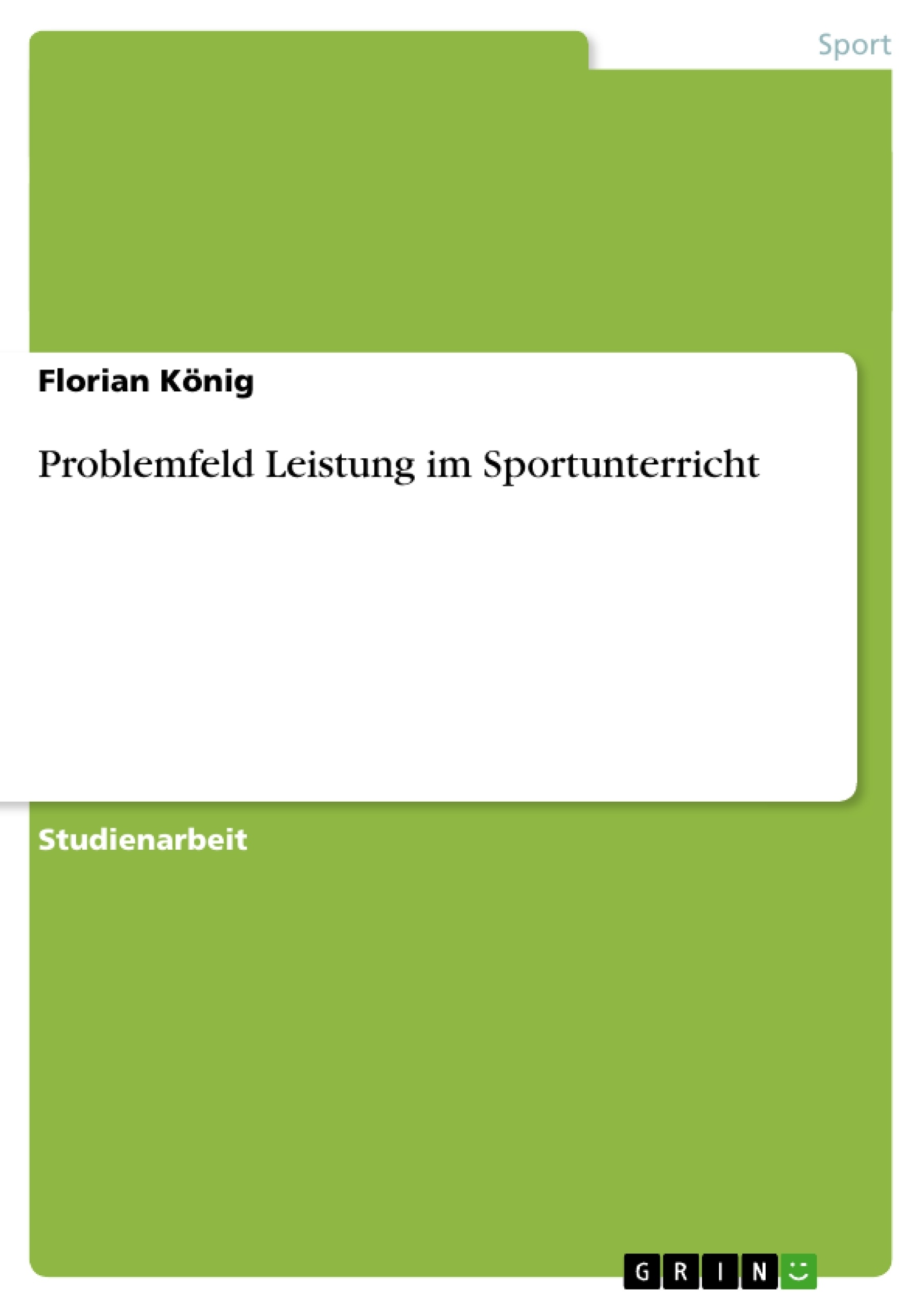In den letzten Jahren wurden wiederholt heftige Debatten über einen
zeitgemäßen Sportunterricht geführt. Jedoch wurde keine Diskussion
kontroverser geführt, als über die der "Leistung" bzw. des "Leistungsprinzips".
Als eine der Hauptforderungen der Leistungskritiker gilt die Abschaffung der
Notengebung im Schulsport, um den negativen Effekten der sogenannten
Leistungsgesellschaft entgegenzuwirken. So wird von ihnen eine
Prioritätenverschiebung weg vom Leistungsprinzip und hin zur freudbetonten
Sport- und Bewegungserziehung angeregt und angesichts des stetig
wachsenden Bewegungsmangels und falscher Ernährung bei Kindern und
Jugendlichen zunehmend nach Alternativen gesucht, um einem
Bewegungshandeln im Sportunterricht vor allem ohne Leistungsdruck
nachzugehen. Deswegen fordern sie beispielsweise Bewegungs- und
Spielformen, welche Kooperation sowie freudvolles Bewegen unterstützen und
fördern, ohne dass die Schüler dem üblichen Notendruck ausgesetzt sind. Als
Beweis dafür lassen sich die sogenannten Trendsportarten (Fun-Sportarten)
anführen, die vermehrt den "großen" traditionellen Sportarten Leichtathletik,
Schwimmen, Fußball, Handball, Gerätturnen den Rang in der Gestaltung des
Sportunterrichts abgelaufen. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Ambivalenz der Leistung
3. Leistungsbewertung im Sportunterricht
3.1. Argumente , iir Noten im Schulsport
3.2. Versuch der Entwicklung eines Leit , adens zur di ,, erenzierten Leistungsermittlung und Notengebung im Schulsport
4. Fazit
5. Bibliographie
1. Einleitung
In den letzten Jahren wurden wiederholt heftige Debatten iiber einen zeitgemäBen Sportunterricht gefiihrt. Jedoch wurde keine Diskussion kontroverser gefiihrt, als iiber die der "Leistung" bzw. des "Leistungsprinzips".1 Als eine der Hauptforderungen der Leistungskritiker gilt die Abschaffung der Notengebung im Schulsport, um den negativen Effekten der sogenannten Leistungsgesellschaft entgegenzuwirken. So wird von ihnen eine Prioritätenverschiebung weg vom Leistungsprinzip und hin zur freudbetonten Sport- und Bewegungserziehung angeregt und angesichts des stetig wachsenden Bewegungsmangels und falscher Ernährung bei Kindern und Jugendlichen zunehmend nach Alternativen gesucht, um einem Bewegungshandeln im Sportunterricht vor allem ohne Leistungsdruck nachzugehen. Deswegen fordern sie beispielsweise Bewegungs- und Spielformen, welche Kooperation sowie freudvolles Bewegen unterstiitzen und fördern, ohne dass die Schiiler dem iiblichen Notendruck ausgesetzt sind. Als Beweis dafiir lassen sich die sogenannten Trendsportarten (Fun-Sportarten) anfiihren, die vermehrt den "groBen" traditionellen Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, FuBball, Handball, Gerätturnen den Rang in der Gestaltung des Sportunterrichts abgelaufen.
Doch lassen sich solche Forderungen realisieren und sind sie mit den generellen Vorstellungen von Unterricht und den speziellen Zielen des Faches Sport wirklich vereinbar? Diese und weitere Fragen hinsichtlich des Problemfeldes "Leistung" im Sportunterricht sollen im Mittelpunkt der folgenden Ausfiihrungen stehen. Zudem sollen Lösungsansätze zur Leistungsbewertung im Sportunterricht gegeben werden.
2 . Die Ambivalenz der Leistung
Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, ist vor allem der Begriff der Leistung im Kontext von sportpädagogischen Auseinandersetzungen umstritten. Ursächlich dafiir ist der ambivalente Charakter dieses Begriffes, denn sportliche Leistungen können neben positiven durchaus auch negative Wirkungen auf die Schiiler haben (vgl. Uni Bielefeld Internet???). Auf der einen Seite können sie das Selbstwertgef5hl eines SchUlers statzen, es jedoch andererseits auch beeintrachtigen. Zum Beispiel wird ein Schuler der hervorragende sportliche Leistungen in den leichtathletischen Disziplinen Weitsprung und Ausdauerlauf oder im Schwimmen erbringt, mit groBer Wahrscheinlichkeit mehr von seinen MitschUler und auch von seinem Sportlehrer anerkannt. Er f5hlt dadurch ein gesteigertes Selbstwertgef5hl sowie weitere Motivation fir zukünftiges sportliches Handeln. Sein Klassenkamerad, der eine schlechte sportliche Leistung erbracht hat, beispielsweise ist er im 1000-m-Rennen Unterlegener, wird hingegen einen Motivationsverlust sowie eine negative Wirkung auf sein Selbstwertgefiihl erfahren. Die Leistungserwartungen, die im Sportunterricht an die Schiller gestellt werden, können demnach positive als auch negative Effekte auf diese haben. Der ambivalente Charakter der Leistung kann zudem noch anhand der individuellen anthropogenen Voraussetzungen der Schiller verdeutlicht werden. Wenn in der Klassenstufe 9 ein 1,80m groBer Schuler im Hochsprung 1,35m springt, dann wird seine Leistung als sehr gut eingeschatzt, die Sprunghöhe von 1,20 eines 1,50m groBen SchUlers wird jedoch nur als befriedigend bewertert. Aus diesen Ausfiihrungen wird also deutlich, dass die Ambivalenz der Leistung als padagogische Herausforderung gesehen wird, deren negative motivationalen und das Selbstwertgef5hl betreffenden Effekte von den Kritikern als Ansatzpunkt fir ihre Forderung nach Abschaffung einer Leistungsbewertung angef5hrt werden. Doch sind diese Argumente wirklich fir die Abschaffung von Noten im Sportunterricht ausreichend?
3 . Leistungsbewertung im Sportunterricht
3.1. Argumente fair Noten im Sportunterricht
Nun soll kurz auf zentrale Argumente fir die Beibehaltung der Notengebung im Sportunterricht eingegangen werden, die ermöglichen sollen die Forderungen der Bef5rworter der Abschaffung von Sportnoten abschwachen. Das gröBtes Problem, welches eine Abschaffung der Sportnote zur Folge hate, ware die dadurch erzeugte Sonderstellung des Unterrichtsfaches innerhalb des schulischen Facherkanons.
[...]
1 vgl. Ausfiihrungen des Thiir. Institut fiir Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien [http://www.thillm.de/thillm/abs/kumusfsp/sport/sport_index.html].
- Quote paper
- Florian König (Author), 2009, Problemfeld Leistung im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137977