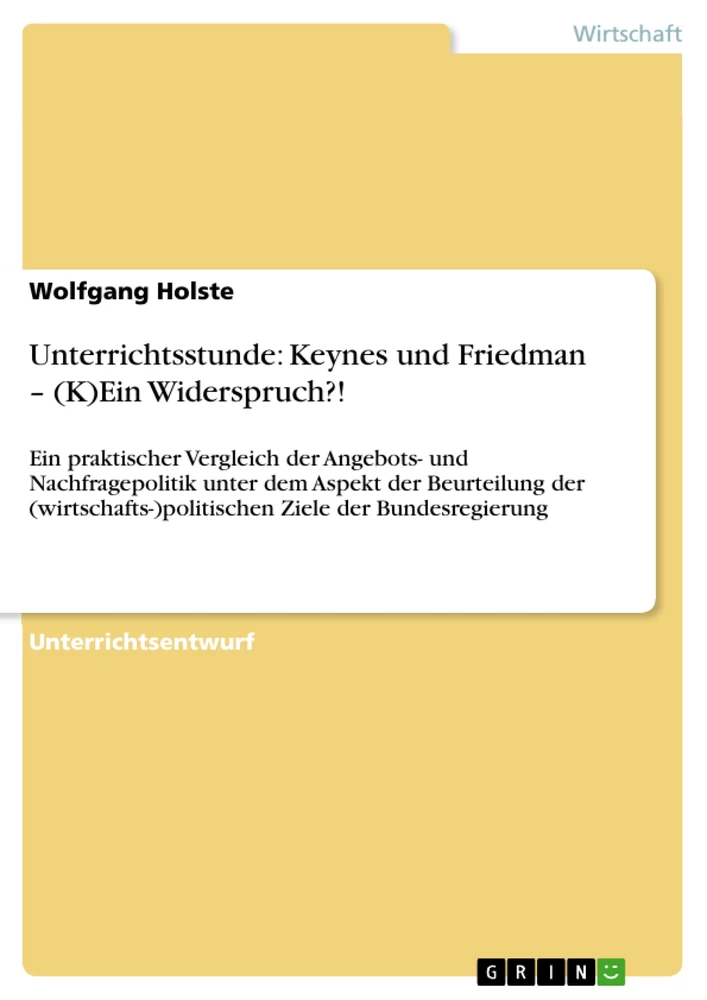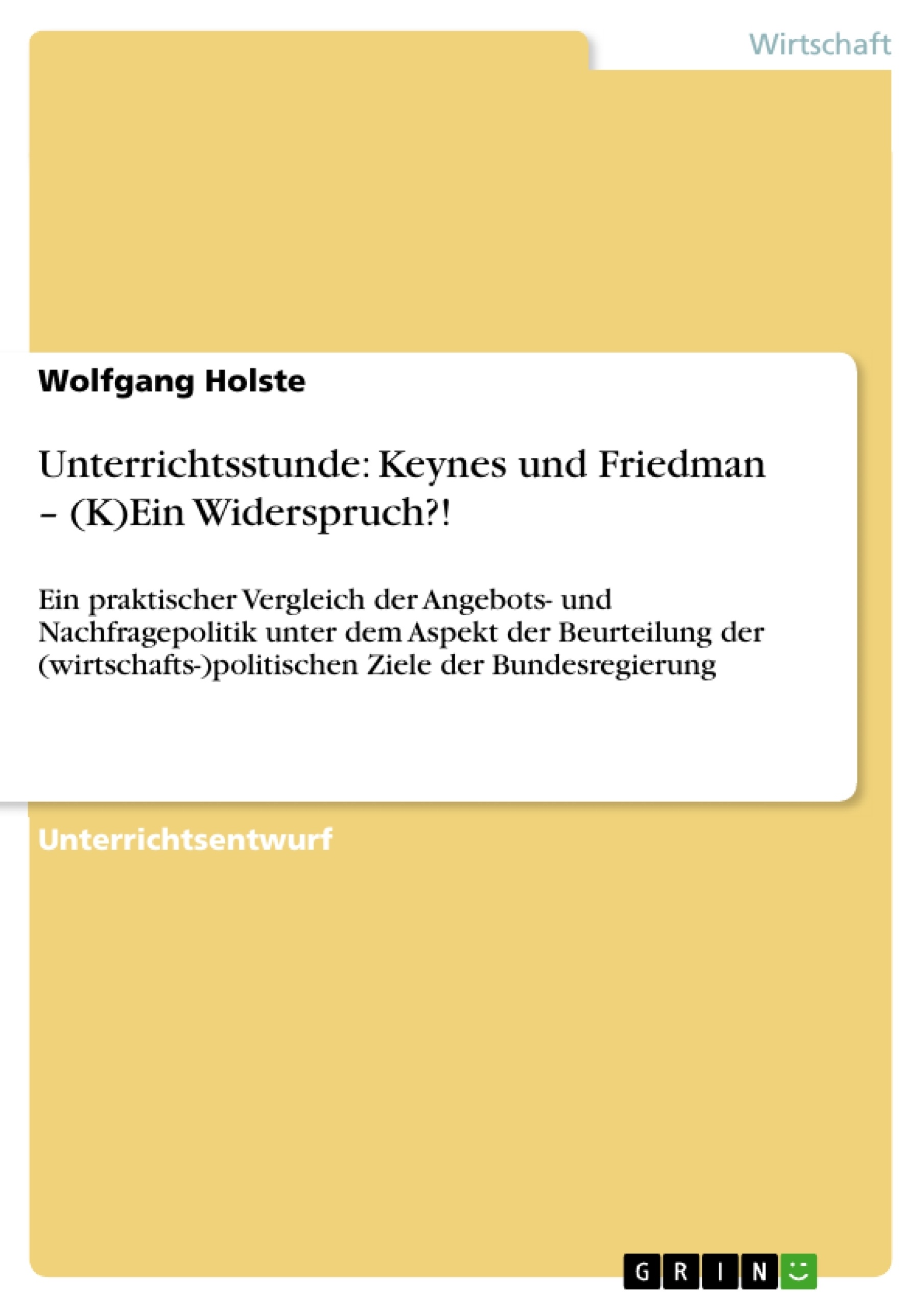Die SuS sollen analysieren, ob und inwieweit Instrumente der Angebots- bzw. Nachfrageorientierung praktischen Einzug in die bundesdeutsche Wirtschaftspolitik gefunden haben, indem sie unter Zuhilfenahme ihrer Hausaufgabenergebnisse die in der Regierungserklärung formulierten wirtschaftspolitischen Ziele und Maßnahmen den beiden Konzepten zuordnen und im Kugellagerverfahren den momentanen Stellenwert bzw. die (Un-)Vereinbarkeit beider Strategien erörtern.
Thema der Unterrichtsstunde:
Keynes und Friedman?! – (K)Ein Widerspruch?! – Ein praktischer Vergleich der Angebots- und Nachfragepolitik unter dem Aspekt der Beurteilung der (wirtschafts-)politischen Ziele der Bundesregierung.
Reihenziel:
Die SuS sollen allgemeines und exemplarisches Deutungs- und Ordnungswissen über Theorien bzw. die Entwicklung der Wirtschaft(spolitik) erwerben, diese Kenntnisse bei der Analyse gesellschaftlicher Tatbestände und Probleme anwenden sowie kritisch hinsichtlich ihrer Reichweite beurteilen.
Stundenziel:
Die SuS sollen analysieren, ob und inwieweit Instrumente der Angebots- bzw. Nachfrageorientierung praktischen Einzug in die bundesdeutsche Wirtschaftspolitik gefunden haben, indem sie unter Zuhilfenahme ihrer Hausaufgabenergebnisse die in der Regierungserklärung formulierten wirtschaftspolitischen Ziele und Maßnahmen den beiden Konzepten zuordnen und im Kugellagerverfahren den momentanen Stellenwert bzw. die (Un-)Vereinbarkeit beider Strategien erörtern.
Teillernziele:
TLZ 1: Die SuS sollen für das Problem der (Un-)Vereinbarkeit der Nachfrage- und Angebotstheorie sensibilisiert werden, indem sie eine Karikatur beschreiben und die verfremdeten Stilelemente interpretieren. (AFB I/II)
TLZ 2: Die SuS sollen einen Sachtext kriterienorientiert erschließen, indem sie je nach Neigung in Einzel- oder Partnerarbeit Auszüge der Regierungserklärung auf nachfrage- und angebotsorientierte Instrumente und Ziele hin analysieren. (AFB II)
TLZ 3: Die SuS sollen erörtern, inwieweit ein „policy mix“ beider Konzeptionen bzw. ein extremes „Entweder/Oder“ als praktikabel erscheint, indem sie in einer Kugellager-Debatte begründet Stellung beziehen. (AFB III)
Einbettung der Stunde in die Unterrichtsreihe:
1. UE: Wie misst und vergleicht man Wirtschaftskraft?! – Eine „Fishbowl“ zur Sammlung
und Bewertung von Indikatoren zur wohlfahrtsökonomischen Gesamtbilanzierung
2. UE: Das BIP – (K)ein gesamtgesellschaftlicher Wohlstandsindikator?! – Zum qualitativen
und quantitativen Verhältnis von Berechnung, Verwendung und Verteilung des BIP`s
3. UE: Reales vs. nominales Bruttoinlandsprodukt – Welchen Einfluss hat die
Preisentwicklung auf den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand? – Eine soziologische
Betrachtung der Entwicklung der Realeinkommen in der BRD
4. UE: Der Konjunkturverlauf – Willkürliches Zick-Zack oder regelmäßiges Auf und Ab?! –
Erarbeitung des Konjunkturzyklus anhand der prozentualen Entwicklung des BIP`s
5. UE: Die Entwicklung von Wachstum und Konjunktur – Welche Ursachen führen zu
Konjunkturschwankungen?!
6. UE: Dynamik und Krise – Ein unüberwindbarer Gegensatz der Marktwirtschaft?!
7. UE: „Berechnen“ oder „prophezeien“ Ökonomen die wirtschaftliche Zukunft?! –
Erarbeitung und Beurteilung von Frühindikatoren anhand eines Planspiels
8. UE: Welche Ziele soll sich die staatliche Wirtschaftspolitik setzen – und welche nicht?! –
Eine Lernspirale zu wirtschaftspolitischen Aufgaben der Regierung
9. UE: Das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft – Wie
verpflichtend sind qualitative Zielformulierungen?!
10. UE: Stabilität und Wachstum oder Stabilität oder Wachstum? – (K)Ein „magisches
Viereck“?! – Erarbeitung und Beurteilung von Zielkonkurrenzen sowie der
derzeitigen (wirtschafts-)politischen Prioritätensetzung
11. UE: Vom magischen Viereck zum magischen Vieleck – Eine Pro-Contra-Debatte über
den Sinn und Zweck der Aufnahme des Ziels einer Umverteilung von Einkommen
und Vermögen in das StWG
12. UE: Mit Ökonomie zur Ökologie?! – Zum Verhältnis von Wachstumspolitik und
Umweltschutz
13. UE: Wo soll Wirtschaftspolitik (nicht) ansetzen?! – Ein Ökonomie-Entscheidungsspiel zu
Leistungen und Fehlleistungen staatlicher Interventionen
14. UE: Adam Smith und der klassische Wirtschaftsliberalismus – Eine Befreiung (und für
wen)?!
15. UE: John Maynard Keynes und die Nachfragetheorie – (K)Eine fiskalische Antwort auf
(Welt-)Wirtschaftskrisen?!
16. UE: Milton Friedman und der angebotsorientierte Neo-Liberalismus – Ist die Geldmenge
die zentrale Steuerungsvariable?!
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
18. UE: Welche Rolle soll der Staat im Wirtschaftsablauf spielen?! – Ein Streitgespräch als
Rollenspiel zwischen verschiedenen Parteien und Interessenverbänden
19. UE: Klausur
Didaktisch-methodischer Kommentar:
Diese Unterrichtsreihe wurde entsprechend dem obligatorischen Fachinhalt des schulinternen Curriculums für das erste Quartal der Jahrgangsstufe 12 konzipiert, wobei im Leistungs- als auch im Grundkurs das Inhaltsfeld IV „Wirtschaftspolitik“ des Lehrplanes Sozialwissenschaften (vgl. MSWWF NRW 1999, 23) als übergeordnetes Unterrichtsthema vorgesehen ist. Der zweite Teil der Unterrichtsreihe konzentriert sich dabei bewusst auf die großen Linien der Theorieentwicklung der Wirtschaftswissenschaft und bindet sie jeweils in den historischen Entstehungszusammenhang ein. Der Begriff „Wirtschaftstheorien“ führt jedoch viele Menschen zu Assoziationen, die sie nicht zur Beschäftigung mit diesem Thema anregen. Doch hinter der etwas spröden Fassade des Begriffs stecken – mehr denn je – Modelle, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Welt genommen haben und nehmen und deren Anregungen unser alltägliches Leben daher in ungeahnter Weise beeinflussen.
Um den SuS die aktuelle praktische Relevanz dieser historisch-theoretischen Konzepte nahe zu bringen, bin ich so vorgegangen, die Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel auf wesentliche Punkte zu kürzen, die von den SuS unter dem Aspekt der Nachfrage- oder Angebotsorientierung analysiert werden. Die aus dem Jahre 2005 stammende Mitschrift entspricht dabei in besonderer Weise dem Aktualitätsprinzip, da die darin skizzierten Maßnahmen zumeist noch in dieser Legislaturperiode in die Praxis umgesetzt werden und daher gerade die mittlerweile (bundestags-)wahlberechtigten sowie in naher Zukunft in die Arbeitswelt eintretenden SuS der Jahrgangsstufe 12 betreffen. Insofern gehe ich davon aus, dass sich dieser Bezug zur Lebenswelt der SuS nach dem didaktischen Prinzip der Kontextorientierung positiv auf die Motivation des ohnehin sehr lernwilligen und leistungsstarken Kurses auswirkt. Dazu dient ebenfalls der Impuls über eine Karikatur, deren didaktisches Potenzial aus den Anstößen resultiert, die notwendigerweise weitergedacht werden müssen, und so den problemorientierten Einstieg in die systematische Analyse eröffnen (vgl. Kuhn 2004, 27).
Diese Analyse ermöglicht es nicht nur, den aktuellen Stellenwert beider Theorien in der bundesdeutschen (Regierungs-)Politik begründet einzuschätzen, sondern dient ebenfalls als Indikator, ob und inwieweit die SuS in der Lage sind, zwischen diesen beiden in den vorherigen Unterrichtseinheiten erarbeiteten Ansätzen zu differenzieren. Um diese für den weiteren Stundenverlauf unerlässliche Fähigkeit zu gewährleisten, können die SuS bei der Erarbeitung zum einen auf ihre Hausaufgabenergebnisse zurückgreifen und sich zum anderen bei inhaltlichen Unklarheiten mit ihren freiwilligen PartnerInnen verständigen. Bei der Zuordnung der einzelnen Ziele zu den beiden auch in der Wirtschaftspolitik kontrovers diskutierten Grundkonzeptionen – die sich daher für einen problemorientierten und diskursiven (Sozialwissenschafts-) Unterricht geradezu idealtypisch eignen – erwarte ich jedoch in Anbetracht des hohen Anspruchsniveaus, dass sich die SuS bei der Differenzierung der z.T. nicht trennscharfen Maßnahmen sehr schwer tun. Um diese antizipierten Unklarheiten angemessen zu klären, werden in der folgenden Sicherungsphase die Ergebnisse der SuS tabellarisch zugeordnet und erläutert. Dazu bietet es sich an, mittig eine dritte Spalte für diejenigen Ziele freizulassen, die sowohl der Angebots- als auch der Nachfrageseite zugeordnet werden können. Als Ergebnis sollte für die SuS ersichtlich sein, dass die Mehrzahl der Maßnahmen auf die Förderung der Angebotsseite abzielen, jedoch auch einige Instrumente auf eine Verbesserung der Kaufkraft der Arbeitnehmer. Für die übergeordnete Problemstellung bedeutet dies, dass beide Theorien in Folge ihrer unterschiedlichen Akzentsetzung im Wesen zwar unvereinbar sind, eine allzu einseitige Ausrichtung jedoch nicht zweckmäßig ist, da sich die Ursachenskala wirtschaftlicher Schwankungen nicht einseitig auf die Angebots- oder Nachfrageseite beschränken lässt, was letztlich den durch die SuS nachgewiesenen praktischen „policy mix“ erfordert.
Dieser Zusammenhang dient dabei sowohl als kontroverser Aufhänger, als auch als inhaltliches Lernziel für die anschließende Vertiefung. Daneben kommt es mir in dieser Phase verstärkt darauf an, dass die SuS untereinander ins Gespräch finden und ohne große Lehrerlenkung zielgerichtet und kontrovers diskutieren sowie nach dem dritten Beutelsbacher Konsenssatz (vgl. MSWF NRW 2001, 26) entsprechend ihrer eigenen Interessenlage beurteilen. Zu diesem Zweck und in Anbetracht der geringen Kursgröße von nur 16 SuS eignet sich das Kugellager-Verfahren. Dabei haben insbesondere die in Unterrichtsgesprächen z.T. sehr stillen und zurückhaltenden Mädchen des Kurses die Möglichkeit, sich stärker in das Unterrichtsgeschehen einzubringen. Diese auf eine „diskursive und dialogische Verständigung“ (Weißeno 2004, 51) ausgelegte Aktionsform fördert zudem die im Lehrplan formulierte Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbstständig und kreativ, engagiert und konsequent mit unterschiedlichen Theorien und Erklärungsversuchen auseinander zu setzen (vgl. MSWWF NRW 1999, 8). Der Kugellager-Diskussion, bei der die SuS abwechselnd reden und zuhören, kommt daher die Funktion eines Ortes „gemeinsamen Problemlösens und diskursiver Verständigung“ (Massing 2005, 502) zu, was letztlich Eschenburgs Zielvorstellung eines oberstufengemäßen Sozialwissenschaftsunterrichts entspricht, durch den die SuS „reflektierte Zuschauer“ werden sollen, die politische und ökonomische Vorgänge selbstständig untersuchen und beurteilen können (vgl. Breit/ Weißeno 2004, 53).
[...]
- Quote paper
- Wolfgang Holste (Author), 2007, Unterrichtsstunde: Keynes und Friedman – (K)Ein Widerspruch?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137892