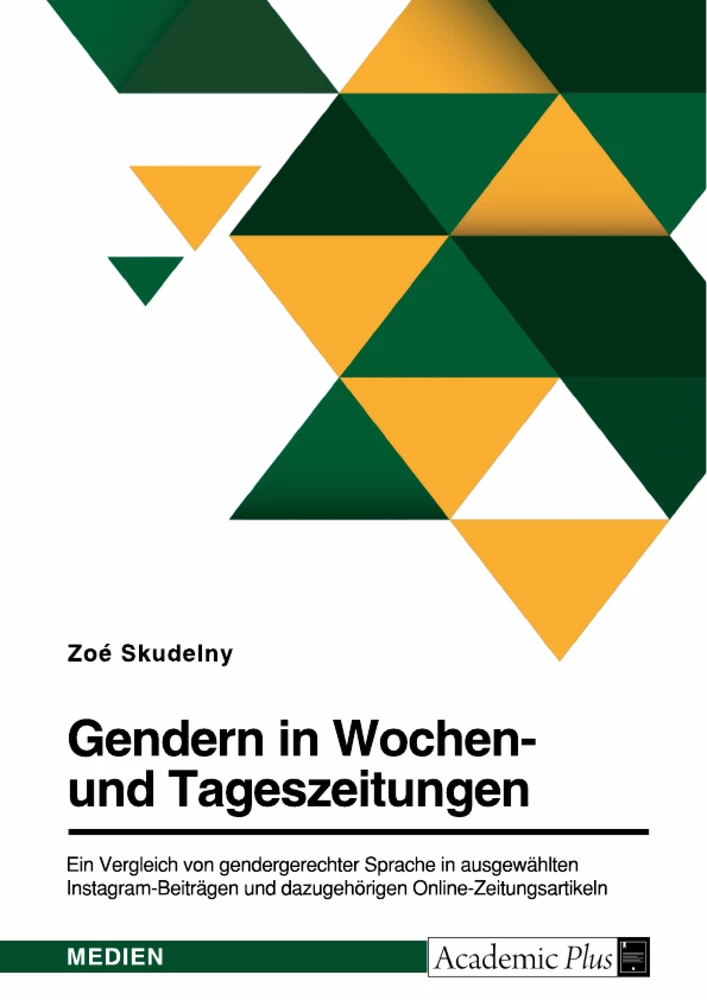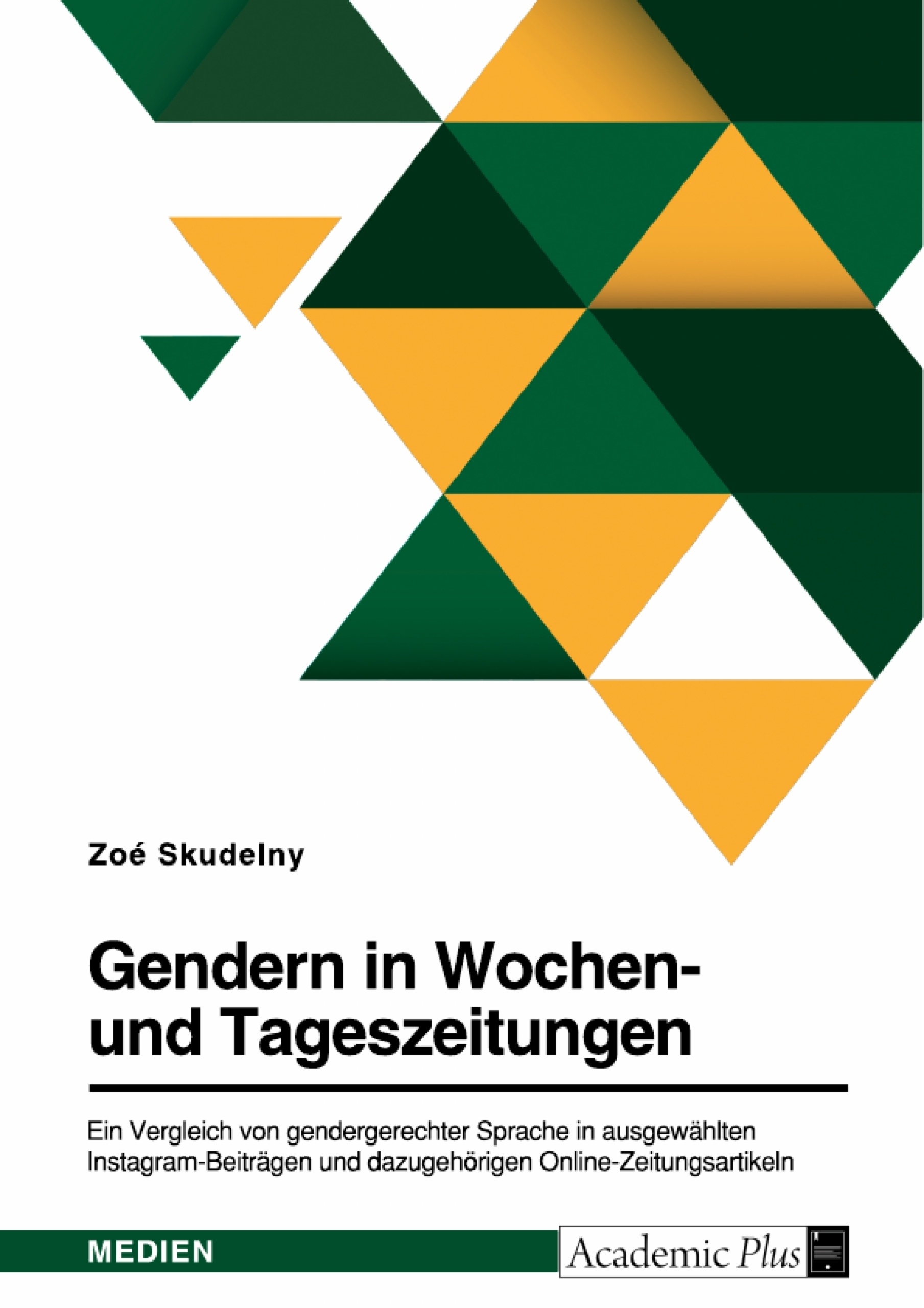In dieser Arbeit wurde untersucht, inwieweit in Tages- und Wochenzeitungen gendergerechte Sprache in ausgewählten Instagram-Beiträgen und dazugehörigen Online-Zeitungsartikeln veröffentlicht wurde und was die Gründe für eventuelle Unterschiede sind. Im Zuge der zufälligen Feststellung, dass eine Zeitung auf der Plattform Instagram gendergerechte Sprache verwendet, in dem dazugehörigen Zeitungsartikel auf der Website jedoch nicht mehr, entstand daraus die folgende Forschungsfrage, welche mit dieser Arbeit beantwortet werden soll: Inwieweit nutzen ausgewählte Wochen- und Tageszeitungen aus Deutschland gendergerechte Sprache in Instagram-Beiträgen und den dazugehörigen Online-Zeitungsartikeln?
Die Diskussion um gendergerechte Sprache führte in den letzten Jahren zu einem medial potenzierten Diskurs. Es gibt inzwischen sogar Hinweise darauf, dass Medien für ein jüngeres Publikum experimentierfreudiger sind, wohingegen große Tages- und Wochenzeitungen hingegen Wortzusätze meist ablehnen. Damit stellt sich die Frage, inwieweit Zeitungen sich hinsichtlich der Verwendung gendergerechter Sprache ihrer Zielgruppe anpassen. Trotz Aktualität der Thematik gibt es kaum Erforschungen von der Nutzung gendergerechter Sprache in adressatenspezifischen Medienmitteilungen. Demzufolge gibt es auch noch keine empirischen Erkenntnisse, inwieweit oder auch warum gendergerechte Sprache in den Medien verwendet wird.
In der zunehmend ausdifferenzierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wird das Internet als Informationsinstrument mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt. Auch Redaktionen haben diesen Umstand erkannt und bieten auf ihren Internetseiten Zeitungsartikel online zum Lesen an. Aufgrund des weiter steigenden Stellenwerts des Internets gewinnen Online-Artikel zunehmend an Bedeutung, um auch jüngere Zielgruppen anzusprechen. Um neue InteressentInnen für eine Zeitung oder einen bestimmten Artikel zu gewinnen, wird mittlerweile von vielen Tages- und Wochenzeitungen die Plattform „Instagram“ genutzt. Mithilfe dieser können Zeitungen Werbung für entsprechende Artikel machen. Dies funktioniert so, indem ein sogenannter Teaser zu dem Website-Artikel mit einer kurzen Beschreibung des Artikels gegeben wird. Die potenzielle Zielgruppe bekommt so einen kurzen Einblick in den Inhalt des Artikels und kann sich dann entscheiden, ob sie einem externen Link auf die Website der Zeitung folgen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Theoretischer Teil
- Sprachliche Grundlagen
- Begriffliche Grundlagen
- Geschlechtergerechte Sprache
- Historischer Abriss
- Grammatisches Geschlecht
- Semantisches Geschlecht
- Generisches Maskulinum
- Rechtliche Grundlagen
- Warum geschlechtergerecht formulieren
- Geschlechtergerechtes Formulieren in der Praxis
- Paarformel und Doppelnennung
- Sparschreibungen und Kurzformen
- Klammerlösung
- Gendergap und Gendersternchen
- Ersatzformen
- Weitere kreative Lösungen
- Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung
- Geschlechtergerechtes Formulieren in (geschriebenen) Medienmitteilungen
- Instagram als Plattform für Zeitungen
- Funktionsweise und Aufbau von Instagram
- Journalistische Inhalte auf Instagram
- Gendern und Sprachgebrauch in journalistischen Online-Inhalten
- II Empirischer Teil
- Zielsetzung und Fragestellung der vorliegenden Arbeit
- Methodisches Vorgehen
- Auswahl der Vergleichskriterien
- Stichprobe
- Durchführung
- Vorgehensweise bei der Auswertung
- Ergebnisse
- Darstellung der Ergebnisse
- Ergebnisse der Analyse von Instagram-Beiträgen
- Ergebnisse der Analyse von Online-Zeitungsartikeln
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung gendergerechter Sprache in Medienmitteilungen, indem sie einen Vergleich zwischen Instagram-Beiträgen und Online-Zeitungsartikeln deutscher Medien vornimmt. Ziel ist es, die Präsenz und die verschiedenen Formen der gendergerechten Sprache in diesen beiden Medien zu analysieren und Unterschiede aufzuzeigen.
- Verwendung gendergerechter Sprache in Online-Medien
- Vergleich der Genderpraktiken auf Instagram und in Online-Zeitungsartikeln
- Analyse verschiedener Formen der geschlechtergerechten Sprache
- Untersuchung der Verbreitung gendergerechter Sprache in den ausgewählten Medien
- Identifizierung von Unterschieden im Sprachgebrauch beider Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der gendergerechten Sprache in Medienmitteilungen ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf den Vergleich von Instagram-Beiträgen und Online-Zeitungsartikeln. Sie skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Untersuchung.
I Theoretischer Teil: Sprachliche Grundlagen: Dieser Teil bietet einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen der gendergerechten Sprache. Er beleuchtet begriffliche Grundlagen, den historischen Abriss der Entwicklung verschiedener Genderformen, das grammatische und semantische Geschlecht, sowie das generische Maskulinum. Darüber hinaus werden rechtliche Grundlagen und die Gründe für die Verwendung gendergerechter Sprache diskutiert. Es werden verschiedene Formen des gendergerechten Formulierens, wie Paarformel, Doppelnennung, Sparschreibungen (Klammerlösung, Gendergap, Gendersternchen etc.), und kreative Alternativen (generisches Femininum, X-Endung etc.) detailliert erklärt und mit Beispielen versehen. Abschließend werden die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung eines fundierten Wissenschaftshintergrundes für die empirische Untersuchung.
I Theoretischer Teil: Geschlechtergerechtes Formulieren in (geschriebenen) Medienmitteilungen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse im Kontext von Medienmitteilungen. Er untersucht Instagram als Plattform für Zeitungen, analysiert die Funktionsweise und den Aufbau von Instagram und beleuchtet den Umgang mit journalistischen Inhalten auf dieser Plattform. Besonders relevant ist die Untersuchung von Gendern und Sprachgebrauch in journalistischen Online-Inhalten, um den Rahmen für die spätere empirische Analyse zu schaffen. Der Teil legt den Fokus auf die Spezifika von Online-Kommunikation im Vergleich zur traditionellen Presse.
II Empirischer Teil: Zielsetzung und Fragestellung der vorliegenden Arbeit: Dieser Teil formuliert die konkrete Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit. Es wird präzise dargelegt, welche Aspekte der gendergerechten Sprache untersucht werden und welche Vergleichskriterien angewendet werden.
II Empirischer Teil: Methodisches Vorgehen: Hier wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Es wird erläutert, wie die Stichprobe ausgewählt wurde, welche Vergleichskriterien herangezogen wurden, wie die Datenerhebung stattfand und welche Vorgehensweise bei der Auswertung der Daten zum Einsatz kam. Die methodische Transparenz soll die Nachvollziehbarkeit und die Validität der Ergebnisse gewährleisten.
Schlüsselwörter
Gendergerechte Sprache, Medienmitteilungen, Instagram, Online-Zeitungsartikel, Vergleich, Genderformen, Sprachgebrauch, Empirische Analyse, Journalismus, Online-Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gendergerechte Sprache in Medienmitteilungen - Ein Vergleich von Instagram und Online-Zeitungsartikeln
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung gendergerechter Sprache in Online-Medien, speziell im Vergleich von Instagram-Beiträgen und Online-Zeitungsartikeln deutscher Medien. Der Fokus liegt auf der Analyse der Präsenz und der verschiedenen Formen gendergerechter Sprache in diesen beiden Medien und dem Aufzeigen von Unterschieden.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Verwendung gendergerechter Sprache in Online-Medien zu analysieren und die Unterschiede zwischen Instagram und Online-Zeitungsartikeln aufzuzeigen. Es werden verschiedene Formen gendergerechter Sprache untersucht und deren Verbreitung in den ausgewählten Medien verglichen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil beleuchtet die sprachlichen und rechtlichen Grundlagen gendergerechter Sprache sowie verschiedene Formen des gendergerechten Formulierens. Der empirische Teil beschreibt die Methodik der Untersuchung, die Stichprobenauswahl, die Datenerhebung und die Auswertung der Daten, um die Ergebnisse transparent und nachvollziehbar darzustellen.
Welche Aspekte der gendergerechten Sprache werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Formen gendergerechter Sprache, wie Paarformeln, Doppelnennungen, Sparschreibungen (Klammerlösung, Gendersternchen etc.) und kreative Alternativen. Sie untersucht deren Verwendung und Verbreitung in Instagram-Beiträgen und Online-Zeitungsartikeln.
Wie wird der Vergleich zwischen Instagram und Online-Zeitungsartikeln durchgeführt?
Der Vergleich zwischen Instagram und Online-Zeitungsartikeln erfolgt anhand ausgewählter Vergleichskriterien, die im methodischen Teil der Arbeit detailliert beschrieben werden. Die Ergebnisse der Analyse werden in Form einer Darstellung und Interpretation präsentiert, um Unterschiede im Sprachgebrauch beider Medien aufzuzeigen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Analyse werden getrennt für Instagram-Beiträge und Online-Zeitungsartikel dargestellt und anschließend zusammengefasst und interpretiert. Die Interpretation der Ergebnisse zielt darauf ab, die Unterschiede im Sprachgebrauch beider Medien im Hinblick auf die Verwendung gendergerechter Sprache zu erklären.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Verwendung gendergerechter Sprache in den untersuchten Medien. Es werden mögliche Erklärungen für die festgestellten Unterschiede im Sprachgebrauch diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Gendergerechte Sprache, Medienmitteilungen, Instagram, Online-Zeitungsartikel, Vergleich, Genderformen, Sprachgebrauch, Empirische Analyse, Journalismus, Online-Kommunikation.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Der theoretische Teil der Arbeit behandelt begriffliche Grundlagen, den historischen Abriss der Entwicklung verschiedener Genderformen, grammatisches und semantisches Geschlecht, das generische Maskulinum, rechtliche Grundlagen, Gründe für gendergerechtes Formulieren und verschiedene Formen gendergerechten Formulierens (Paarformel, Doppelnennung, Sparschreibungen, kreative Alternativen) sowie die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert. Der theoretische Teil umfasst die sprachlichen und rechtlichen Grundlagen sowie die Anwendung gendergerechter Sprache in Medienmitteilungen, insbesondere auf Instagram und in Online-Zeitungsartikeln. Der empirische Teil beinhaltet die Zielsetzung, das methodische Vorgehen, die Ergebnisse und das Fazit der Untersuchung.
- Quote paper
- Zoé Skudelny (Author), 2022, Gendern in Wochen- und Tageszeitungen. Ein Vergleich von gendergerechter Sprache in ausgewählten Instagram-Beiträgen und dazugehörigen Online-Zeitungsartikeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1378360