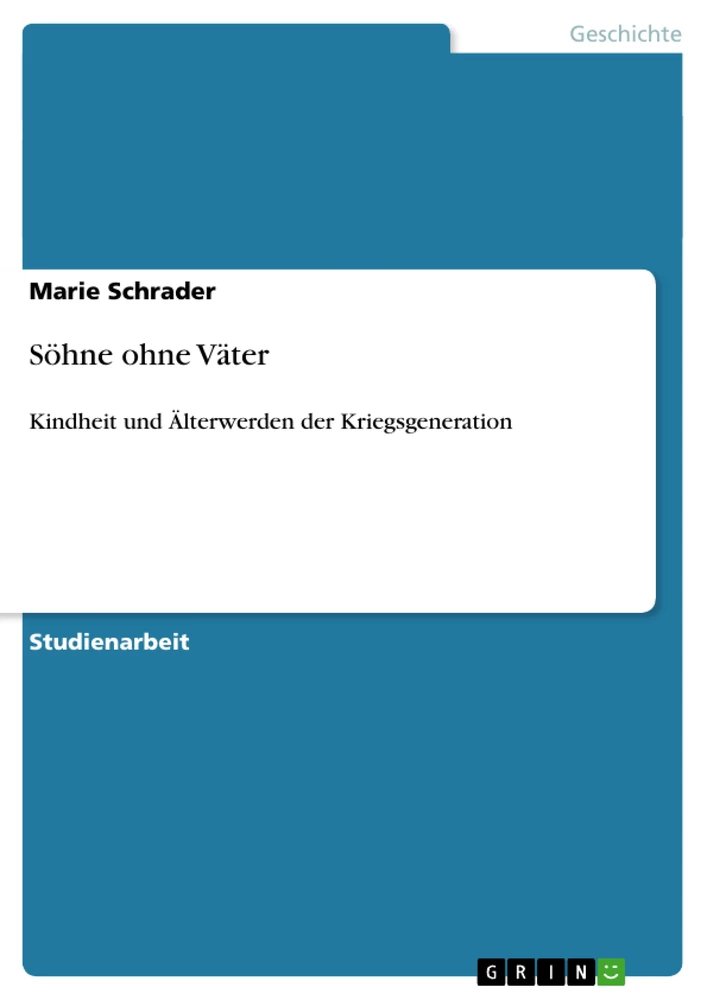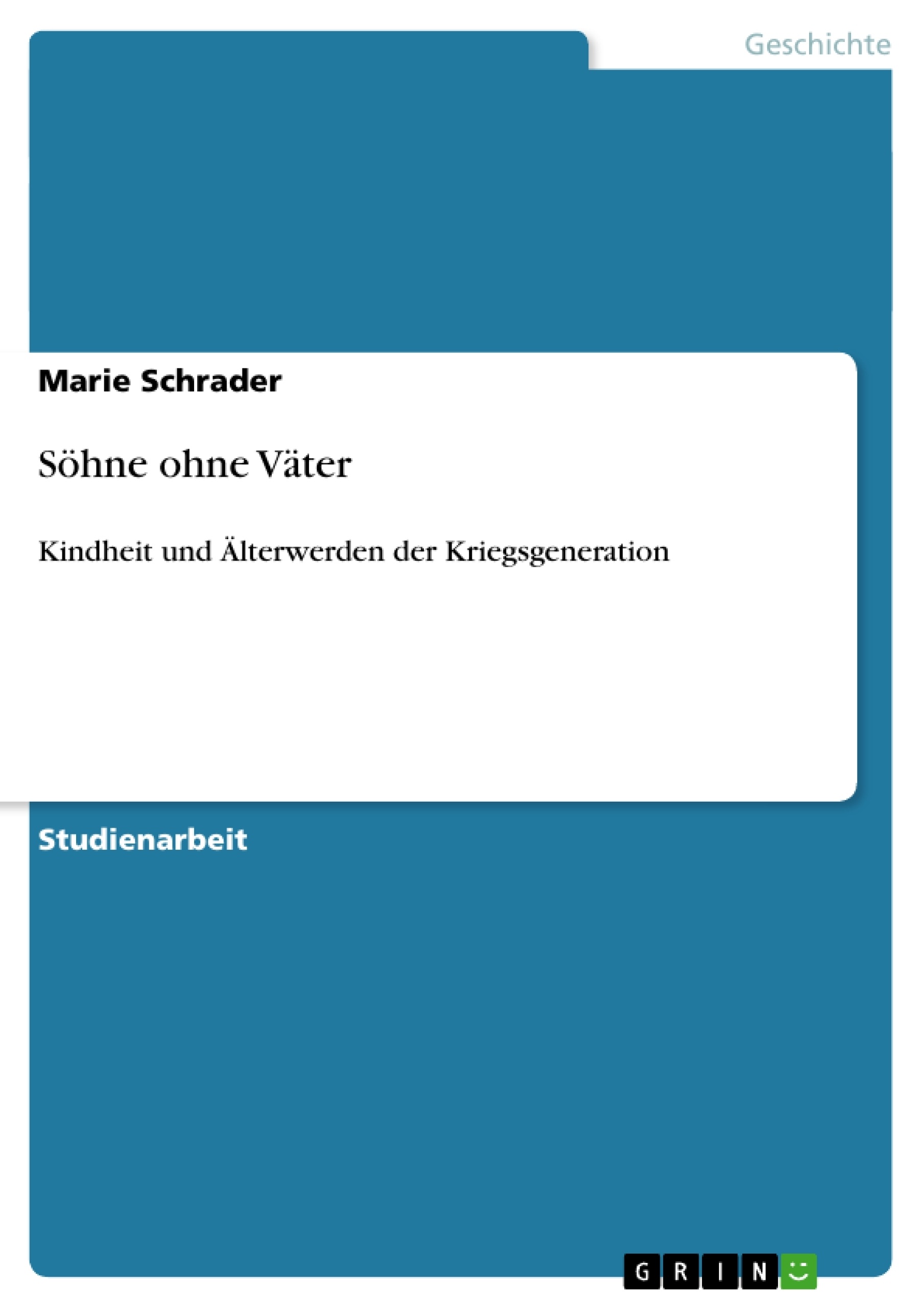Krieg ist Männersache - die Abwesenheit von Vätern in Kriegs- und Nachkriegszeiten somit eine erschreckende Selbstverständlichkeit.
Zwei Weltkriege innerhalb weniger Jahrzehnte hat Deutschland erlebt und „kriegsbedingte Vaterlosigkeit“ (Schulz/Radebeul/Reulecke) ist die Folge. Zwei Generationen wurden von meist recht jungen und häufig überforderten Müttern aufgezogen, die selbst die Schrecken des Krieges nicht richtig verarbeiten konnten.
Der 2. Weltkrieg hat nicht nur Häuser und Straßen, sondern auch unzählige Familien zerstört. Ohne einen Mann als Familienoberhaupt mussten die Frauen ungewollt die Rolle des Ernährers einnehmen, und besonders den Söhnen fehlte in ihrer Entwicklung eine männliche Identifikationsfigur.
Der Aufbau des zerstörten Landes und der Infrastrukturen ließ nicht viel Aufmerksamkeit für die Kleinsten übrig. Die Mütter waren froh, wenn sich ihre Kinder anständig verhielten und nicht noch zusätzliche Arbeit und Ärger machten. So waren die Kinder weitgehend auf sich allein gestellt und wurden schon früh selbstständig. Von ihnen wurde erwartet, dass auch sie zum täglichen Überleben etwas beitrugen und mitarbeiteten.
Die Lage vieler Familien im Nachkriegsdeutschland wurde von zwei Faktoren bestimmt: Hunger und Wohnungsnot.
Millionen Deutsche waren bis in die 50er Jahre hinein unterernährt und besonders die Kinder zeigten in der Folge körperliche Fehlentwicklungen. Eine weitere psychische Belastung für die Familien stellte die allgemeine Wohnungsnot dar. In allen deutschen Städten fehlte infolge der Bombardierungen ausreichender Wohnraum, so dass meist mehrere sich fremde Familien auf engstem Raum zusammenleben mussten. Besonders Flüchtlinge und Vertriebene, die ihren gesamten Hausrat verloren hatten, waren stark betroffen.
Es ist deutlich, dass die Vaterlosigkeit bei diesem betroffenen Teil der Kinder nicht die einzige Beeinträchtigung war. Denn zu den Kriegsfolgen wie Flucht und Vertreibung, Bombardierungen und direkten Gewalterfahrungen kamen Erkrankungen und Behinderungen sowie Tod von anderen Familienmitgliedern und Freunden. Bei vielen Kindern dürften sich diese Faktoren kumuliert haben, in der Stadt allerdings im stärkeren Maße als auf dem Land, weil Wohnungsnot und Hunger dort nicht so ausgeprägt waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Situation im Nachkriegsdeutschland
- Methode und Vorgehensweise
- Entwicklungspsychologische Funktionen
- Rolle des Vaters und Folgen der Vaterlosigkeit
- Rolle der Mutter bei fehlendem Vater
- Kindheit ohne Vater in der Nachkriegszeit
- Zahlen und Situation der betroffenen Familien
- Erziehung durch die Mütter
- Ersatzväter – Vater-Ersatz?
- Vorbilder und Helden
- Erinnerungen an den Vater
- Die Söhne von damals – heute
- „Im Alter rückt die Kindheit wieder näher.“
- Eigenschaften, Kompetenzen, Charakterzüge
- Umgang mit dem eigenen Körper
- Ablösung von der Mutter
- Beruf und Karriere
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der kriegsbedingten Vaterlosigkeit auf die Entwicklung von Söhnen der Kriegsgeneration. Sie analysiert die psychosozialen Folgen fehlender männlicher Bezugspersonen im Kontext der spezifischen Herausforderungen der Nachkriegszeit, wie Hunger, Wohnungsnot und die Belastung der Mütter. Die Arbeit stützt sich auf entwicklungspsychologische Perspektiven und empirische Befunde.
- Die Rolle des Vaters in der kindlichen Entwicklung
- Die Auswirkungen der Vaterlosigkeit auf die Sozialisation von Söhnen
- Die Lebensbedingungen von Kindern in der Nachkriegszeit
- Die Bewältigungsstrategien von Müttern und Söhnen
- Langzeitfolgen der Vaterlosigkeit im Erwachsenenalter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der kriegsbedingten Vaterlosigkeit in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie betont die erschreckende Selbstverständlichkeit des Fehlens von Vätern und die daraus resultierenden Herausforderungen für Mütter und Kinder. Die Einleitung skizziert die methodische Vorgehensweise der Arbeit und die Relevanz des Buches „Söhne ohne Väter“ für die Untersuchung.
Entwicklungspsychologische Funktionen: Dieses Kapitel beleuchtet die zentrale Rolle des Vaters in der kindlichen Entwicklung aus entwicklungspsychologischer und psychoanalytischer Perspektive. Es betont die Bedeutung des Vaters als erstes männliches Identifikationsmodell und die unterschiedlichen Auswirkungen der Vaterlosigkeit, abhängig vom Zeitpunkt des Verlustes. Die Rolle der Mutter in Abwesenheit des Vaters wird ebenfalls analysiert.
Kindheit ohne Vater in der Nachkriegszeit: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Lebensbedingungen von Kindern, die in der Nachkriegszeit ohne Vater aufwuchsen. Es differenziert zwischen verschiedenen Gruppen von betroffenen Familien, basierend auf dem Ausmaß der Beeinträchtigung durch Vaterlosigkeit und die zusätzlichen Belastungen durch Hunger und Wohnungsnot. Die Rolle der Mütter, die Suche nach Ersatzvätern und die Bedeutung von Vorbildern werden thematisiert.
Die Söhne von damals – heute: Dieses Kapitel befasst sich mit den langfristigen Auswirkungen der Vaterlosigkeit auf die Söhne im Erwachsenenalter. Es untersucht ihre Charaktereigenschaften, ihren Umgang mit dem eigenen Körper und die Ablösung von der Mutter. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten in den Lebensläufen dieser Männer und dem Zeitpunkt, zu dem sie sich mit ihrer Kindheit auseinandersetzen.
Schlüsselwörter
Kriegsbedingte Vaterlosigkeit, Nachkriegszeit, Entwicklungspsychologie, Sozialisation, Männliche Identifikationsfigur, Mutterrolle, Lebensbedingungen, Langzeitfolgen, Erinnerungen, Identität.
Häufig gestellte Fragen zu: Auswirkungen kriegsbedingter Vaterlosigkeit auf Söhne der Kriegsgeneration
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der kriegsbedingten Vaterlosigkeit auf die Entwicklung von Söhnen der Kriegsgeneration. Sie analysiert die psychosozialen Folgen fehlender männlicher Bezugspersonen im Kontext der spezifischen Herausforderungen der Nachkriegszeit (Hunger, Wohnungsnot, Belastung der Mütter).
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf entwicklungspsychologische Perspektiven und empirische Befunde. Die genaue methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung detaillierter beschrieben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle des Vaters in der kindlichen Entwicklung, die Auswirkungen der Vaterlosigkeit auf die Sozialisation von Söhnen, die Lebensbedingungen von Kindern in der Nachkriegszeit, die Bewältigungsstrategien von Müttern und Söhnen sowie die Langzeitfolgen der Vaterlosigkeit im Erwachsenenalter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu entwicklungspsychologischen Funktionen (Rolle des Vaters und der Mutter), ein Kapitel zur Kindheit ohne Vater in der Nachkriegszeit (Lebensbedingungen, Ersatzväter, Vorbilder), ein Kapitel zu den Söhnen im Erwachsenenalter (Charaktereigenschaften, Umgang mit dem Körper, Ablösung von der Mutter) und ein Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt den Kontext der kriegsbedingten Vaterlosigkeit in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, betont die Herausforderungen für Mütter und Kinder und skizziert die methodische Vorgehensweise.
Was wird im Kapitel "Entwicklungspsychologische Funktionen" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die zentrale Rolle des Vaters in der kindlichen Entwicklung aus entwicklungspsychologischer und psychoanalytischer Perspektive, die Bedeutung des Vaters als männliches Identifikationsmodell und die Rolle der Mutter in Abwesenheit des Vaters.
Was wird im Kapitel "Kindheit ohne Vater in der Nachkriegszeit" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Lebensbedingungen von Kindern ohne Vater in der Nachkriegszeit, differenziert zwischen betroffenen Familiengruppen und thematisiert die Rolle der Mütter, die Suche nach Ersatzvätern und die Bedeutung von Vorbildern.
Was wird im Kapitel "Die Söhne von damals – heute" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit den langfristigen Auswirkungen der Vaterlosigkeit auf die Söhne im Erwachsenenalter, untersucht ihre Charaktereigenschaften, den Umgang mit dem eigenen Körper, die Ablösung von der Mutter und den Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit der Kindheit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kriegsbedingte Vaterlosigkeit, Nachkriegszeit, Entwicklungspsychologie, Sozialisation, Männliche Identifikationsfigur, Mutterrolle, Lebensbedingungen, Langzeitfolgen, Erinnerungen, Identität.
- Quote paper
- Marie Schrader (Author), 2006, Söhne ohne Väter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137812