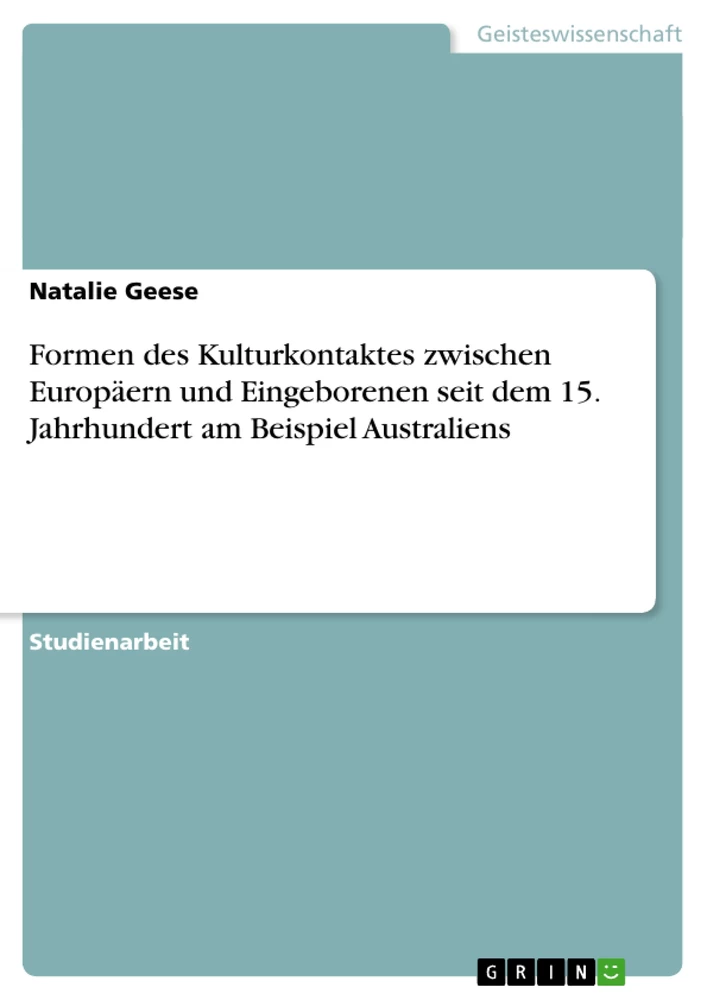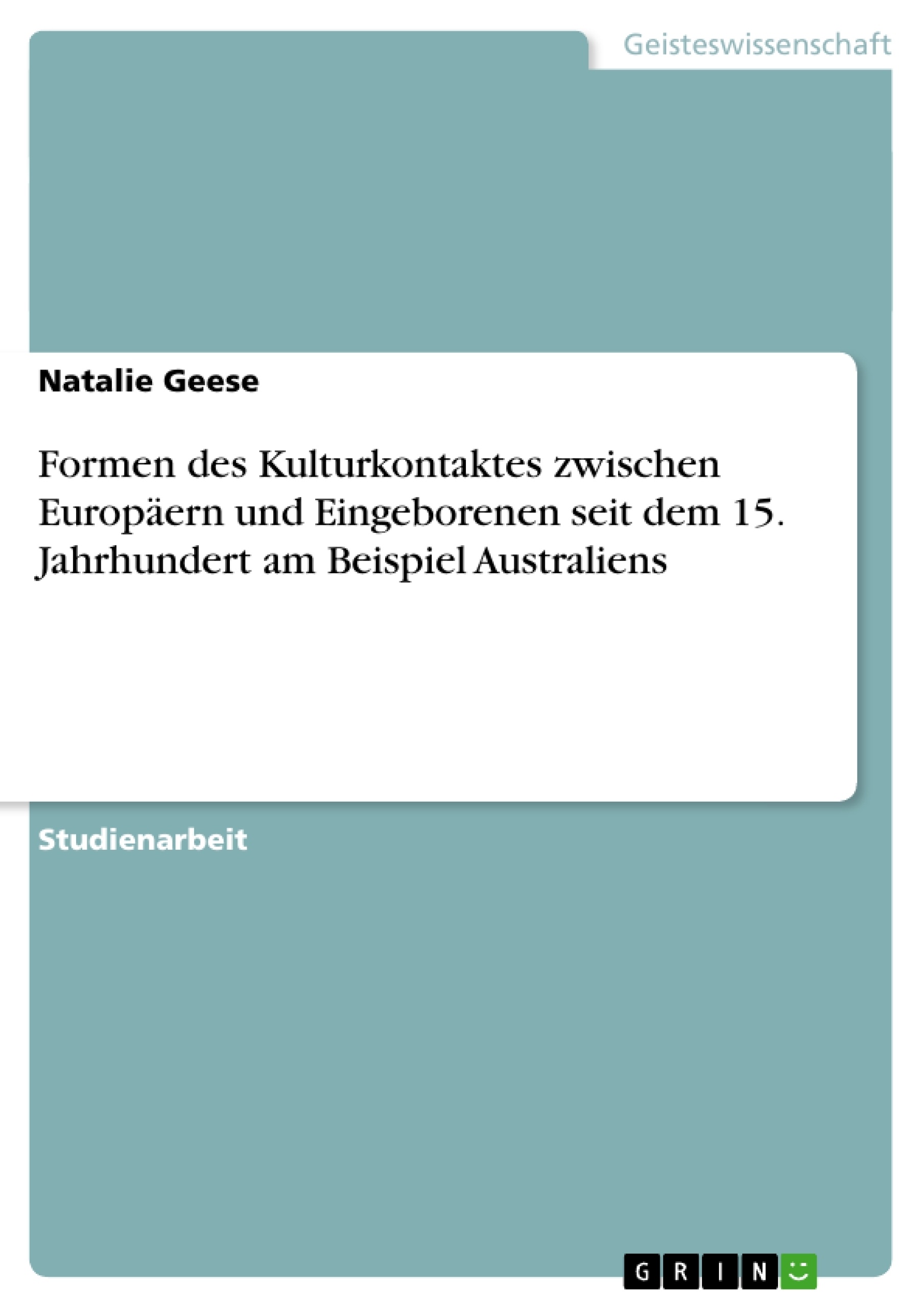Dass Aborigines ungepflegt seien, war eine Behauptung, mit der ich während meines Aufenthaltes in Australien in diesem Jahr konfrontiert wurde. Diese entsprach kei-neswegs dem Bild, das ich mir im Vorfeld von der dortigen Bevölkerung gemacht hatte. Hatte ich sie doch als offen und tolerant eingestuft. Aber hier war nichts von ei-nem Miteinander der weißen Australier mit den Ureinwohnern des Kontinents – sofern man überhaupt einmal einen solchen zu Gesicht bekam – zu erkennen. Wie kam es zu einem derartigen Verhältnis zwischen diesen beiden ethnischen Gruppen? Die Ursache ist in der von Kolonialismus geprägten Geschichte des Landes zu suchen. Da der vorliegenden Arbeit die These zu Grunde liegt, dass kulturelle Differenzen einen nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen haben, liegt der Schwerpunkt hier auf dem Kulturkontakt zwischen Europäern und Eingeborenen. Zunächst muss jedoch die Bedeutung des zwar häufig verwendeten, aber auch sehr unspezifischen Begriffs Kultur geklärt werden, um ein gemeinsames Grundverständnis zu schaffen. Dann wird das Grundmuster des Kulturkontaktes zwischen Europäern und Eingeborenen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert skizziert, da Australien kein Einzelfall war, sondern die Europäer in den unterschiedlichsten Regionen der Erde auf Eingeborene trafen, deren Verhältnis sich sehr unterschiedlich entwickelte. Erst in einem weiteren Schritt wird gefragt, inwieweit sich das allgemeine Konzept des Kulturkontaktes auf die spezifische Situation Australiens übertragen lässt. Dabei ist es unabdingbar, zunächst das kulturelle Leben der Aborigines, wie es die Engländer vorgefunden haben, zu erläutern, da nur auf dieser Basis verstanden werden kann, warum durch die Vertreibung der Aborigines auch deren kulturelle Identität zerstört wurde. Daran anschließend werden dann in Kürze die für dieses Thema relevant erscheinenden Aspekte der jüngeren Geschichte Australiens, beginnend mit der Be-siedlung durch Weiße, anhand der allgemeinen Phasen des Kulturkontaktes dargelegt. Dabei darf jedoch die Frage nicht vernachlässigt werden, ob es unter den weißen Siedlern eine einheitliche Kultur gab und ob diese englischen Ursprungs oder doch eine Neuerfindung war. Ziel ist es also die Formen des Kulturkontaktes zwischen Europäern und Eingeborenen theoretisch zu fassen und exemplarisch zu verdeutlichen bzw. auch zu erweitern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition des Begriffs Kultur
- 2.2 Grundformen des Kulturkontaktes zwischen Europäern und Eingeborenen nach Bitterli
- 3. Australien als Fallbeispiel
- 3.1 Das Leben der Aborigines vor der Besiedlung Australiens durch Engländer
- 3.2 Die erste Kulturberührung zwischen Aborigines und Engländern
- 3.3 Von der Kulturberührung zum Kulturzusammenstoß
- 3.4 Die Anfänge einer Kulturbeziehung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Formen des Kulturkontaktes zwischen Europäern und Eingeborenen seit dem 15. Jahrhundert, anhand des Beispiels Australiens. Ziel ist die theoretische Erfassung und exemplarische Verdeutlichung dieser Kontaktformen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Interaktionen und deren Folgen für die betroffenen Kulturen.
- Definition des Begriffs „Kultur“ und dessen Wandel im Laufe der Zeit
- Grundmuster des Kulturkontaktes zwischen Europäern und Eingeborenen im 15. bis 18. Jahrhundert
- Das Leben der Aborigines vor der europäischen Besiedlung
- Die verschiedenen Phasen des Kulturkontaktes in Australien (Berührung, Zusammenstoß, Beziehung)
- Der Einfluss des Kolonialismus auf die kulturelle Identität der Aborigines
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation, die durch eine persönliche Erfahrung in Australien motiviert ist: der Gegensatz zwischen der vom Autor gebildeten Vorstellung von toleranten Aborigines und der in Australien beobachteten Realität eines distanzierten Verhältnisses zwischen Ureinwohnern und weißen Australiern. Diese Diskrepanz führt zur Fragestellung nach den Ursachen dieses Verhältnisses, wobei der Fokus auf dem Einfluss kultureller Differenzen im Kontext der kolonialen Geschichte Australiens liegt. Die Arbeit skizziert den Forschungsweg: zunächst wird der vielschichtige Begriff „Kultur“ geklärt, dann das allgemeine Muster des Kulturkontaktes zwischen Europäern und Eingeborenen umrissen und schließlich die Übertragbarkeit dieses Musters auf die australische Situation untersucht. Die Bedeutung des kulturellen Lebens der Aborigines vor der Besiedlung und die Frage nach der kulturellen Einheitlichkeit der weißen Siedler werden als zentral hervorgehoben.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Definition des Begriffs „Kultur“. Es untersucht die etymologische Entwicklung des Wortes „colere“ und seine unterschiedlichen Bedeutungen im Laufe der Geschichte. Der Autor zeigt den Wandel des Kulturbegriffs vom Gegensatz zu „Natur“, über die Gleichsetzung mit „Zivilisation“ im 18. Jahrhundert bis hin zur Anerkennung kultureller Vielfalt im 20. Jahrhundert. Es wird der Eurozentrismus des früheren Kulturverständnisses kritisiert und der Einfluss von Cultural Studies auf die pluralistische Sichtweise der Kultur hervorgehoben. Die verschiedenen Definitionen und Interpretationen von Kultur werden beleuchtet, unter Berücksichtigung unterschiedlicher theoretischer Ansätze.
3. Australien als Fallbeispiel: Dieses Kapitel analysiert den Kulturkontakt zwischen Europäern und Aborigines in Australien. Zuerst wird das Leben der Aborigines vor der englischen Besiedlung dargestellt, um die Grundlage für das Verständnis der Auswirkungen der Kolonisation zu schaffen. Anschließend werden die Phasen des Kulturkontakts – die erste Berührung, der Zusammenstoß und die Entwicklung einer (ungleichen) Beziehung – beschrieben und analysiert. Hierbei wird die Zerstörung der kulturellen Identität der Aborigines durch die Vertreibung als zentrale Folge der Kolonisierung hervorgehoben. Die Frage nach einer einheitlichen Kultur unter den weißen Siedlern und deren Ursprung (englischer Ursprung oder Neuerfindung) wird ebenfalls thematisiert, um die Komplexität der Interaktion zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Kulturkontakt, Aborigines, Australien, Kolonialismus, Kulturdefinition, Cultural Studies, Eurozentrismus, kulturelle Identität, Kolonialgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Kulturkontakt in Australien
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Kulturkontakt zwischen Europäern und Eingeborenen, insbesondere am Beispiel Australiens und der Aborigines. Sie analysiert die verschiedenen Phasen dieses Kontakts – von der ersten Berührung bis hin zu einer ungleichen Beziehung – und deren Folgen für die betroffenen Kulturen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen des Begriffs „Kultur“ und deren Wandel im Laufe der Zeit. Sie kritisiert den Eurozentrismus früherer Kulturverständnisse und betont den Einfluss der Cultural Studies auf eine pluralistische Sichtweise. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zur Kulturdefinition berücksichtigt.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zu Australien als Fallbeispiel und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Motivation der Arbeit und skizziert den Forschungsweg. Das Kapitel zu den theoretischen Grundlagen definiert den Kulturbegriff. Das Kapitel über Australien analysiert den Kulturkontakt zwischen Europäern und Aborigines in seinen verschiedenen Phasen (Berührung, Zusammenstoß, Beziehung), einschließlich der Auswirkungen der Kolonisation auf die kulturelle Identität der Aborigines.
Welche Phasen des Kulturkontakts werden in Bezug auf Australien untersucht?
Die Arbeit unterscheidet drei Phasen des Kulturkontakts in Australien: die erste Berührung, den Zusammenstoß und die Entwicklung einer (ungleichen) Beziehung. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen dieser Phasen auf die Aborigines und ihre kulturelle Identität.
Welche Rolle spielt der Kolonialismus in der Hausarbeit?
Der Kolonialismus wird als zentraler Faktor für die Zerstörung der kulturellen Identität der Aborigines betrachtet. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Kolonisation auf das Leben und die Kultur der Aborigines und die Entstehung einer ungleichen Beziehung zwischen Ureinwohnern und weißen Siedlern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kulturkontakt, Aborigines, Australien, Kolonialismus, Kulturdefinition, Cultural Studies, Eurozentrismus, kulturelle Identität, Kolonialgeschichte.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist die theoretische Erfassung und exemplarische Verdeutlichung der Kontaktformen zwischen Europäern und Eingeborenen seit dem 15. Jahrhundert anhand des australischen Beispiels. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Interaktionen und deren Folgen für die beteiligten Kulturen.
Wie wird das Leben der Aborigines vor der Besiedlung dargestellt?
Die Arbeit beschreibt das Leben der Aborigines vor der englischen Besiedlung, um die Grundlage für das Verständnis der Auswirkungen der Kolonisation zu schaffen. Es wird auf die Bedeutung des kulturellen Lebens der Aborigines vor dem Kontakt mit Europäern eingegangen, um die Veränderungen durch den Kolonialismus besser zu verstehen.
Wie wird der Begriff „Kultur“ in der Arbeit definiert?
Die Arbeit untersucht die etymologische Entwicklung des Wortes „colere“ und seine unterschiedlichen Bedeutungen im Laufe der Geschichte. Sie zeigt den Wandel des Kulturbegriffs vom Gegensatz zu „Natur“ bis hin zur Anerkennung kultureller Vielfalt. Verschiedene Definitionen und Interpretationen von Kultur werden beleuchtet.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der Einleitung, der theoretischen Grundlagen und des Kapitels zu Australien als Fallbeispiel. Diese Zusammenfassungen fassen die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse der jeweiligen Kapitel zusammen.
- Quote paper
- Natalie Geese (Author), 2008, Formen des Kulturkontaktes zwischen Europäern und Eingeborenen seit dem 15. Jahrhundert am Beispiel Australiens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137808