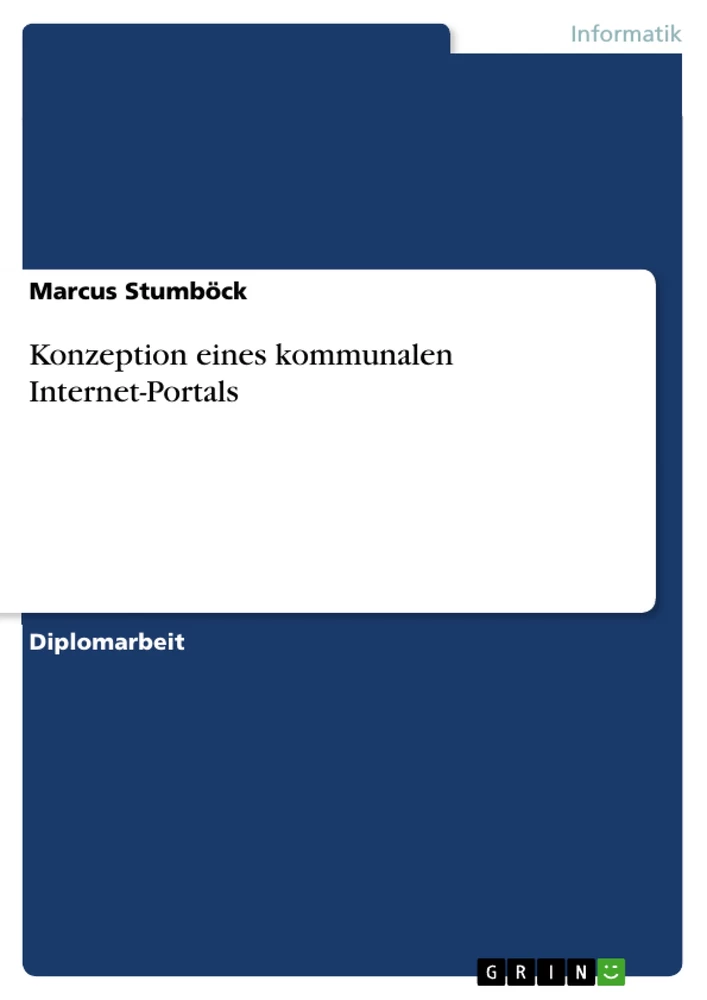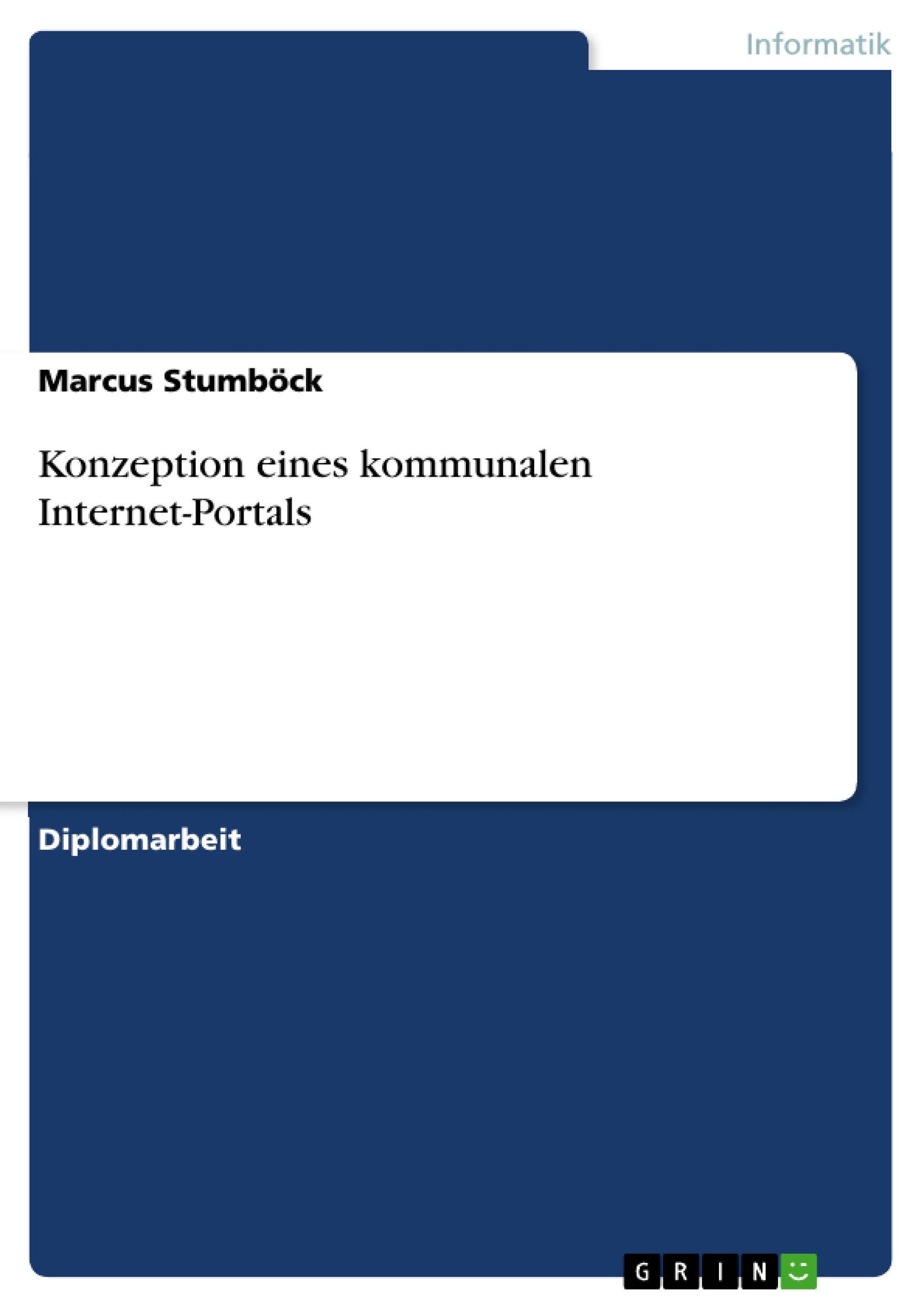Mit der Verbreitung des Internets bis in die Amtsstuben der öffentlichen Verwaltung kann sich auch die öffentliche Hand von den neuen Techniken und Möglichkeiten nicht mehr verschließen.
Die ersten Internetauftritte von Kommunen, die im Laufe der Internetrevolution der 80/90er Jahre entstanden sind, boten lediglich Informationen, die nicht über die Bereitstellung von Telefonnummern und Öffnungszeiten hinaus reichten. Leider hat sich an dieser Situation bei vielen aktuellen Webauftritten der deutschen Kommunen und Behörden nicht viel verändert. Noch immer sind reine Informationsangebote ohne transaktionalen oder partizipativen Charakter häufig anzutreffen.
Doch gerade dies reicht trotz der verbesserten grafischen Präsentation der Angebote in Zeiten wachsender Bedeutung des e-Governments in Deutschland nicht mehr aus. Im Zuge der allgemeinen Wandlung in eine Informations- und Wissensgesellschaft entstehen auch für die öffentliche Hand neue Herausforderungen, aktiv daran teilzuhaben. Diese Herausforderungen für die Behörden auf Bundes- bzw. regionaler Ebene und der einzelnen Kommunen sind vergleichbar mit denen der Unternehmen bei der Einführung des e-Commerce, obgleich die staatlichen Institutionen eine weitaus vielfältigere Aufgabe zu bewältigen haben.
Deshalb stellen Konzeption und Einsatz erweiterter öffentlicher Informations- und Interaktionsportale, sowohl in inhaltlicher als auch in technischer Sicht, eine der wichtigsten Schlüsselfunktionen bei der Ausgestaltung dieser neuen Informationsgesellschaft dar.
Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, eine Entscheidungshilfe funktionaler, inhaltlicher, technologischer und organisatorischer Natur für die Einführung eines kommunalen Internet-Portals zu liefern, wobei hauptsächlich auf die Internet-Sicht eines Portals eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Herausforderung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Grundlagen
- 2.1 Ziele eines kommunalen Internet-Portals
- 2.2 Nutzen eines kommunalen Internet-Portals
- 2.2.1 Bürgerschaft
- 2.2.2 Unternehmen
- 2.2.3 Öffentliche Stellen
- 2.3 Definitionen und Abgrenzung
- 2.3.1 e-Government
- 2.3.1.1 Kommunikationspartner
- 2.3.1.2 Anwendungsbereiche
- 2.3.1.3 Interaktionsgrad
- 2.3.2 One-Stop-Government
- 2.3.3 Portale
- 2.3.4 Virtuelle Marktplätze
- 2.3.5 Elektronische Signatur
- 2.4 Ausgangssituation in Deutschland
- 2.4.1 Nutzung des Internets
- 2.4.2 Stand des e-Government
- 2.4.2.1 Bundesebene
- 2.4.2.2 Landesebene
- 2.4.2.3 Kommunalebene
- 2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 2.5.1 Elektronische Signatur
- 2.5.2 Barrierefreiheit
- 2.5.3 Impressumspflicht
- 2.5.4 Datenschutz
- 3 Fachliche Anforderungen
- 3.1 Funktionale Spezifikationen
- 3.1.1 Navigation
- 3.1.2 Suche
- 3.1.3 Das Lebenslagen-Prinzip
- 3.1.4 Personalisierung
- 3.1.5 Online-Formulare
- 3.2 Inhaltliche Spezifikationen
- 3.2.1 Sinnvolle Portal-Dienstleistungen
- 3.2.1.1 Information
- 3.2.1.2 Transaktion / Kommunikation
- 3.2.1.3 Partizipation
- 3.2.1.4 Mindestangebot an Dienstleistungen
- 3.2.2 Auswahl der Dienstleistungen
- 3.2.2.1 Identifizierung onlinefähiger Dienstleistungen
- 3.2.2.2 Festlegung der Betreiberziele
- 3.2.2.3 Festlegung der Bewertungskriterien
- 3.2.2.4 Identifikation onlinefähiger Infrastrukturverfahren
- 3.2.2.5 Bewertung und Auswahl der Portal-Dienstleistungen
- 3.2.3 Strukturierung der Portal-Dienstleistungen
- 3.2.3.1 Strukturierung nach dem Lebenslagenprinzip
- 3.2.3.2 Strukturierung nach Themenbereichen
- 4 Technologische und administrative Anforderungen
- 4.1 Sicherheit
- 4.2 Content-Management
- 4.3 Benutzerfreundlichkeit
- 4.4 Payment-Verfahren
- 4.5 Basiskomponenten
- 4.6 Bedarfskomponenten
- 5 Organisatorische Notwendigkeiten
- 5.1 Betreibermodelle
- 5.2 Planung
- 5.3 Einführung
- 5.4 Produktivhaltung
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit konzipiert ein kommunales Internet-Portal. Die Zielsetzung besteht darin, ein umfassendes und nutzerfreundliches Portal zu entwerfen, welches die Bedürfnisse der Bürgerschaft, Unternehmen und öffentlicher Stellen berücksichtigt. Die Arbeit untersucht die dazu notwendigen technischen, organisatorischen und rechtlichen Aspekte.
- Bedürfnisse und Nutzen kommunaler Internetportale
- Fachliche und technische Anforderungen an die Portalgestaltung
- Rechtliche Rahmenbedingungen (Datenschutz, Barrierefreiheit etc.)
- Organisatorische Aspekte des Betriebs eines solchen Portals
- Auswahl geeigneter Technologien und Dienstleistungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Herausforderung der Konzeption eines kommunalen Internet-Portals. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und die behandelten Aspekte.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Konzeption des Portals. Es definiert relevante Begriffe wie e-Government und One-Stop-Government, beschreibt den Nutzen eines solchen Portals für verschiedene Nutzergruppen und analysiert die Ausgangssituation in Deutschland bezüglich Internetnutzung und e-Government. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen, inklusive Datenschutz, Barrierefreiheit und Impressumspflicht. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung eines umfassenden Verständnisses dieser Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts.
3 Fachliche Anforderungen: Kapitel 3 befasst sich mit den fachlichen Anforderungen an das zu konzipierende Portal. Es unterteilt sich in funktionale und inhaltliche Spezifikationen. Die funktionalen Spezifikationen betrachten Aspekte wie Navigation, Suche, das Lebenslagen-Prinzip, Personalisierung und Online-Formulare. Die inhaltlichen Spezifikationen konzentrieren sich auf die Auswahl und Strukturierung sinnvoller Portal-Dienstleistungen, einschliesslich der Identifizierung onlinefähiger Dienstleistungen und die Festlegung von Bewertungskriterien. Die Kapitel erläutert die verschiedenen Strukturierungsansätze und wie diese die Benutzerfreundlichkeit und den Informationszugang beeinflussen.
4 Technologische und Administrative Anforderungen: Dieses Kapitel beschreibt die technologischen und administrativen Anforderungen an das Portal. Es behandelt Aspekte wie Sicherheit (Systemarchitektur, Datenschutz, Identifikationsmechanismen), Content-Management, Benutzerfreundlichkeit, Payment-Verfahren und die notwendigen Basis- und Bedarfskomponenten. Die Kapitel betont die Wichtigkeit einer robusten technischen Infrastruktur und effizienter Prozesse für den langfristigen Erfolg des Portals.
5 Organisatorische Notwendigkeiten: Kapitel 5 befasst sich mit den organisatorischen Notwendigkeiten für den Betrieb und die Wartung des Portals. Es untersucht verschiedene Betreibermodelle, die Planung, Einführung und Produktivhaltung des Systems. Es betont, dass der Erfolg des Portals nicht nur von der Technologie, sondern auch von einer soliden organisatorischen Struktur abhängt.
Schlüsselwörter
Kommunales Internet-Portal, e-Government, One-Stop-Government, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Datenschutz, Sicherheit, Content-Management, Online-Dienstleistungen, Lebenslagen-Prinzip, Rechtliche Rahmenbedingungen, technologische Anforderungen, organisatorische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Konzeption eines kommunalen Internet-Portals
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Konzeption eines umfassenden und nutzerfreundlichen kommunalen Internet-Portals. Dabei werden die Bedürfnisse von Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Stellen berücksichtigt.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die technischen, organisatorischen und rechtlichen Aspekte der Portalgestaltung. Dies umfasst die Bedürfnisse und den Nutzen kommunaler Internetportale, die fachlichen und technischen Anforderungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen (Datenschutz, Barrierefreiheit etc.), organisatorische Aspekte des Betriebs und die Auswahl geeigneter Technologien und Dienstleistungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen, Fachliche Anforderungen, Technologische und Administrative Anforderungen, Organisatorische Notwendigkeiten und Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Portalentwicklung, von der theoretischen Grundlage bis zur praktischen Umsetzung und den langfristigen Betriebsaspekten.
Was sind die zentralen Grundlagen, die in der Arbeit behandelt werden?
Die Grundlagen umfassen Definitionen von e-Government und One-Stop-Government, die Analyse des Nutzens für verschiedene Nutzergruppen, die Ausgangssituation in Deutschland (Internetnutzung und e-Government-Stand) und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen (Datenschutz, Barrierefreiheit, Impressumspflicht).
Welche fachlichen Anforderungen werden an das Portal gestellt?
Die fachlichen Anforderungen umfassen funktionale Spezifikationen (Navigation, Suche, Lebenslagen-Prinzip, Personalisierung, Online-Formulare) und inhaltliche Spezifikationen (Auswahl und Strukturierung sinnvoller Portal-Dienstleistungen, Identifizierung onlinefähiger Dienstleistungen, Bewertungskriterien). Die Arbeit erläutert verschiedene Strukturierungsansätze (nach Lebenslagen oder Themenbereichen).
Welche technologischen und administrativen Anforderungen werden beschrieben?
Die technologischen und administrativen Anforderungen beinhalten Aspekte wie Sicherheit (Systemarchitektur, Datenschutz, Identifikationsmechanismen), Content-Management, Benutzerfreundlichkeit, Payment-Verfahren und die notwendigen Basis- und Bedarfskomponenten. Die Bedeutung einer robusten technischen Infrastruktur und effizienter Prozesse wird hervorgehoben.
Welche organisatorischen Notwendigkeiten werden in der Arbeit betrachtet?
Die organisatorischen Notwendigkeiten umfassen verschiedene Betreibermodelle, die Planung, Einführung und Produktivhaltung des Portals. Der Fokus liegt darauf, dass der Erfolg des Portals sowohl von der Technologie als auch von einer soliden organisatorischen Struktur abhängt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kommunales Internet-Portal, e-Government, One-Stop-Government, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Datenschutz, Sicherheit, Content-Management, Online-Dienstleistungen, Lebenslagen-Prinzip, Rechtliche Rahmenbedingungen, technologische Anforderungen, organisatorische Aspekte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, ein umfassendes und nutzerfreundliches kommunales Internet-Portal zu konzipieren, das die Bedürfnisse der Bürgerschaft, Unternehmen und öffentlicher Stellen berücksichtigt.
- Quote paper
- Marcus Stumböck (Author), 2003, Konzeption eines kommunalen Internet-Portals, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13774