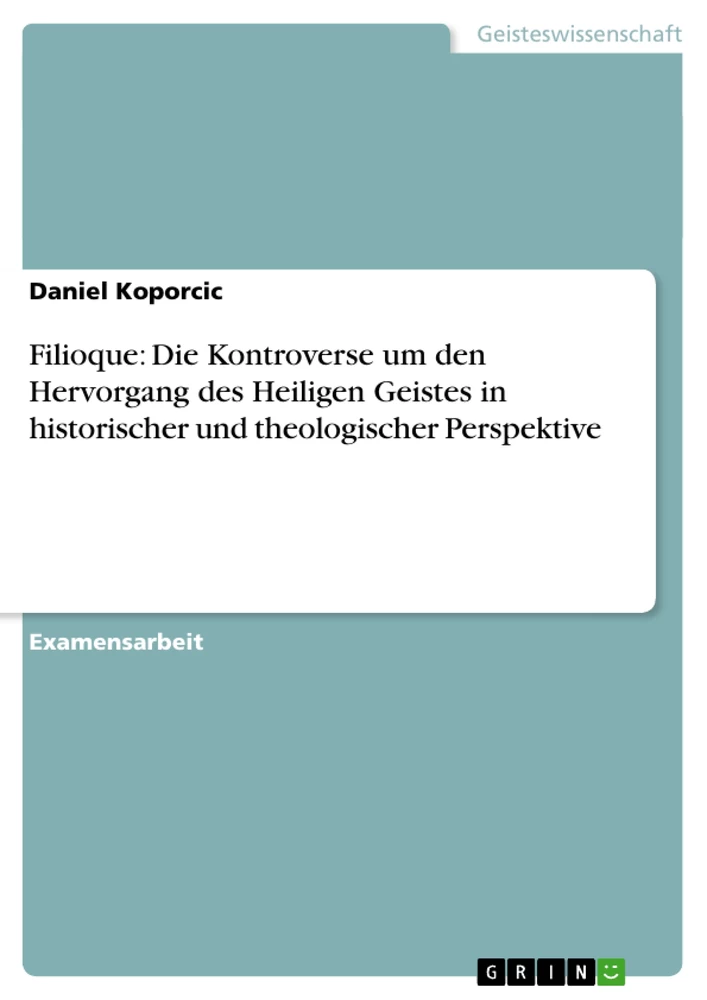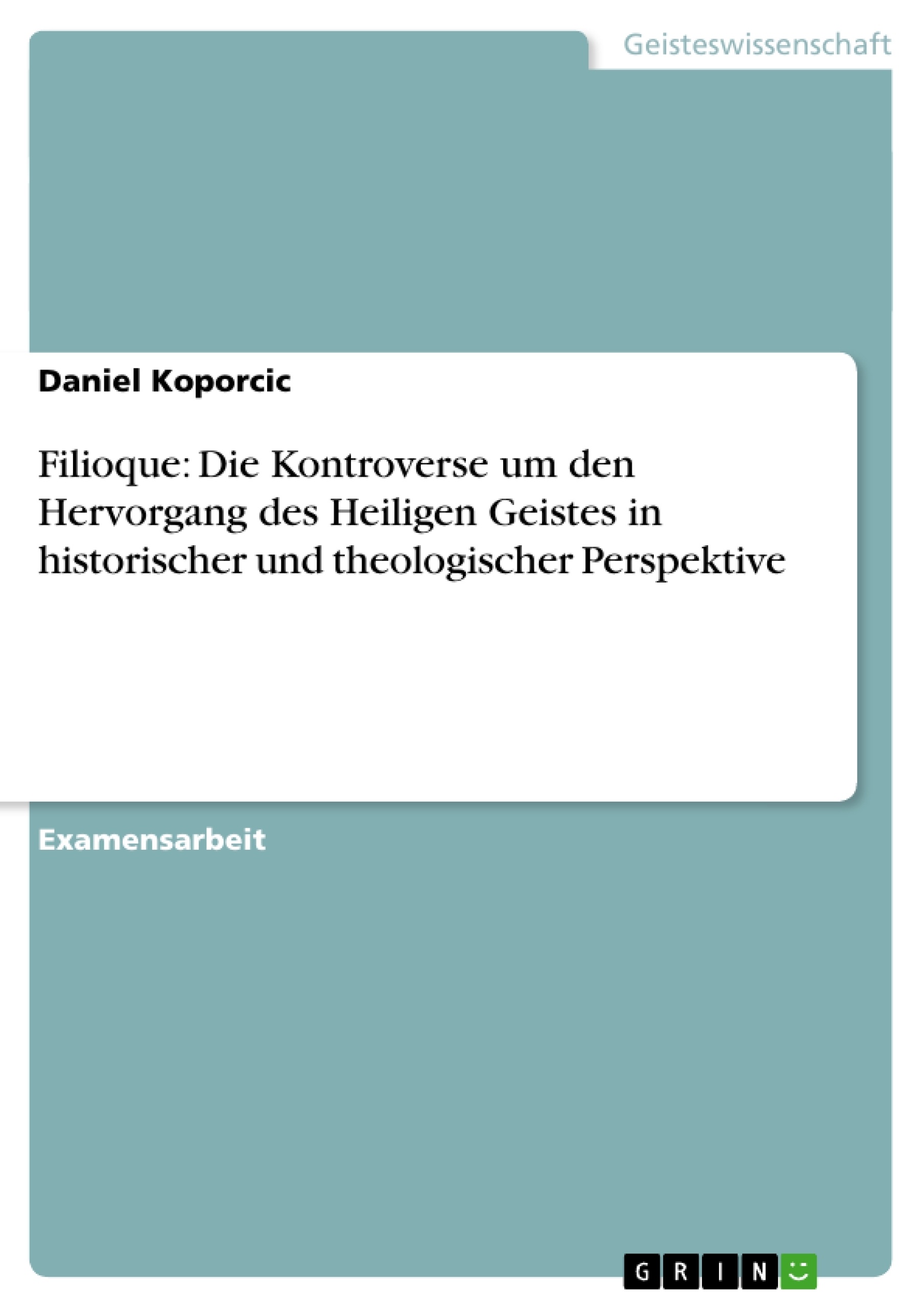Gemeinhin gilt das Jahr 1054 als Datum der Spaltung von Ost- und Westkirche. Eine vollständige Einigung ist bislang noch nicht erzielt worden, wobei im Zuge des II. Vatikanischen Konzils wichtige Schritte zur Verständigung gegangen worden sind. Mitunter wurde 1965 die gegenseitige Exkommunikation aufgehoben, über 900 Jahre nach der Bannung. In der Zeitspanne (und auch vorher) bildeten sich einige Lehrunterschiede heraus, wovon die wichtigsten sind: I. das Filioque, II. die Lehre vom Fegefeuer, III. die Eucharistie, IV. das Sakrament der Ehe, V. Mariä Empfängnis und Mariä Himmelfahrt, VI. der Jurisdiktionsprimat und die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes.
Das Filioque – an erster Stelle aufgeführt – ist ein vergleichsweise wenigen Katholiken geläufiger Begriff. Welchen Unterschied er zur Orthodoxie darstellt dürfte noch weitaus weniger bekannt sein. Und doch gilt er als Auslöser des Großen Schismas. Was bedeutet es, ob der Heilige Geist vom Vater durch den Sohn oder aber vom Vater und vom Sohn hervorgeht? Besaß dieser Unterschied im Glaubens-bekenntnis vor 900 Jahren eine Brisanz, die von heutigen Christen nicht mehr nachzu-vollziehen ist. Historisch betrachtet handelt es gemäß gängiger Lehrmeinung um eine ursprünglich relativ unbedeutende Differenz. Diese sei im Zuge des Aufstiegs der Karolinger zur Kaiserwürde zwecks Abgrenzung vom Ostreich hochstilisiert wurde. Der römischen Rechtsauffassung entsprechend regierte der legitime Kaiser des Römischen Reiches von Konstantinopel aus (translatio imperii) und konnte nicht durch die ‚barbarischen’ Franken beerbt werden. Daher führte Karl d. Gr. den Bruch mit Byzanz herbei, der auch theologisch begründet werden musste, um die Legitimation des oströmischen Kaisertums zu desavouieren. Eigens dafür ist das Filioque neben anderen theologischen Verschiedenheiten instrumentalisiert worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Geschichte der Spaltung
- 1.1. Vorgeschichte
- 1.1.1. Der Arianismus
- 1.1.2. Erste Glaubensbekenntnisse
- 1.1.3. Lage auf der iberischen Halbinsel
- 1.1.4. Synode von Gentilly
- 1.1.5. Rückblick: Rom - Byzanz – Frankenreich
- 1.1.6. Bilderstreit und das II. Konzil von Nizäa
- 1.1.7. Synoden von Frankfurt und Aquileia
- 1.1.8. Jerusalem 807/08
- 1.2. Die Spaltung und Unionsbemühungen
- 1.2.1. Das photianische Schisma
- 1.2.2. Morgenländisches Schisma
- 1.2.3. Konzil von Bari
- 1.2.4. Konzil von Lyon
- 1.2.5. Konzil von Ferrara/Florenz
- 1.3. Resümee
- 1.1. Vorgeschichte
- 2. Theologische Entwicklung der Hervorgangsmodelle
- 2.1. Trinitätstheologische Voraussetzungen
- 2.1.1. Arianische Lehre
- 2.1.2. Athanasius
- 2.1.3. Die drei Kappadozier
- 2.1.4. Augustin
- 2.1.5. Resümee
- 2.2. Zuspitzung hin zum Filioque-Streit
- 2.2.1. Adoptianische Lehre
- 2.2.2. Karolingische Theologie
- 2.3. Positionen der Ostkirche
- 2.3.1. Photios
- 2.3.2. Gregor von Zypern
- 2.3.3. Gregor Palamas
- 2.4. Positionen der Westkirche
- 2.4.1. Anselm von Canterbury
- 2.4.2. Thomas von Aquin
- 2.5. Gegenwärtige Standpunkte
- 2.5.1. Einleitung: II. Vatikanisches Konzil
- 2.5.2. Athanasios Vletsis (orthodox)
- 2.5.3. Peter Knauer (katholisch)
- 2.5.4. Friedrich-Wilhelm Marquardt (protestantisch)
- 3. Resümee
- 2.1. Trinitätstheologische Voraussetzungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die historische und theologische Entwicklung des Filioque-Streits als zentralen Punkt der Spaltung zwischen Ost- und Westkirche. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Streits über den Ursprung des Heiligen Geistes zu beleuchten und seine Rolle im Großen Schisma zu analysieren. Dabei werden sowohl die theologischen Argumente als auch die politischen und historischen Kontexte berücksichtigt.
- Die historische Entwicklung des Filioque-Streits
- Die theologischen Positionen der Ost- und Westkirche
- Der Einfluss des Arianismus und des Adoptianismus
- Die Rolle politischer Machtstrukturen
- Gegenwärtige ökumenische Bemühungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Großen Schismas von 1054 ein und benennt zentrale Streitpunkte wie das Filioque, die Lehre vom Fegefeuer und die Eucharistie. Sie betont die bis heute andauernde Spaltung und die Bedeutung des Filioque-Streits als scheinbar kleinen, aber historisch bedeutsamen Auslöser.
1. Geschichte der Spaltung: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte der Spaltung, beginnend mit dem Arianismus und der Entwicklung des christlichen Glaubensbekenntnisses. Es beschreibt die Rolle der Reichseinheit und die politischen und theologischen Auseinandersetzungen, die zur Spaltung beitrugen. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von politischen Mächten wie den Karolingern und ihrer Instrumentalisierung theologischer Unterschiede zur Legitimation ihrer Herrschaft.
2. Theologische Entwicklung der Hervorgangsmodelle: Dieses Kapitel befasst sich mit der theologischen Entwicklung der verschiedenen Auffassungen zum Ursprung des Heiligen Geistes. Es analysiert die trinitätstheologischen Voraussetzungen, die unterschiedlichen Positionen der Ost- und Westkirche, und die Beiträge wichtiger Theologen wie Athanasius, Augustin, Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin. Es zeigt die zunehmende Zuspitzung des Streits und die komplexen theologischen Argumente, die dahinterstehen.
Schlüsselwörter
Filioque, Ostkirche, Westkirche, Arianismus, Adoptianismus, Trinität, Großer Schisma, Theologie, Ökumene, Kirchenpolitik, Kaiser Konstantin, Karl der Große, Konzilien, Glaubensbekenntnis.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Die Ost-West-Spaltung und der Filioque-Streit
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text behandelt die historische und theologische Entwicklung des Filioque-Streits als zentralen Punkt der Spaltung zwischen Ost- und Westkirche. Er analysiert die Bedeutung dieses Streits über den Ursprung des Heiligen Geistes und seine Rolle im Großen Schisma, wobei sowohl theologische Argumente als auch politische und historische Kontexte berücksichtigt werden.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text umfasst die historische Entwicklung des Filioque-Streits, die theologischen Positionen der Ost- und Westkirche, den Einfluss des Arianismus und des Adoptianismus, die Rolle politischer Machtstrukturen und gegenwärtige ökumenische Bemühungen. Die Vorgeschichte der Spaltung wird ausführlich dargestellt, beginnend mit dem Arianismus und der Entwicklung des christlichen Glaubensbekenntnisses. Die Kapitel beleuchten die Rolle der Reichseinheit und die politischen und theologischen Auseinandersetzungen, die zur Spaltung beitrugen, sowie die komplexen theologischen Argumente der verschiedenen Positionen.
Welche Personen werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt wichtige theologische Persönlichkeiten wie Athanasius, Augustin, Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin, Photios und Gregor Palamas. Auch historische Figuren wie Kaiser Konstantin und Karl der Große werden im Kontext der politischen Einflüsse auf den Streit um den Filioque erwähnt. Der Text bezieht sich außerdem auf die Ansichten zeitgenössischer Theologen wie Athanasios Vletsis, Peter Knauer und Friedrich-Wilhelm Marquardt bezüglich der gegenwärtigen ökumenischen Diskussion.
Welche Schlüsselereignisse werden im Text beschrieben?
Der Text beschreibt die Entwicklung des Glaubensbekenntnisses, den Arianismus, den Adoptianismus, verschiedene Konzilien (z.B. Nizäa, Bari, Lyon, Ferrara/Florenz), den Bilderstreit und das photianische Schisma. Die Rolle der Karolingischen Theologie und die politischen Machtkämpfe zwischen Ost und West werden ebenfalls beleuchtet.
Welche theologischen Aspekte werden im Detail erklärt?
Der Text behandelt ausführlich die trinitätstheologischen Voraussetzungen des Filioque-Streits, die unterschiedlichen Auffassungen über den Ursprung des Heiligen Geistes in Ost und West und die Argumente wichtiger Theologen zu diesem Thema. Die unterschiedlichen Positionen werden in ihren historischen und theologischen Kontexten dargestellt.
Welche Rolle spielten politische Faktoren in der Spaltung?
Der Text betont die enge Verknüpfung zwischen theologischen Auseinandersetzungen und politischen Machtstrukturen. Er analysiert, wie politische Mächte, wie die Karolingern, theologische Unterschiede instrumentalisierten, um ihre Herrschaft zu legitimieren, und wie dies zur Zuspitzung des Konflikts beitrug. Die Rolle der Kaiser und deren Einfluss auf die Kirchenpolitik wird ebenfalls behandelt.
Wie steht der Text zum gegenwärtigen ökumenischen Dialog?
Der Text erwähnt die gegenwärtigen ökumenischen Bemühungen und berücksichtigt die Standpunkte heutiger Theologen aus orthodoxer, katholischer und protestantischer Perspektive. Dies verdeutlicht den bis heute andauernden Dialog und die Bedeutung der Thematik für den ökumenischen Prozess.
Was sind die zentralen Schlussfolgerungen des Textes?
Der Text zeigt, dass der Filioque-Streit nicht nur ein theologischer Disput war, sondern tief in die Geschichte und Politik der Ost-West-Beziehungen verwoben ist. Er betont die Komplexität der theologischen Argumente und die andauernde Bedeutung dieser Spaltung für die heutige Ökumene. Die scheinbar kleine theologische Differenz hatte weitreichende historische Folgen.
- Quote paper
- Daniel Koporcic (Author), 2009, Filioque: Die Kontroverse um den Hervorgang des Heiligen Geistes in historischer und theologischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137625