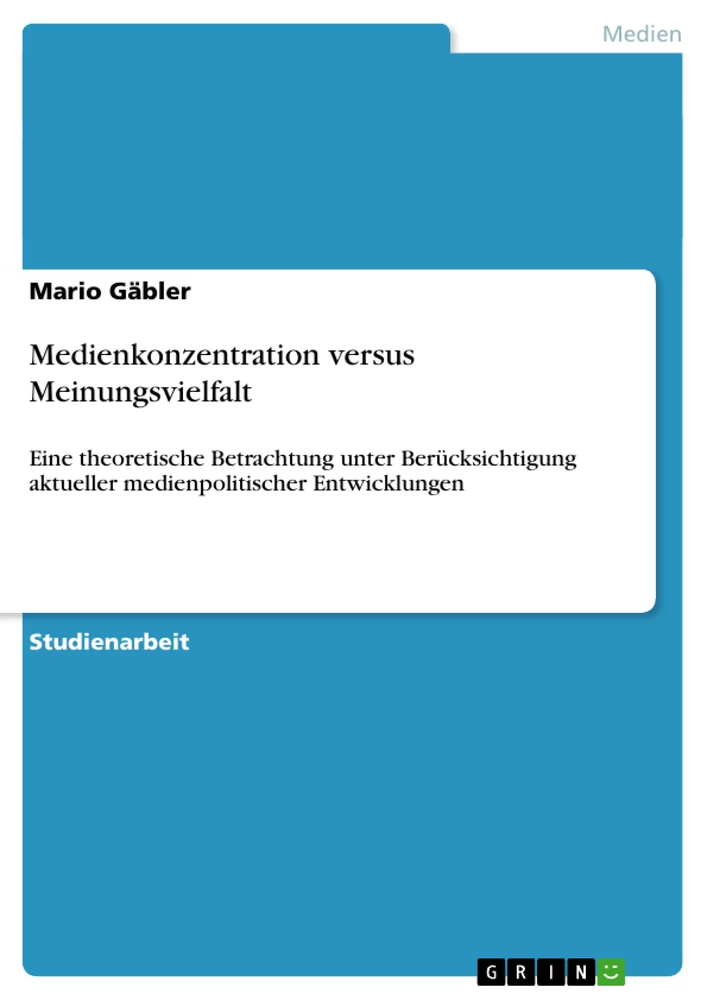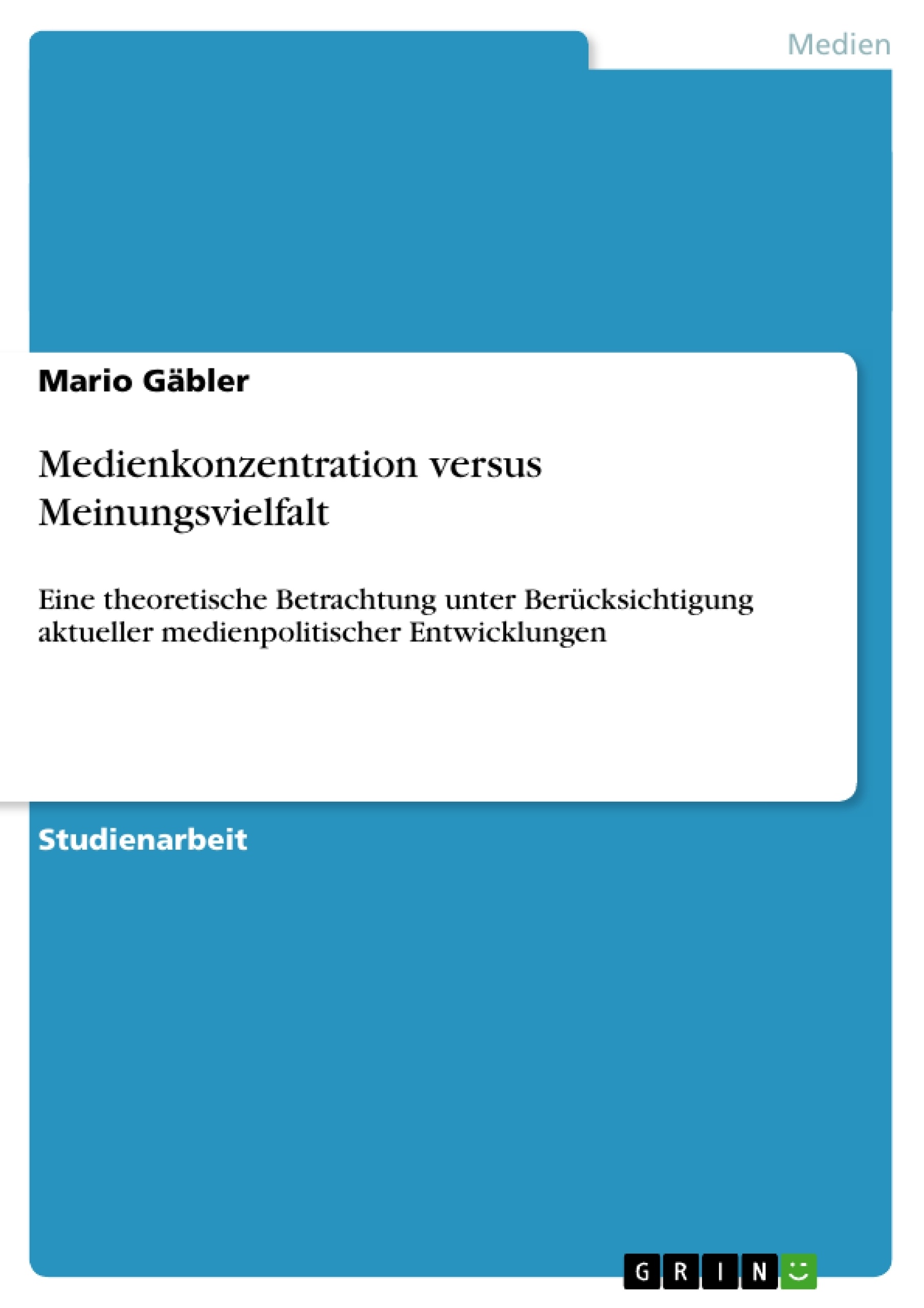Die deutschen Medien haben vom Gesetzgeber und von der Judikative die öffentliche Aufgabe zugewiesen bekommen, nicht nur den Kommunikations- und Meinungsbildungsprozess in Gang zu setzen, indem sie einen Meinungsmarkt herstellen. Sie konstituieren auch ein politisches Forum, welches die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und seinen Repräsentanten ermöglicht. Sie sind damit ein Organ der Kontrolle und Kritik des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschehens in Deutschland.
Die Konzentrationsprozesse im Bereich der Medien in den letzten Jahren führen zu der Frage, inwieweit die Medien ihre konstitutive Aufgabe für ein Funktionieren des demokratischen Gemeinwesens noch wahrnehmen können. An den Fallbeispielen der Übernahme der ProSiebenSat.1-Media AG durch den Axel Springer-Konzern und der Übernahme der „Berliner Zeitung“ durch David
Montgomery & Co. werden die aktuellen Differenzen zwischen Politik und Wirtschaft, sowie der Konflikt zwischen Medienkonzentration und Meinungsvielfalt näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis:
1. Ausgangssituation und Fragestellung
2. Theoretische Grundlagen der Diskussion
2.1. Zu den Ursachen der Konzentration
2.2. Formen wirtschaftliche Konzentration
2.3. Zum Problem der Messung von Konzentration und Vielfalt
3. Aktuelle Diskussionen und Verhandlungen zum Thema
3.1. Exkurs: Übernahme der ProSiebenSat.1-Media AG durch den Axel Springer-Konzern
3.1.1. Die Hintergründe der Übernahme
3.1.2. Die Argumentationen von Bundeskartellamt und KEK
3.1.3. Mögliche Lösungen und der Ausgang der Verhandlungen
3.2. Exkurs: Übernahme der „Berliner Zeitung“ durch David Montgomery & Co.
4. Zusammenfassung und Fazit
5. Anhang: Chronik des Übernahme-Streits um ProSiebenSat
6. Literaturverzeichnis
1. Ausgangssituation und Fragestellung
Diskussionen um das Thema Medienkonzentration müssen immer im Lichte der Be-sonderheiten des Medienmarktes geführt werden. So wird der Medienmarkt im Ge-gensatz zu anderen volkswirtschaftlichen Teilmärkten nicht nur von wirtschaftlichen Elementen geprägt, sondern auch und insbesondere von publizistischen und politi-schen, ferner von soziologischen. Dabei stehen sich die zwei zentralen Ebenen der Ökonomik und der Publizistik divergent gegenüber und bilden zwei Pole eines Systems, welches nur durch eine ausgewogene Behandlung dieser beiden Ebenen den Auftrag erfüllen kann, den es durch Legislative (insb. Grundgesetz) und Judikative (insb. Bundesverfassungsgericht) auferlegt bekommen hat: die Erfüllung einer Öf-fentlichen Aufgabe.1
Eigene Grafik: Verortung der Diskussion im Spannungsfeld zwischen Publizistik und Ökonomik.
Die Medien setzen im Zuge dieser Öffentlichen Aufgabe nicht nur den Kommunika-tions- und Meinungsbildungsprozess in Gang, indem sie einen Meinungsmarkt her-stellen. Sie konstituieren auch ein politisches Forum, welches die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und seinen Repräsentanten ermöglicht. Sie sind damit ein Organ der Kontrolle und Kritik des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ge-schehens.
Die sich hieraus ergebende konstitutive Bedeutung der Medien für ein Funktionieren des demokratischen Gemeinwesens ist ein wesentlicher Faktor in der Diskussion um Medienkonzentration. Denn zusätzlich zum rein wirtschaftlichen Begriff der Kon-zentration wird durch den Einbezug der publizistischen Ebene ein divergenter Terminus eingeführt, der Begriff der Meinungsvielfalt. Eine Behandlung des Medien-marktes unter rein ökonomischen Gesichtspunkten, wie sie die EU mit ihrem Grund-satz der Freiheit des Binnenmarktes verfolgt, scheidet für die Medien damit von vorn herein aus.
Der Oberbegriff der Vielfalt als „zentrale Norm der Publizistik“2 unterliegt dabei einer Differenzierung in die Vielfalt der Medien auf der einen Seite – welche insbe-sondere von Schütz analysiert wird3 – und die Vielfalt der Meinungen, d. h. die Be-rücksichtigung unterschiedlicher Sichtweisen in den Medien auf der anderen Seite. „Allerdings existiert kein Maß an ‚optimaler Vielfalt’, ebenso wenig lässt sich ein Unter- oder gar eine Überversorgung mit Vielfalt nach breit gestützten objektiven Kriterien festlegen.“4 Ein Problem, auf das in Abschnitt 2.3. näher eingegangen wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Abgrenzung der Untersuchungsbereiche.
Der Einfluss der Meinungsvielfalt erfordert somit eine Betrachtung des Themas aus einer Perspektive heraus, die sich nicht ausschließlich von einer der beiden Ebenen vereinnahmen lässt. Was dies bedeutet, wird in der (Zusammen)arbeit von Bundes-kartellamt und KEK deutlich, auf die an späterer Stelle im Zusammenhang mit einem der beiden aktuellen Konzentrationsprozesse näher eingegangen werden soll.
Ziel der Arbeit soll es sein, in einem ersten Teil die theoretischen Grundlagen zu erarbeiten, die zum Verständnis zweier aktueller Fallbeispiele in der Diskussion um das Thema Medienkonzentration und Meinungsvielfalt notwendig sind, welche im zweiten Teil der Arbeit vorgestellt werden sollen.
Dabei ist es aufgrund der Kürze der Arbeit kaum möglich, auf alle für die Diskussion relevanten Begrifflichkeiten und Faktoren einzugehen. Zum besseren Verständnis der Problematik sollen jedoch die wichtigsten Problemfelder und Termini im Folgenden aufgezeigt und eingegrenzt werden.
2. Theoretische Grundlagen der Diskussion
2.1. Zu den Ursachen der Konzentration
Die eingangs beschriebene notwendige Differenzierung des Blickwinkels auf die zwei Diskursebenen beginnt bereits bei der Frage nach den Ursachen von Medien-konzentration. Medienökonomische Antriebskräfte werden von Jürgen Heinrich aus der Volkswirtschaftslehre abgeleitet und auf den Mediensektor heruntergebrochen.5 Die generelle Kategorisierung der Ursachen der Konzentration in Macht- und Effi-zienzvorteile lässt sich dabei aber ggf. auch auf das publizistische Feld anwenden.
Machtvorteile werden von Heinrich als eine Form der Reduktion des Handlungs-spielraumes diagnostiziert. „Machtvorteile kann ein Medienunternehmen realisieren, wenn es in die Lage versetzt wird, andere Marktteilnehmer zu behindern oder auszu-beuten.“6 Aus diesen Gründen hält beispielsweise der WAZ-Konzern seit Jahren an defizitären Unternehmen wie der Zeitungsgruppe Thüringen oder diversen Anzei-genblättern fest. Im Falle der Tageszeitungen folgt diese Vorgehensweise dem Prin-zip, potenzielle Wettbewerber vom Markt fernzuhalten, frei nach dem Motto: lieber ein paar Verluste machen, als einem großen Wettbewerber Gewinne zu gönnen – abgesehen davon, dass man Verluste konzernintern ausgleichen bzw. steuerlich ab-schreiben kann. Bei dem konzerneigenen Anzeigenblatt in Thüringen – einer Me-diengattung, bei dem eigentlich noch ein relativ freier Marktzugang möglich ist – folgte der ruinöse Wettbewerb mit einem Konkurrenten („Wochenblatt“) nicht nur diesem Prinzip, sondern auch der Überlegung, die zunehmend von den Tageszeitun-gen auf die Anzeigenblätter sich umlagernden Werbeerlöse abzufangen.
Da die Machtvorteile der Konzentration allerdings nur schwer zu messen sind, be-schränkt sich Heinrich auf eine ausführliche Darstellung der Effizienzvorteile.7 Die wichtigsten seien im Folgenden kurz aufgezählt ohne sie theoretisch detailliert erläu-tern zu wollen. Größenvorteile (economies of scale) ergeben sich seiner Meinung nach für Medienunternehmen kaum oder gar nicht. Anders sieht es aus mit Verbund-vorteilen der Produktion (economies of scope). Hier bestehen erhebliche Gefahren für die Meinungsvielfalt durch „multimediale Mehrfachnutzung der gleichen Inputs wie Recherche, Lieferungen von Nachrichtenagenturen und Korrespondenten, [...]“, ebenso wie durch Verbund einer gemeinsamen Werbung, „insbesondere durch Schaffung von Aufmerksamkeit durch redaktionelle Hinweise auf das Rundfunkpro-gramm eines verbundenen Senders“8, etc. Allgemeine wirtschaftliche Faktoren wä-ren darüber hinaus die Fixkostendegression und die Ersparnis von Transaktionskos-ten.
2.2. Formen wirtschaftliche Konzentration:
Üblicherweise werden die Konzentrationsformen auf Basis wirtschaftlicher Verflech-tungen voneinander unterschieden. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB, umgangsprachlich: Kartellgesetz) und die darauf aufbauende Rechtsspre-chung bilden die unmittelbare theoretische Grundlage für die übliche Unterscheidung der Konzentration nach ihrer Natur in horizontal, vertikal und diagonal. Dabei ist aufgrund der Komplexität der Medienbranche eine zusätzliche Unterscheidung der diagonalen Konzentration nötig.
(1) Die horizontale Konzentration bezeichnet einen Zusammenschluss von Unter-nehmen auf derselben Produktionsstufe, wodurch die Angebots- und damit die Mei-nungsvielfalt auf einem bestimmten Markt reduziert werden. Ein klassisches Beispiel im Mediensektor ist die Konzentrationsphase der Presse der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1954 und 1964, die sowohl ökonomischer als auch publizisti-scher Natur war und einen gravierenden Einfluss auf die Meinungsvielfalt hatte. In neuerer Zeit fand nach Übernahme der ProSiebenSat.1-Media AG durch den us-amerikanischen Investor Haim Saban im Jahr 2003 eine publizistische Konzentration im Bereich der Fernsehnachrichten auf den Sendern der Gruppe statt (identische Nachrichtenbeiträge auf allen Sendern, nur die Moderationen unterscheiden sich). Die hierdurch massiv eingeschränkte Meinungsvielfalt auf der Sendergruppe dürfte ein wichtiger Faktor im aktuellen Fusionsmonopoly sein.
(2.) Vertikale Konzentration findet durch Verbindung von Unternehmen aufeinander folgender Produktionsstufen (vor- und nachgelagert) statt und führt zur Einsparung von Handelsspannen. Im Printbereich wäre dies beispielsweise die Verbindung von Nachrichtenagentur, Papierlieferant, Verlag, Drucker und Vertrieb. Diese Konzentra-tionsform mindert die Meinungsvielfalt insofern, als beispielsweise ein in den Pres-segroßhandel vorwärtsintegrierter Verlag die Verbreitung einer Zeitung eines kon-kurrierenden Verlags stören könnte. Eine solche Behinderung des Marktzutritts für Konkurrenten ist ebenso durch Kontrolle der vorgelagerten Produktionsebenen denkbar. Vorwiegend ist diese Konzentrationsform jedoch wirtschaftlicher Natur. Sie beeinflusst damit die Meinungsvielfalt nicht in dem Maße wie die horizontale oder die folgend beschriebene diagonale Konzentration.
(3.) Die diagonale Konzentration wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Während Jürgen Heinrich in ihr – negativ definiert – einen Zusammenschluss sieht, der weder horizontaler noch vertikaler Natur ist9, dürfte für den Medienmarkt eine zusätzliche Unterscheidung von diagonaler und konglomerater Konzentration von Vorteil sein. So wäre die diagonale Konzentration – im Gegensatz zur monomedialen horizontalen Konzentration – multimedialer Natur und damit weiterhin nur auf dem Mediensektor beheimatet. Beispiele wären ein Engagement von Zeitungsverlegern im Zeitschriftengeschäft (WAZ - GONG-Verlag), bei Fernsehsendern (WAZ - bis vor Kurzem bei RTL) oder beim Radio (WAZ - mehrheitsgesellschaftliche Beteili-gungen an 10 Radiosendern in NRW). Hier ergeben sich Synergieeffekte sowohl durch eine zusätzliche Verwertungsmöglichkeit von Inhalten, als auch durch ein Ab-fangen von sich auf die verschiedenen Medien verteilenden Werbeumsätze. Als ge-fährlich für die Meinungsvielfalt – weil konzentrationsfördernd – wäre hier auch die Cross-Promotion zu nennen, also die gegenseitige bevorzugte Bewerbung von Inhal-ten der verbundenen Unternehmen zum Nachteil Außenstehender.
(4). Die konglomerate Konzentration wäre hingegen auf die gesamte Wirtschaft aus-gedehnt und würde somit eine Verknüpfung branchenfremder Unternehmen mit Un-ternehmen der Medienwirtschaft kennzeichnen, wie die Beteiligung von Versiche-rungen und Energiekonzernen an Unternehmen der Medienbranche oder die Beteili-gung von Banken über Kredite am „Kirch-Imperium“. Hier ergäben sich nicht zwangsweise negative Wirkungen auf die Meinungsvielfalt, sofern das beteiligte Unternehmen keinen Druck auf das entsprechende Medium ausübt und damit den Entscheidungs- und Handlungsspielraum in Bezug auf Meinungen reduziert.
[...]
1 Erwähnung u.a. in allen Landespressegesetzen mit Ausnahme des Hessischen.
2 Meier 2003, S. 6.
3 Beispielsweise: Schütz, Walter J.: Deutsche Tagespresse 2001. In: Media Perspektiven 12/2001, S. 602ff., und fortlaufende Ausgaben.
4 Meier 2003, S. 6.
5 Heinrich 2001, S. 128ff.
6 Ebd.
7 Ebd.
8 Ebd., S. 133.
9 Heinrich 2001, S. 144.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Medienkonzentration und Meinungsvielfalt?
Medienkonzentration bezeichnet den wirtschaftlichen Zusammenschluss von Medienunternehmen. Meinungsvielfalt hingegen ist die publizistische Norm, dass unterschiedliche Sichtweisen in den Medien repräsentiert sein müssen.
Warum ist Meinungsvielfalt für die Demokratie wichtig?
Vielfältige Medien ermöglichen einen freien Meinungsmarkt, dienen der Kontrolle politischer Macht und stellen ein Forum für den gesellschaftlichen Diskurs dar.
Was versteht man unter horizontaler Medienkonzentration?
Dies ist der Zusammenschluss von Unternehmen auf der gleichen Ebene, etwa wenn ein Zeitungsverlag einen anderen kauft, was die Anzahl unabhängiger Stimmen direkt reduziert.
Welche Rolle spielt die KEK (Kommission zur Ermittlung der Konzentration)?
Die KEK prüft im Bereich des Fernsehens, ob durch Zusammenschlüsse eine vorherrschende Meinungsmacht entsteht, die die publizistische Vielfalt gefährdet.
Was sind Effizienzvorteile durch Konzentration?
Unternehmen können Kosten sparen (z.B. durch gemeinsame Recherche oder Verwaltung), was jedoch das Risiko birgt, dass in verschiedenen Medien identische Inhalte verbreitet werden.
- Quote paper
- Mario Gäbler (Author), 2006, Medienkonzentration versus Meinungsvielfalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137622