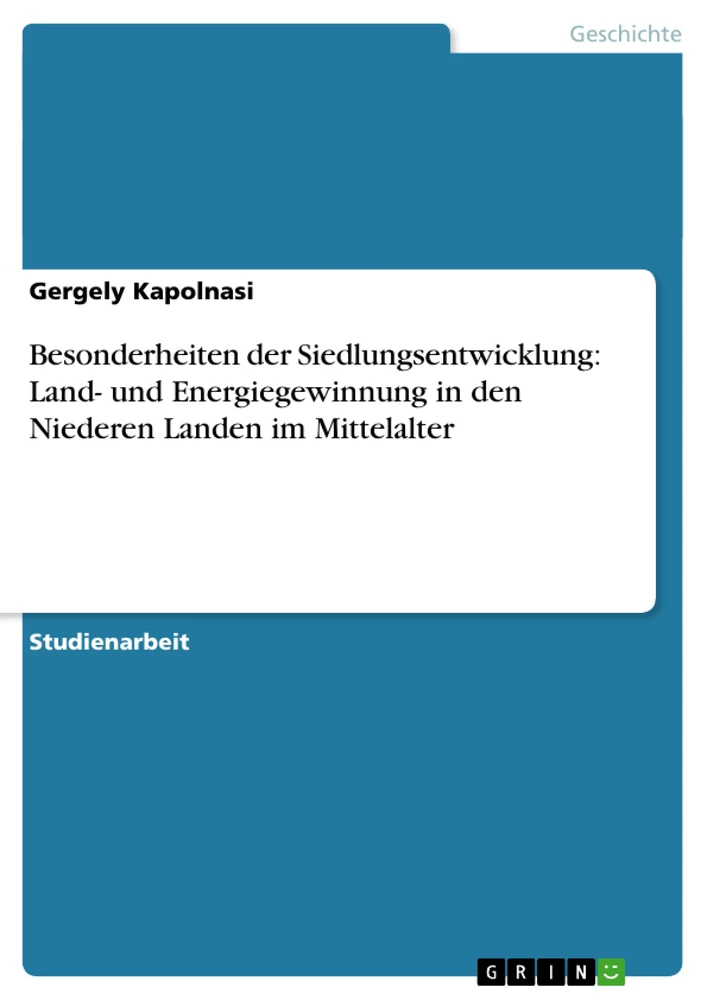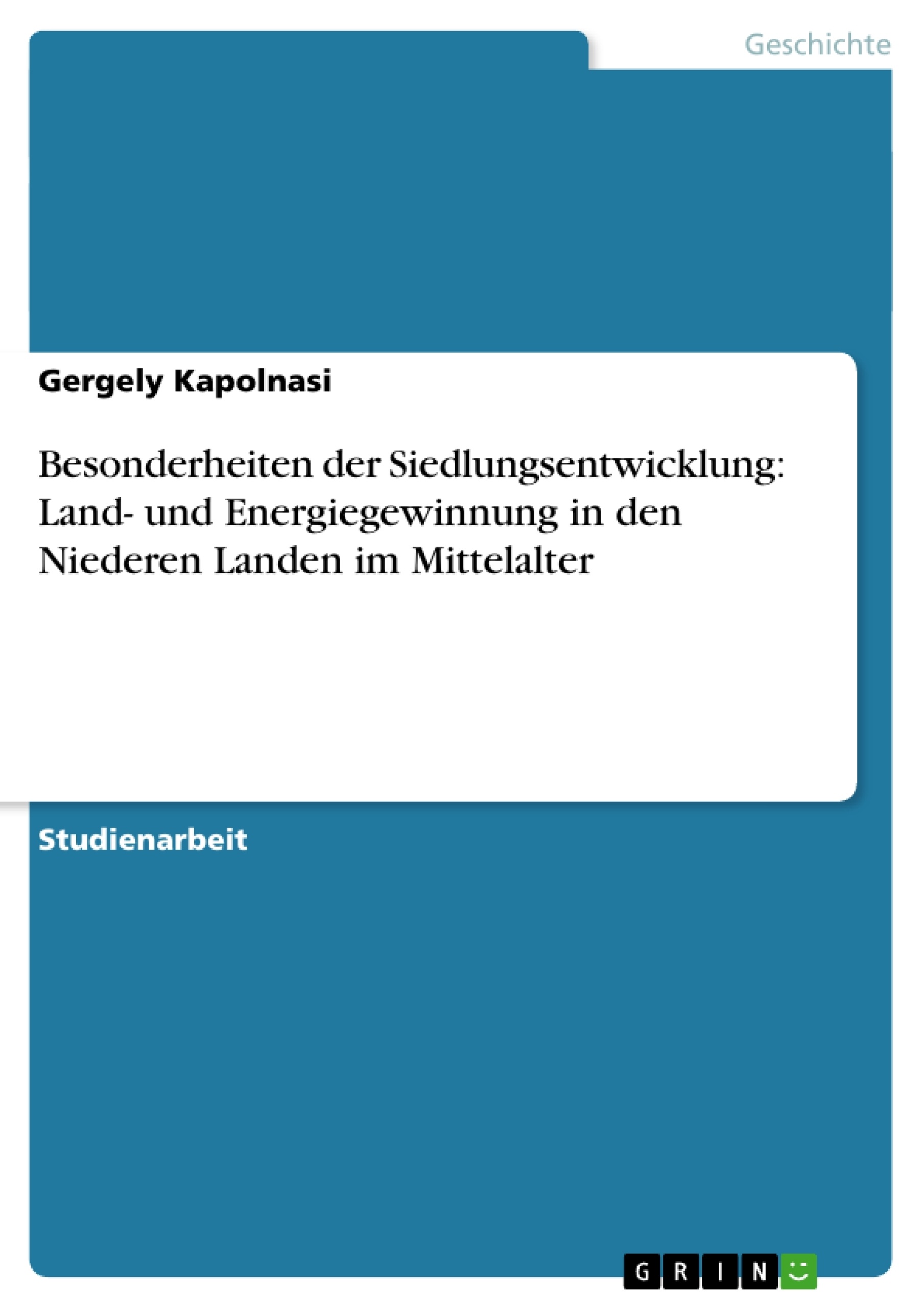Fährt der aufmerksame Beobachter durch die heutigen Niederlande, fallen ihm mehrere Eigenheiten dieses Landes auf. Zum einen ist die Dominanz des Wassers allgegenwärtig. Dies gilt nicht nur für die Küstenregionen sondern auch für das Innere des Landes. Die Landschaft wird schier durchpflügt von kleineren und größeren Kanälen und Schleusen. Eine weitere Besonderheit der Niederlande ist die Tatsache, dass große Teile des Landes unterhalb oder nur wenige Meter oberhalb des Meeresspiegels liegen. Diese Landstriche werden durch ein komplexes System aus Deichen und Dämmen vor Überschwemmungen geschützt. Die Niederlande gehören zudem zu den am dichtesten besiedelten Regionen unserer Erde.
Doch wie entstand jene Landschaft mit ihren Kanälen, Deichen, Dämmen und Windmühlen? Die Ursprünge dieses komplexen Systems liegen im Mittelalter. Vor dem 9. Jahrhundert waren weite Teile der heutigen Niederlande unbewohnbar. So weit das Auge sah, erstreckten sich schier endlose Weiten einer Moorlandschaft. Dennoch konnten die Menschen des Hoch- und Spätmittelalters diesem Gelände nutzbares Land abgewinnen. Mit diesem Prozess der Landgewinnung beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Im ersten Abschnitt soll darauf eingegangen werden, mit welchen Techniken die Menschen das Land in nutzbare Flächen verwandelten und welche tiefgreifenden Konsequenzen dies hatte. Da Wasser vor von Menschenhand gezogenen Grenzen keinen Halt macht und somit zur regionenübergreifender Zusammenarbeit zwingt, soll im anschließenden Abschnitt diskutiert werden, wie die Landgewinnung politisch und gesellschaftlich organisiert war. Ab einem bestimmten Punkt war die Entwässerung der Moore mit einfachen Techniken nicht mehr zu bewerkstelligen. Daher soll im dritten Abschnitt auf die mechanische Entwässerung durch Windmühlen eingegangen werden. Auch hinsichtlich der Energiegewinnung stellen die Niederlande aufgrund ihrer Topografie eine Besonderheit dar. Deshalb soll im letzten Abschnitt dieser Aspekt erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
1. LANDGEWINNUNG IN DEN NIEDEREN LANDEN BIS ZUM ENDE DES 15 JAHRHUNDERTS
2. DIE POLITISCHE ORGANISATION DER LANDGEWINNUNG
3. MECHANISCHE ENTWÄSSERUNG DURCH WINDMÜHLEN
4. ENERGIEGEWINNUNG
FAZIT
LITERATURVERZEICHNIS
Einleitung
Fährt der aufmerksame Beobachter durch die heutigen Niederlande, fallen ihm meh-rere Eigenheiten dieses Landes auf. Zum einen ist die Dominanz des Wassers allge-genwärtig. Dies gilt nicht nur für die Küstenregionen sondern auch für das Innere des Landes. Die Landschaft wird schier durchpflügt von kleineren und größeren Kanälen und Schleusen. Eine weitere Besonderheit der Niederlande ist die Tatsache, dass große Teile des Landes unterhalb oder nur wenige Meter oberhalb des Meeresspie-gels liegen. Diese Landstriche werden durch ein komplexes System aus Deichen und Dämmen vor Überschwemmungen geschützt. Die Niederlande gehören zudem zu den am dichtesten besiedelten Regionen unserer Erde.
Doch wie entstand jene Landschaft mit ihren Kanälen, Deichen, Dämmen und Windmühlen? Die Ursprünge dieses komplexen Systems liegen im Mittelalter. Vor dem 9. Jahrhundert waren weite Teile der heutigen Niederlande unbewohnbar. So weit das Auge sah, erstreckten sich schier endlose Weiten einer Moorlandschaft. Dennoch konnten die Menschen des Hoch- und Spätmittelalters diesem Gelände nutzbares Land abgewinnen. Mit diesem Prozess der Landgewinnung beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Im ersten Abschnitt soll darauf eingegangen werden, mit welchen Techniken die Menschen das Land in nutzbare Flächen verwandelten und welche tiefgreifenden Konsequenzen dies hatte. Da Wasser vor von Menschenhand gezogenen Grenzen keinen Halt macht und somit zur regionenübergreifender Zu-sammenarbeit zwingt, soll im anschließenden Abschnitt diskutiert werden, wie die Landgewinnung politisch und gesellschaftlich organisiert war. Ab einem bestimmten Punkt war die Entwässerung der Moore mit einfachen Techniken nicht mehr zu be-werkstelligen. Daher soll im dritten Abschnitt auf die mechanische Entwässerung durch Windmühlen eingegangen werden. Auch hinsichtlich der Energiegewinnung stellen die Niederlande aufgrund ihrer Topografie eine Besonderheit dar. Deshalb soll im letzten Abschnitt dieser Aspekt erörtert werden.
Schriftliche Quellen sind besonders aus der Anfangszeit der Besiedlung der Moore rar, so dass viele Informationen aus archäologischen, geologischen und naturwissen-schaftlichen Quellen stammen.
1. Landgewinnung in den Niederen Landen bis zum Ende des 15. Jahrhunderts
Betrachtet man die Topografie der heutigen Niederlande, fallen einige Besonderhei-ten dieses Landstrichs auf. Etwa ein Viertel des Landes liegt unter dem Meeresspie-gel, weitere 40 Prozent kaum darüber. Ein komplexes System aus Deichen, Kanälen und Schleusen durchzieht das Land, führt überschüssiges Wasser ab und schützt es vor den Fluten des Meeres.1
Die historische Forschung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ging davon aus, dass die Niederen Lande des frühen Mittelalters eine ähnliche Topografie aufgewiesen hatten wie die heute sichtbare Landschaft. Man nahm an, das Land habe sich durch die Besiedlung kaum gewandelt. Die Folge dieser Vermutung war, dass man bereits für die frühe Besiedlung der Niederen Lande ein System aus Deichen als Schutz vor Überflutungen voraussetzte. In der Mitte des 20. Jahrhunderts konnte Hendrik van der Linden jedoch nachweisen, dass die ersten größeren Deichanlagen in den Niede-ren Landen erst um das Jahr 1200 errichtet worden waren. Van der Linden ging von der Annahme aus, das Gelände sei vor der im 9. Jahrhundert n. Chr. beginnenden Besiedlung des Inlandes um einige Meter höher gewesen als am Ende des Mittelal-ters, als bereits große Teile der Niederen Lande zu den am dichtesten bevölkerten Landstrichen Europas gehörten. Geologische und archäologische Untersuchungen konnten seitdem belegen, dass die Vermutung van der Lindens zutrifft. Die extrem flache Topografie der Niederen Lande hatte dazu geführt, dass die Fließgeschwin-digkeit der Flüsse sich stark verlangsamte. Dünen an den Küsten hatten das Land zwar vor dem Meer geschützt, hatten jedoch auch den Abfluss des überschüssigen Wassers behindert. Der dadurch verursachte Wasserstau hatte den Grundwasserspie-gel angehoben, in weiten Teilen des Inlandes entstanden ausgedehnte Torfmoore. Torf besteht aus abgestorbenen Pflanzenteilen, die aufgrund des hohen Grundwasser-spiegels unter Sauerstoffabschluss stehen und somit nicht zersetzt werden können. Auf dem Torf gedeihen Torfmoose, die nach ihrem Absterben ebenfalls nicht zerfal-len können und somit als Grundlage für ein Wachstum der Torfschichten dienen. In weiten Teilen der Niederen Lande bewirkte dieses Prinzip, dass die abgelagerten Schichten mit der Zeit immer mächtiger wurden, so dass das Gelände auf einige Me- ter über den Meeresspiegel anstieg. Bis zum Frühmittelalter war in dem Gebiet zwi-schen den Sanddünen an der Küste und den höher gelegenen Regionen im Osten ein 30-80 km breiter Streifen des Torfmoors entstanden.2
Bis zum 9. Jahrhundert waren große Teile des Tieflandes der Niederen Lande nicht besiedelt. Die Menschen lebten an den höher gelegenen Ufern der Flüsse und auf den Dünen entlang der Küsten. Da diese natürlichen Erhebungen in Teilen der Niederen Lande selten anzutreffen sind, begannen die Menschen künstliche Siedlungshügel zu schaffen, um Lebensraum zu gewinnen. Diese sogenanntenterpenwaren besonders in Friesland, im Norden der Niederen Lande, verbreitet. Sie sind bereits aus der Rö-merzeit überliefert. Auf dem höchsten Punkt dieser künstlichen Hügel errichtete man die Siedlung. Bei Hochwasser wurde das umgebende Land überflutet, die Spitze derterpenmit den Siedlungen ragten jedoch wie Inseln aus dem Wasser.3
Archäologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass im 9. Jahrhundert die Be-wohner des Tieflandes der Niederen Lande begannen, auch die bisher unbewohnten Torfmoore zu besiedeln. Hierfür gab es zwei Gründe. Erstens boten die natürlichen Erhebungen keinen ausreichenden Raum mehr für eine ständig wachsende Bevölke-rung. Zweitens begann man zu dieser Zeit die Landwirtschaft auf Getreideproduktion auszurichten und suchte nun geeignetes Ackerland. Die ausgedehnten Torfmoore waren äußerst fruchtbare Regionen, allerdings mussten sie vor einer landwirtschaftli-chen Nutzung entwässert werden. Die ersten Siedlungen im Gebiet der Torfmoore entstanden in Nord-Holland, Friesland und Zeeland sowie entlang der Wasserläufe in Süd-Holland und um Utrecht. Von diesen Regionen breiteten sich die Siedlungen nach und nach über das gesamte Gebiet aus, das ehemals von den Torfmooren be-herrscht worden war.4
Wie bereits erwähnt, musste das Land, bevor es für die Landwirtschaft genutzt wer-den konnte, zunächst entwässert werden. Dies erreichte man, indem man in regelmä-ßigen Abständen Kanäle grub, die das Wasser sammelten und in natürliche Wasser-läufe abführten. Dadurch sank der Grundwasserspiegel, das Land wurde nutzbar. Niedrige Dämme wurden zudem errichtet, um die bereits entwässerten Regionen vor eindringendem Wasser aus noch unerschlossenen Gebieten zu schützen.5
Die großflächige Entwässerung des Landes stellte die Menschen jedoch bald vor unerwartete Probleme. Torfmoose können zu bis zu 90% aus Wasser bestehen. Sinkt der Grundwasserspiegel, trocknen sie aus und verlieren dementsprechend an Volu-men. Dies gilt genauso, wenn auch in geringerem Maße, für den Torf selbst. Bei sin-kendem Grundwasser tritt zudem ein weiteres Problem auf. Die nur unvollständig zersetzten Pflanzenteile kommen mit Sauerstoff in Kontakt, so dass nun der Zerset-zungsprozess beginnen kann. Dies führt zu einem weiteren Verlust an Volumen. Die Folge dieser Prozesse war ein Absinken des Geländes. Dieses Problem wurde noch verstärkt durch die Nutztiere der Siedler, die den Boden beim Weiden durch ihr Ge-wicht weiter komprimierten. Petra van Dam schätzt die Absinkrate auf etwa einen Meter pro Jahrhundert. Das Absinken des Geländes verursachte ein noch geringeres Gefälle in dem ohnehin schon flachen Land, so dass das Entwässern der neugewon-nenen Gebiete immer schwieriger wurde. Als Konsequenz mussten Siedlungen in höher gelegene Regionen verlegt werden. Dies funktionierte jedoch nur, solange es noch unerschlossene und damit höher gelegene Gebiete gab. Irgendwann stieß man jedoch auf bereits erschlossenes Gebiet und konnte nicht mehr weiter zurückwei-chen. Zudem wurden die entwässerten Regionen anfälliger für Überflutungen. Be-sonders im 12. und 13. Jahrhundert führten Sturmfluten zu verheerenden Über-schwemmungen. Die Menschen erkannten, dass sie Gegenmaßnahmen treffen muss-ten, wollten sie das neugewonnene Land nicht wieder verlieren. Im 12. Jahrhundert begann man nun Deiche und Dämme systematisch zu bauen, um die entwässerten Gebiete vor Wasser von außen zu schützen. Man kann also entgegen der For-schungsmeinung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts behaupten, dass der Deichbau die Konsequenz der Besiedlung des Tieflandes der Niederen Lande war und nicht die Voraussetzung.6
Deiche und Dämme nutzte man bereits vor dem 12. Jahrhundert. Sie verliefen haupt-sächlich entlang von Küstenabschnitten und an den Ufern der großen Flüsse. Zudem schützte man neu gewonnenes Land durch Dämme vor eindringendem Wasser aus noch unberührten Gebieten. Dies waren allerdings keine zusammenhängenden Sys-teme, diese Dämme umschlossen das Land nicht komplett. Im 12. Jahrhundert be-gann man Deichsysteme zu errichten, indem man bestehende Anlagen zu größeren Komplexen verband. Da das Land nicht überall in dem gleichen Maß absank, errich- tete man auch im Inland Deiche. Diese trennten höher gelegenes Gelände von tiefe-ren Bereichen. So entstanden die sogenannten Polder, von Deichen komplett um-schlossene Gebiete unterschiedlicher Höhe.7
Dieses System brachte jedoch wiederum ein Problem mit sich. Die rasch steigende Zahl der Deiche und Dämme ließ immer weniger Platz, um überschüssiges Wasser aus einem Gebiet hinauszuführen. Dieses Problem löste man durch Schleusen, wel-che in die Dämme und Deiche eingebaut wurden.8
Das Absinken des Landes bewirkte mit der Zeit einen Wandel der Wirtschaftsweise sowie der Erwerbs- und Siedlungsstrukturen. Teile des Landes waren bis in das 13. Jahrhundert bereits so tief abgesunken, dass Landwirtschaft nicht mehr möglich war. Die Entwässerungskanäle konnten das Wasser nicht mehr abführen, so dass im Winter ganze Landstriche über Monate überflutet waren. Die Bauern in diesen Regionen passten sich der neuen Situation an und wechselten allmählich vom Getreideanbau zur Viehzucht. Weideland reagiert im Gegensatz zu Ackerland nicht so empfindlich auf Überschwemmungen und einen hohen Grundwasserspiegel. Die Wirtschaftslage zu der Zeit begünstigte diese Entwicklung. Die wachsenden Städte boten einen Markt für tierische Produkte. Die Getreideüberproduktion im Norden Deutschlands und im baltischen Raum führte zu einem Verfall der Getreidepreise. Die Bauern der Niederen Lande konnten also ihre tierischen Produkte in den Städten teuer absetzen und dafür billiges Korn einkaufen. Die zahlreichen Kanäle, die das Land durchzogen, dienten als Transportwege und förderten den Handel zusätzlich. Es ist somit ein Wandel von der Subsistenzwirtschaft auf eine marktorientierte Produktion zu beo-bachten.9
Dieser Strukturwandel brachte jedoch noch andere Änderungen mit sich. Viehzucht erforderte nicht so viele Arbeitskräfte wie Ackerbau. Die nun arbeitslos gewordenen Landarbeiter zogen in Scharen in die Städte und förderten dort den rasch fortschrei-tenden Prozess der Urbanisierung. Sie fanden Arbeit im Handel und im Transportwe-sen und trugen dazu bei, dass die Niederen Lande eine wirtschaftlich florierende Region mit den größten Städten des Reiches wurde.10
[...]
1 TeBrake 2002, S. 475.
2 TeBrake 2002, S. 477-480.
3 Savenije 1996/97, S. 15; TeBrake 2002, S. 480.
4 TeBrake 2002, S. 481f.
5 Ebd., S. 482f.
6 Besteman 1990, S. 111f.; TeBrake 2002, S. 485-487; Van Dam 2002, S. 505.
7 TeBrake 2002, S. 486-489.
8 Ebd., S. 488.
9 Besteman 1990, S. 110; Kaijser 2002, S. 529-531.
10 Kaijser 2002, S. 530.
- Quote paper
- Gergely Kapolnasi (Author), 2009, Besonderheiten der Siedlungsentwicklung: Land- und Energiegewinnung in den Niederen Landen im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137453