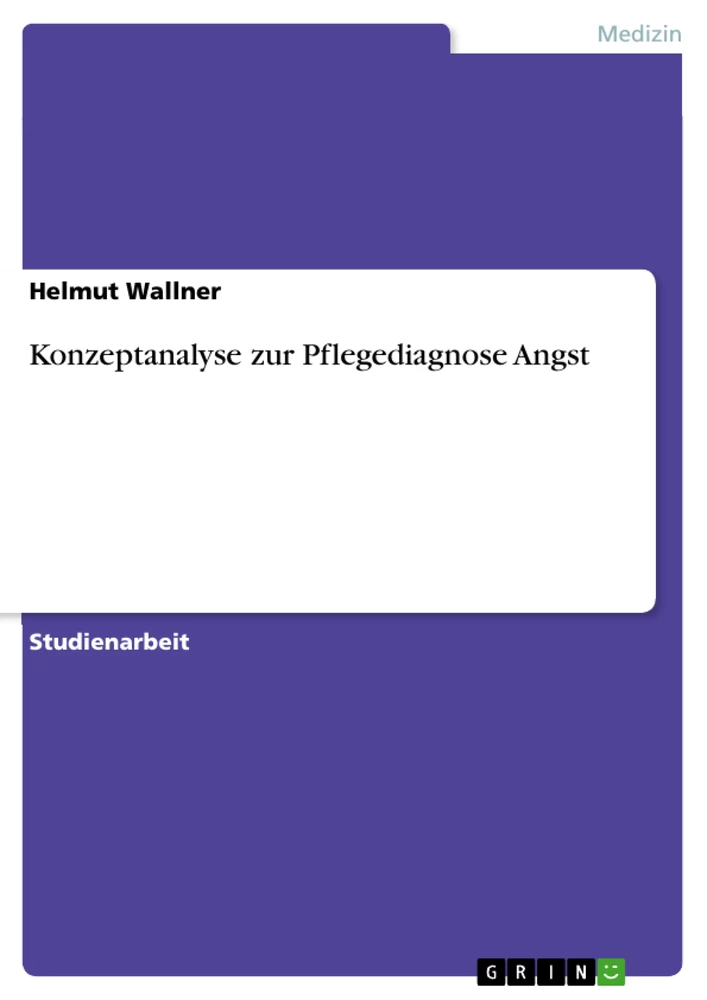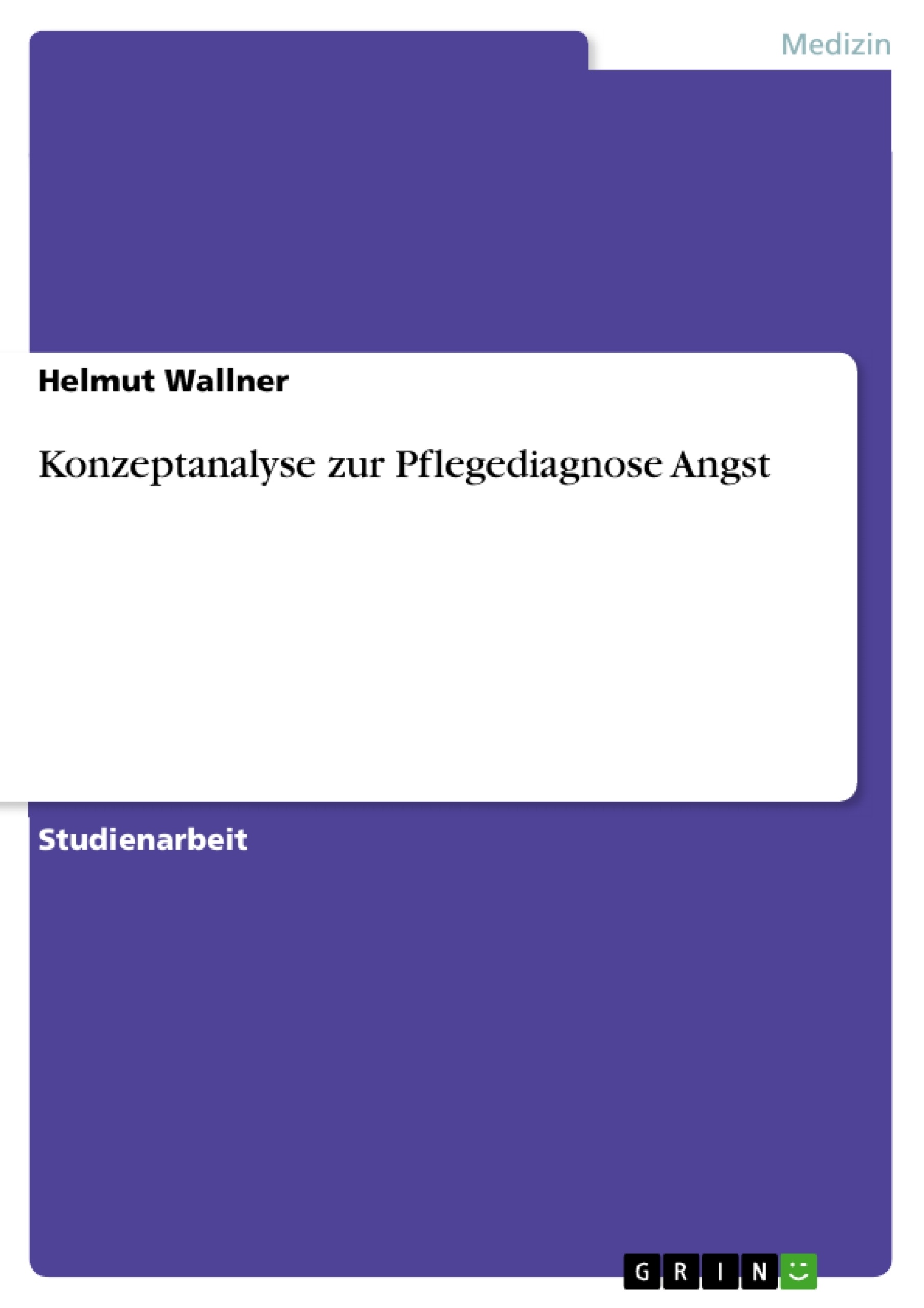Angst ist eine häufige Erscheinung in der Pflege und für mein Verständnis, eines der wichtigsten Pflegephänomene, mit welchem sich die Pflege auseinanderzusetzen hat. „Angst gehört zu unserem Leben wie Essen und Trinken, ist ein elementares Lebensgefühl wie Lust, Unlust, Freude, Trauer. Somit kann es ein Leben ohne Angst nicht geben.“ Entscheidend ist nur ob sie uns aktiviert oder lähmt. Nachdem die Angst in unserer Gesellschaft als negativ gesehen wird, als Zeichen von Schwäche, Ausgeliefertsein, Untüchtigkeit, einfach als Störung, tendieren wir dazu die Angst zu verbergen. Pflegepersonen müssen aber in der Lage sein Angst wahrzunehmen und den Betroffenen die Chancen bieten über ihre Gefühle zu sprechen. Wesentlich ist aber auch das Verständnis der Pflegeperson darüber, dass sie selbst Vorstellungen über die Bedeutung und Ursachen von Angst hat, welches ihr Handeln unweigerlich beeinflusst. Auch die in ihrem Arbeitsumfeld geltenden Umgangsweisen mit Angst, beeinflussen ihr tun. Deshalb ist es für eine professionelle Pflegeperson unumgänglich, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen und diese in Teamgesprächen oder Supervision anzusprechen, bzw. wahr und erst zu nehmen.
Arbeitsmodalität
Nachfolgend werde ich mich mit der Pflegediagnose 00146 (9.3.1.) nach der NANDA Taxonomie II, Angst (geringfügig, mäßige, ausgeprägte, panische)1 auseinandersetzen.
Angst ist eine häufige Erscheinung in der Pflege und für mein Verständnis, eines der wichtigsten Pflegephänomene, mit welchem sich die Pflege auseinanderzusetzen hat. „Angst gehört zu unserem Leben wie Essen und Trinken, ist ein elementares Lebensgefühl wie Lust, Unlust, Freude, Trauer. Somit kann es ein Leben ohne Angst nicht geben.“2 Entscheidend ist nur ob sie uns aktiviert oder lähmt. Nachdem die Angst in unserer Gesellschaft als negativ gesehen wird, als Zeichen von Schwäche, Ausgeliefertsein, Untüchtigkeit, einfach als Störung, tendieren wir dazu die Angst zu verbergen.3 Pflegepersonen müssen aber in der Lage sein Angst wahrzunehmen und den Betroffenen die Chancen bieten über ihre Gefühle zu sprechen. Wesentlich ist aber auch das Verständnis der Pflegeperson darüber, dass sie selbst Vorstellungen über die Bedeutung und Ursachen von Angst hat, welches ihr Handeln unweigerlich beeinflusst. Auch die in ihrem Arbeitsumfeld geltenden Umgangsweisen mit Angst, beeinflussen ihr tun. Deshalb ist es für eine professionelle Pflegeperson unumgänglich, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen und diese in Teamgesprächen oder Supervision anzusprechen, bzw. wahr und erst zu nehmen.
Begriffsanalyse
Im Rahmen der Begriffsanalyse habe ich den Weg vom allgemeinen Lexikon, über die Philosophie, zu den Pflegelehrbüchern und medizinischen Lexika, schließlich zur Psychologie eingeschlagen. Die Auseinandersetzung mit der differenzierten Betrachtung des Begriffs Angst war sehr spannend und hat mir den Zugang zur Pflegediagnose bzw. mein Verständnis im Zusammenhang mit den Maßnahmen ermöglicht.
Das allgemeine Lexikon, der Brockhaus, weist bei der Begriffsdefinition auf die körperlichen Begleiterscheinungen hin. „Angst (verwandt mit lat. angustus)
I) allgemein: Affekt oder Gefühlszustand, der im Unterschied zur Furcht einer unbestimmten Lebensbedrohung entspricht. Angst steht oft in Zusammenhang mit körperlichen Erscheinungen, besonders an den Atmungsorganen und am Herzen, auch an den Verdauungs- und Harnorganen. Als Krankheitszeichen ohne erkennbare körperliche Krankheit kommt Angst vor unter anderem bei Melancholie, Schizophrenie.“4
In der Philosophie kommt ein neuer Aspekt dazu. „Angst, daseinsanalytischer Grundbegriff, der in neuerer Zeit durch die Existenzphilosophie und die damit zusammenhängenden Strömungen seine fundamentale Bedeutung erhielt. Allgemein dient er zur Kennzeichnung eines geistigen, freien, aber endlichen Wesens (Mensch, Dasein), das aus der Sicherheit und Geschlossenheit des Naturzusammenhangs herausgerissen und ins Offene oder Leere oder Nichts (als den Grund aller Angst) gestellt ist. Kierkegaard (1844) legte mit der Unterscheidung von gegenstands- bzw. grundloser Existenzangst den Grund für die heutige Bedeutung des Begriffs. Besonders Heidegger (1929) hat die Angst zum Gegenstand eingehender Analysen gemacht. Sie ist eine „Grundbefindlichkeit“ (Stimmung), die das Dasein aus der Verfallenheit an das Seiende zurückholt und vor es selbst als seine eigene und eigenste Möglichkeit bringt. Mit dem Entgleiten des Seienden im Ganzen in der Angst drängt das Nichts heran, durch das hindurch erst das Sein als das ganz Andere gegenüber dem Seienden sichtbar wird. Hat die Angst hier ihre Stelle in einer Seinsphilosophie, so schreibt ihr Sartre eine wesentlich anthropologische Bedeutung zu. Der Mensch erfährt nach dieser Meinung in der Angst, dass er weder durch äußere noch durch innere Gründe determiniert ist (das „Nichts“ zwischen Motiv und Akt), sondern sich in unbedingter Freiheit selbst zu determinieren („bestimmen, begrenzen, festlegen“5) hat.“6
Diese grundlegende Bedeutung bzw. Erklärung machte mich neugierig auf die Ausführungen in den Pflegefachbüchern. In einschlägiger Pflegeliteratur, z.B. dem Pflege Heute, Lehrbuch für GuKpfl. findet man bezogen auf verschiedene Pflegephänomene, Definitionen auch zum Thema Angst. „Angst ist eine der elementarsten Triebkräfte des Menschen. Sie kann als ein unangenehmes bis unerträgliches Gefühl der physischen oder psychischen Bedrohung oder Gefahr beschrieben werden. ... In bedrohlichen Situationen wirkt sie als Warnsignal, das die Aufmerksamkeit schärft und Energien freisetzt.“7
Diesen Ansatz wollte ich in mit einem Pflegelexikon festigen. Bei Georg und Frowein (1999) konnte ich drei Erklärungsmodelle (Psychoanalyse, Behaviorismus, kognitive Angsttheorien) für das Entstehen von Angst finden. „Die Psychoanalyse versteht Angst als einen Hinweis auf die Unvereinbarkeit von Triebansprüchen des - Es mit den Kontrolltendenzen des - Über-Ich. Dabei wird Angst von Furcht (Realangst) abgegrenzt; letztere umfasst nachvollziehbar-gerechtfertigte Bedrohungsgefühle, erstere wird durch innerpsychische Vorgänge verursacht. Der Behaviorismus geht davon aus, dass Angst als zunächst unspezifische emotionale Reaktion über Lernprozesse (Konditionierung, klassische) an bestimmte Situationen gebunden wird. Zum Weiterbestehen der Angst (Angstkonservierung) kommt es, wenn sich ein Meidungs- o. Fluchtverhalten herausbildet, das zu schnell beendet ist. Dessen Entlastungserfolg kann nicht registriert werden, weil es zu rasch abläuft, um beispielsweise mit dem langsamen Abklingen der Erregung noch in engem raumzeitlichem Zusammenhang zu stehen (Konditionierung, instrumentelle). Insofern wirkt Meidungs- o. Fluchtverhalten als Verstärkung für das Auftreten von Angst. Kognitive Angsttheorien verstehen Angst als eine Folge von Situationsbewertungen. Diese beziehen sich auf den Grad der Bedrohung u. die Verfügbarkeit von Bewältigungsmöglichkeiten. In Abhängigkeit von der Diskrepanz zwischen den Bewertungen entstehen mehr o. minder starke Angstgefühle (Stress).“8
In einem medizinischen Lexikon, Pschyrembel 2001, steht geschrieben: „Angst: unangenehm empfundener, eine Bedrohung oder Gefahr signalisierender emotionaler Gefühlszustand; erhält u. U. Krankheitswert, wenn sie ohne erkennbaren Grund bzw. inf. inadäquater Reize ausgelöst u. empfunden wird. Angst kann in unterschiedlichen Schweregraden auftreten u. ist i. d. R. begleitet von psych. u. phys. Symptomen. ... . Formen: 1. realistische Angst (Furcht) als Reaktion des Ich auf eine objektive Gefahr; nach Extremsituationen ggf. Traumatisierung u. bei wiederholter Konfrontation mit der Gefahr Auftreten der Angst als sog. Signalangst, die Abwehrmechanismus u. Coping auslöst; 2. frei flottierende Angst: nicht auf ein best. Objekt od. eine best. Situation gerichtet; 3. neurotische Angst: stammt aus einem unbewussten Konflikt u. tritt i. R. neurot. Störungen (z. B. bei Phobie bzw. Angstneurose) auf. Angst kommt bei fast allen Psychosen vor.“9 In der Unterscheidung zur „Angst|störung, die generalisierte Angst: exzessive Furcht od. Sorgen von mind. 6 Mon. Dauer in versch. Lebensbereichen; Symptome: erhöhtes Erregungsniveau, Nervosität, Anspannung, Hypervigilanz, vegetative Beschwerden; DD: Depression, Sozialphobie, Panik- u. Zwangsstörung;“10
Nachdem sich beide Lexika immer auch auf die Psychologie berufen recherchierte ich hier über die zu Grunde liegende Theorie. In der Psychologie wird Angst bezeichnet als „ein mit Beengung, Erregung, Verzweiflung verknüpftes Lebensgefühl, dessen besonderes Kennzeichen die Aufhebung der willensmäßigen und verstandesmäßigen Steuerung der Persönlichkeit ist.“11
Fritz Riemann, ein Tiefenpsychologe und Begründer der Riemann´schen Typologie, geht davon aus, dass alle Menschen Ängste haben, es aber auch viele Ängste gibt die allen Menschen gemein sind. Es gibt praktisch nichts, wovor man nicht Angst entwickeln kann. Ängste sind nichts schlechtes, sie lassen den Menschen auch über sich selbst hinauswachsen. Riemann teilt die Ängste unseres Lebens auf vier Grundängste ein.
- Der zwanghafte Typ hat Angst vor Veränderung, fordern die Beständigkeit (Grundangst vor Veränderung).
- Der hysterische Typ wiederum hat Angst vor Beständigkeit und fordert die Veränderung (Grundangst vor der Endgültigkeit).
- Der schizoide Typ hat Angst vor der Selbsthingabe, fordert die Selbstwerdung (Grundangst vor Nähe).
- Der depressive Typ hat Angst vor der Selbstwerdung (= Grundangst) und fordert die Selbsthingabe.
Diese Einteilung ist als idealtypische Abstraktion aufzufassen, die in der Wirklichkeit (isoliert) nicht so vorkommt. Das Ziel ist eine Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Aspekten: Wer genauso schizoid wie depressiv ist und genauso zwanghaft, wie hysterisch wird von Riemann als ein seelisch gesunder Mensch bezeichnet. Angst ist immer ein Signal und eine Warnung bei Gefahren, enthält gleichzeitig einen Aufforderungscharakter, nämlich den Impuls, die Angst zu überwinden. Vertrauen, Hoffnung, Glauben, Liebe, Mut, Demut und Erkenntnis sind Gegenkräfte zur Angst, die immer wieder helfen können, diese zu überwinden.12
[...]
1 Stefan, Allmer, Eberl et al. 2003, S.706
2 Erni 1989, S.36
3 Erni 1989, S.10
4 Brockhaus Lexikon 1997
5 Duden 2006, S.3ß
6 Müller, Halder 1969, S.15
7 Warmbrunn 2004, S.340
8 vgl. Georg, Frowein 1999, CD-ROM
9 Pschyrembel 2001, elektronischer Datenträger
10 Pschyrembel 2001, elektronischer Datenträger
11 Dorsch 1994, S.35
12 vgl. Riemann 1995,S.5-12
- Citar trabajo
- MSc Helmut Wallner (Autor), 2007, Konzeptanalyse zur Pflegediagnose Angst, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137420