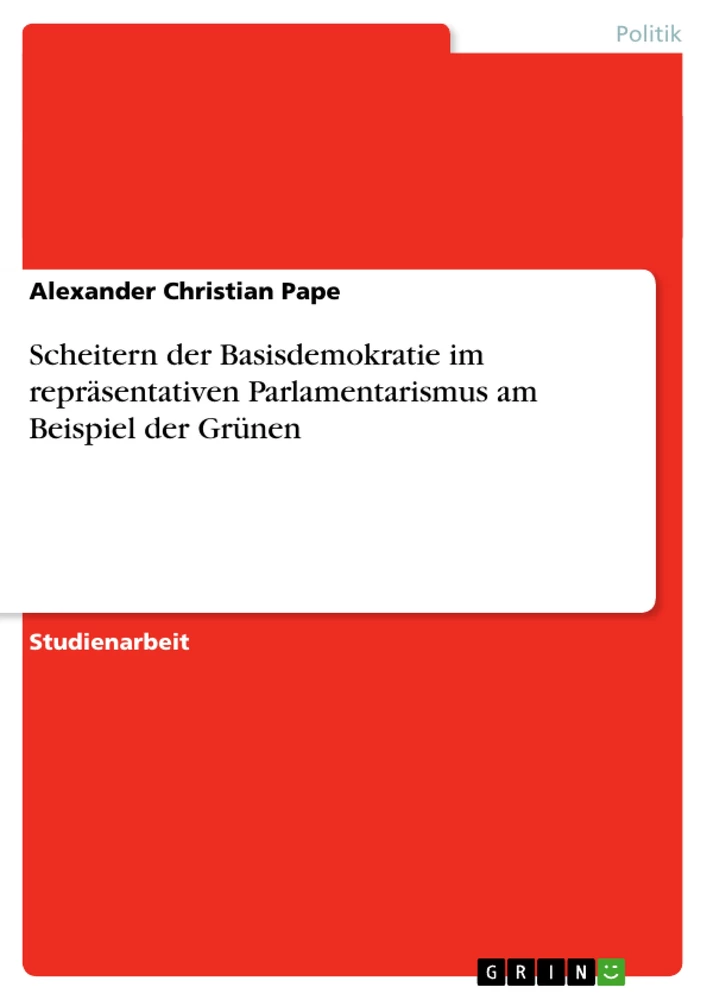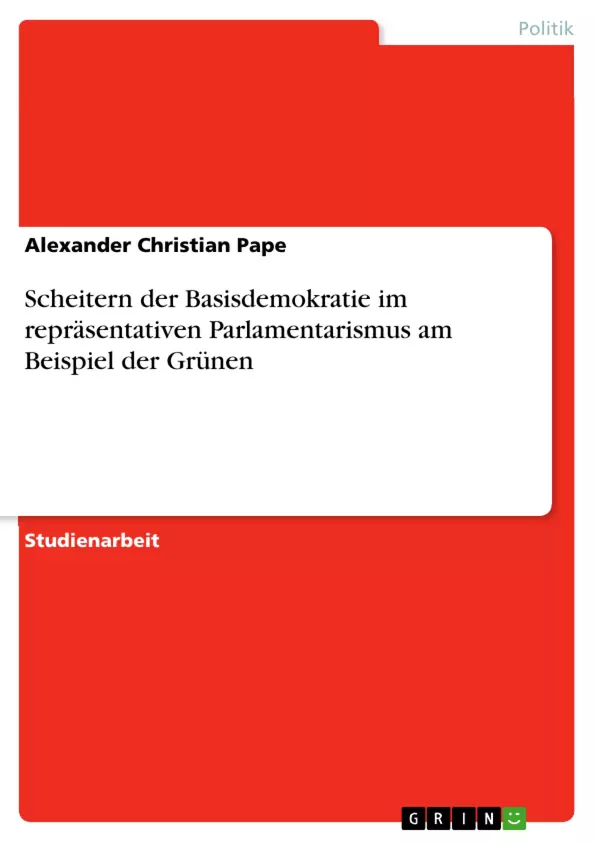1. Einführung
Im Blickfeld einer baldigen Bundestagswahl und unter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse, die Verlust der großen Volksparteien an Wählerschaft vorhersehen, ist die Bedeutung kleiner Parteien nicht zu unterschätzen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands befindet sich seit geraumer Zeit in einem Abwärtstrend der Wählergunst, zudem treten immer mehr Mitglieder aus der Partei aus. Nicht nur die relativ neue Linkspartei könnte von diesem Stimm- und Sympathieverlust profitieren, sondern auch eine Partei, die sich in einem Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten in der deutschen Parteienlandschaft festgesetzt hat, sowohl eine langjährige Erfahrung in der Oppositionsrolle, als auch der Regierungsverantwortung vorweisen kann. Seit dem Einzug in den Deutschen Bundestag 1983 und den ersten Erfahrungen auf Länderregierungsebene ab 1985 sind Bündnis 90/ Die Grünen aus den bundesdeutschen Parlamenten nicht mehr wegzudenken. Hierbei ist es interessant zu untersuchen, was sich für die Grünen als Regierungspartei verändert hat. Offensichtlich haben verschiedene innerparteiliche Entwicklungsprozesse auf struktureller, ideologischer und praktischer Ebene stattgefunden. Konsens besteht weitgehend darin, dass diese notwendig waren, um die Handlungsfähigkeit im parlamentarischen Betrieb, insbesondere in der Regierungsverantwortung, aufrechterhalten oder gar verbessern zu können. Übereinstimmend werden auch basisdemokratische Parteielemente als langfristig hinderlich bei dringlichen, erforderlichen Entscheidungsfindungen betrachtet. Daraus leitet sich eine zentrale These ab: Das Modell der Basisdemokratie der Grünen ist im repräsentativen Parlamentarismus gescheitert.
Im Folgenden meiner Seminararbeit werde ich einige Aspekte, Grundlagen und Problematiken beleuchten, um diese These analysieren zu können. Anfänglich widme ich mich hierzu...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Einflüsse und Prägungen bei der Parteigründung
- 2.1. Historische Konzepte der Basisdemokratie
- 2.1.1. Formen der "grass roots"
- 2.1.2. Direkte Demokratie im Sinne Rousseaus
- 2.1.3. Volksherrschaft der Räte
- 2.2. Ursprüngliches Selbstverständnis als Bewegungspartei/Antipartei-Partei
- 2.1. Historische Konzepte der Basisdemokratie
- 3. Die Umsetzung basisdemokratischer Ideen anhand von parteiinternen Regularien
- 3.1. Rotationsprinzip
- 3.2. Imperatives Mandat
- 3.3. Trennung von Amt und Mandat
- 4. Das Scheitern nach 1998
- 4.1. Handlungsfähigkeit als Regierungspartei
- 4.2. Strukturelle Defizite
- 4.3. Ideologische Differenzen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Scheitern des basisdemokratischen Modells der Grünen im repräsentativen Parlamentarismus. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Grünen von einer Bewegungspartei zu einer Regierungspartei und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Anpassungsprozesse.
- Entwicklung des basisdemokratischen Selbstverständnisses der Grünen
- Umsetzung basisdemokratischer Prinzipien in der Parteistruktur
- Herausforderungen der Handlungsfähigkeit als Regierungspartei
- Strukturelle und ideologische Defizite des basisdemokratischen Modells
- Anpassungsprozesse der Grünen an den repräsentativen Parlamentarismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit untersucht die These, dass das basisdemokratische Modell der Grünen im repräsentativen Parlamentarismus gescheitert ist. Sie betrachtet die Grünen als Fallbeispiel im Kontext des Wandels in der deutschen Parteienlandschaft und des Rückgangs großer Volksparteien. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Entwicklung der basisdemokratischen Strukturen, deren Umsetzung in der Parteistruktur und die Herausforderungen in der Regierungsverantwortung analysieren wird.
2. Einflüsse und Prägungen bei der Parteigründung: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Konzepte der Basisdemokratie, die die Gründung der Grünen beeinflusst haben. Es analysiert verschiedene Ansätze wie "grass roots"-Bewegungen, Rousseaus direkte Demokratie und die Vorstellung der Volksherrschaft der Räte. Das Kapitel zeigt auf, wie diese Konzepte das ursprüngliche Selbstverständnis der Grünen als Bewegungspartei und Antipartei-Partei prägten und die Ablehnung etablierter Machtstrukturen zum Ausdruck brachten. Der Fokus liegt auf dem Wunsch nach dezentraler Organisation, Konsensfindung und Vermeidung von Hierarchien.
3. Die Umsetzung basisdemokratischer Ideen anhand von parteiinternen Regularien: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Umsetzungsversuche basisdemokratischer Ideen in der Parteistruktur der Grünen. Es analysiert Mechanismen wie das Rotationsprinzip, das imperative Mandat und die Trennung von Amt und Mandat. Die Darstellung der jeweiligen Ausgestaltungsformen und ihrer Auswirkungen bildet die Grundlage für die spätere Analyse der Probleme und des Scheiterns des Modells. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie weit die theoretischen Konzepte in die Praxis umgesetzt werden konnten und welche Effekte dies hatte.
4. Das Scheitern nach 1998: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen, denen die Grünen als Regierungspartei nach 1998 begegneten. Es untersucht die Probleme bezüglich der Handlungsfähigkeit, strukturelle Defizite und ideologische Differenzen innerhalb der Partei. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die basisdemokratischen Strukturen die Entscheidungsfindung und den Regierungshandeln beeinflussten und zu welchen Veränderungen in der Parteiorganisation dies führte. Die Analyse beleuchtet die Spannungen zwischen den Prinzipien der Basisdemokratie und den Erfordernissen des parlamentarischen und Regierungshandelns.
Schlüsselwörter
Basisdemokratie, Grüne, Repräsentativer Parlamentarismus, Bewegungspartei, Regierungspartei, Parteistruktur, Handlungsfähigkeit, Ideologische Differenzen, Rotationsprinzip, Imperatives Mandat, Parteientwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Das Scheitern des basisdemokratischen Modells der Grünen
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Scheitern des basisdemokratischen Modells der Grünen im deutschen repräsentativen Parlamentarismus. Sie analysiert die Entwicklung der Grünen von einer Bewegungspartei zu einer Regierungspartei und die damit verbundenen Herausforderungen und Anpassungsprozesse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des basisdemokratischen Selbstverständnisses der Grünen, die Umsetzung basisdemokratischer Prinzipien in der Parteistruktur, die Herausforderungen der Handlungsfähigkeit als Regierungspartei, strukturelle und ideologische Defizite des basisdemokratischen Modells sowie die Anpassungsprozesse der Grünen an den repräsentativen Parlamentarismus.
Welche Einflüsse prägten die Parteigründung der Grünen?
Die Parteigründung der Grünen wurde von historischen Konzepten der Basisdemokratie beeinflusst, darunter "grass roots"-Bewegungen, Rousseaus direkte Demokratie und die Vorstellung der Volksherrschaft der Räte. Diese Konzepte prägten das ursprüngliche Selbstverständnis der Grünen als Bewegungspartei und Antipartei-Partei, mit dem Fokus auf dezentrale Organisation, Konsensfindung und Vermeidung von Hierarchien.
Wie wurden basisdemokratische Ideen in der Parteistruktur umgesetzt?
Die Grünen versuchten, basisdemokratische Ideen durch Mechanismen wie das Rotationsprinzip, das imperative Mandat und die Trennung von Amt und Mandat umzusetzen. Die Arbeit analysiert die Ausgestaltungsformen und deren Auswirkungen, sowie die Frage, wie weit die theoretischen Konzepte in die Praxis umgesetzt werden konnten.
Warum wird das Modell als gescheitert angesehen?
Das Scheitern des Modells wird nach 1998 analysiert, indem die Herausforderungen der Grünen als Regierungspartei untersucht werden. Die Arbeit beleuchtet Probleme hinsichtlich der Handlungsfähigkeit, strukturelle Defizite und ideologische Differenzen innerhalb der Partei, sowie die Spannungen zwischen den Prinzipien der Basisdemokratie und den Erfordernissen des parlamentarischen und Regierungshandelns.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung, 2. Einflüsse und Prägungen bei der Parteigründung, 3. Die Umsetzung basisdemokratischer Ideen anhand von parteiinternen Regularien, 4. Das Scheitern nach 1998 und 5. Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit detailliert zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Basisdemokratie, Grüne, Repräsentativer Parlamentarismus, Bewegungspartei, Regierungspartei, Parteistruktur, Handlungsfähigkeit, Ideologische Differenzen, Rotationsprinzip, Imperatives Mandat und Parteientwicklung.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der basisdemokratischen Strukturen der Grünen, deren Umsetzung in der Parteistruktur und die Herausforderungen in der Regierungsverantwortung. Der methodische Ansatz wird in der Einleitung skizziert.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt die These, dass das basisdemokratische Modell der Grünen im repräsentativen Parlamentarismus gescheitert ist. Die Grünen dienen als Fallbeispiel für den Wandel in der deutschen Parteienlandschaft und den Rückgang großer Volksparteien.
- Quote paper
- Alexander Christian Pape (Author), 2009, Scheitern der Basisdemokratie im repräsentativen Parlamentarismus am Beispiel der Grünen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137416