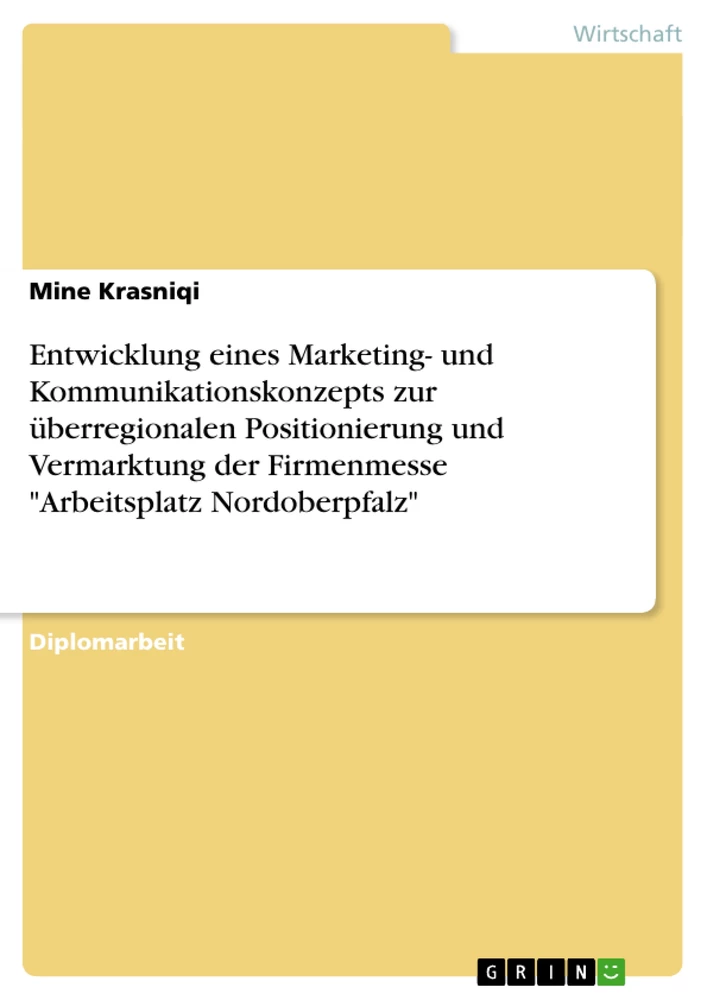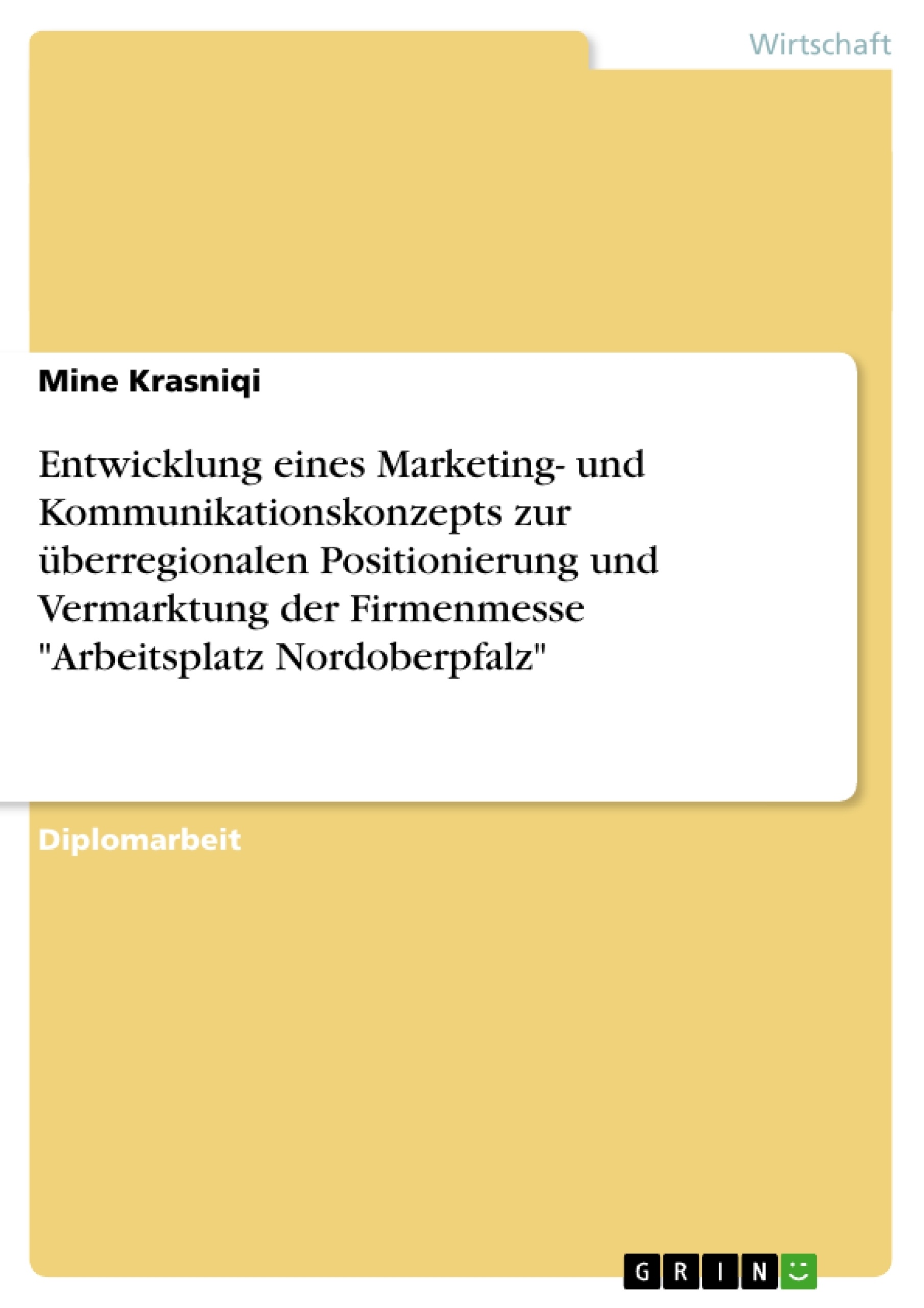Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Marketing-Konzept für die Vermarktung der überregionalen Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ erarbeitet. Die Schwierigkeit hierbei lag darin, dass nicht die Sichtweise der Messeaussteller, die in der meisten Literatur beschrieben wird, sondern die des Messeveranstalters zu berücksichtigen war. Somit bestand die Besonderheit, dass sämtliche strategischen Vorhaben auf zwei unterschiedliche Kundengruppen ausgerichtet werden mussten: die Aussteller und die Besucher. Das Messe-Konzept selbst beruht auf der Grundlage der (internen und externen) Analyse. Darauf aufbauend ist eine Strategie entwickelt worden, die Zielmärkte und –segmente beinhalten. Den Kern der Arbeit bilden die Komponenten des Marketing-Mixes, die der Firmenmesse entsprechend angepasst wurden. Das bedeutet, hier wurden die Leistungs-, Preis- und Kommunikationspolitik sowie Logistik und „Prozessmanagement“ behandelt. Für die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs des Messeprozesses und die Sicherstellung des Messeerfolgs wurden im Anschluss Controlling-Instrumente wie Projektcontrolling, Balance Scorecard und Benchmarking vorgeschlagen, die das prüfen. Im letzten Kapitel wurden die nächsten Schritte beschrieben und Umsetzungsempfehlungen ausgesprochen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ausgangssituation
1.2 Zielsetzung
1.3 Aufbau dieser Arbeit und methodisches Vorgehen
2 Theoretische Grundlagen3
2.1 Definition des Marketingbegriffs
2.2 Marketing-Konzeption
2.2.1 Wesen und Aufgabe einer Marketing-Konzeption
2.2.2 Phasen der Marketingkonzeption
2.2.3 Die Stellung der Messe im Marketing-Mix
2.3 Messemarketing
2.3.1 Bedeutung des Messemarketings
2.3.2 Konzeption des Messemarketings
3 Analyse
3.1 Interne Analyse
3.1.1 Analyse des Leistungsangebots (Eigenbild)
3.1.1.1 Leistungspolitik
3.1.1.2 Kommunikationspolitik
3.1.1.3 Logistik
3.1.1.4 Preispolitik
3.1.2 Analyse der Leistungswahrnehmung (Fremdbild)
3.2 Externe Analyse
3.2.1 Marktsituation
3.2.1.1 Marktstruktur
3.2.1.2 Marktvolumen
3.2.1.3 Branchenentwicklung
3.2.1.4 Marktabschnitt
3.2.2 Markteilnehmer
3.2.2.1 Kundensituation
3.2.2.2 Medien
3.2.2.3 Wettbewerbssituation
3.2.2.4 Marktabgrenzung
3.3 SWOT-Analyse
3.3.1 Stärken
3.3.2 Schwächen
3.3.3 Chancen
3.3.4 Risiken
3.3.5 SWOT-Matrix
4 Marketingstrategie
4.1 Ziele
4.1.1 Ziele der Messe
4.1.1.1 Quantitative
4.1.1.2 Qualitative
4.1.2 Ziele des Messemarketings
4.1.2.1 Quantitative
4.1.2.2 Qualitative
4.2 Zielmarkt
4.3 Marktbearbeitung
4.3.1 Aussteller
4.3.1.1 Marktfeldstrategie
4.3.1.2 Marktstimulierungsstrategie
4.3.2 Besucher
4.3.2.1 Marktfeldstrategie
4.3.2.2 Marktparzellierungsstrategie
4.3.2.3 Marktarealstrategie
4.4 Zielsegmentierung
4.4.1 Aussteller
4.4.1.1 Segmentierung der potenziellen Aussteller
4.4.1.2 Motivanalyse
4.4.2 Besucher
4.4.2.1 Segmentierung der potenziellen Messebesucher
4.4.2.2 Motivanalyse
4.4.2.3 Priorisierung der potenziellen Messebesucher
4.4.2.4 SWOT-Analyse der Besucher-Zielgruppen
4.4.2.5 Messe-Nutzungsverhalten
4.4.2.6 Mediennutzungsverhalten der Besucher
4.5 Positionierung
4.5.1 Ausstellergerichtete Positionierung
4.5.2 Besuchergerichtete Positionierung
4.6 Differenzierung
5 Marketing-Mix
5.1 Leistungspolitik
5.1.1 Produktdefinition „Messe“
5.1.2 Messegestaltung
5.1.2.1 Veranstaltungsort
5.1.2.2 Veranstaltungszeitpunkt
5.1.2.3 Dekoration
5.1.2.4 Catering
5.1.2.5 Raumkonzept
5.1.2.6 Rahmenprogramm
5.1.2.7 Service
5.2 Kommunikationspolitik
5.2.1 Kommunikationsprozess
5.2.2 Kommunikationsbotschaft
5.2.3 Wechselbeziehung zwischen Aussteller- und Besucherakquisition
5.2.4 Kundenakquisition
5.2.4.1 Corporate Identity
5.2.4.2 Besucherakquisition
5.2.4.3 Ausstellerakquisition
5.2.4.4 Maßnahmenplan
5.3 Preispolitik
5.3.1 Preisdefinition im Messewesen
5.3.2 Ausstellerorientierte Preisgestaltung
5.3.2.1 Preisbestimmung
5.3.2.2 Preisstrategie
5.3.2.3 Sonderkonditionen
5.3.3 Besucherorientierte Preisgestaltung
5.3.3.1 Preisbestimmung
5.3.3.2 Preisstrategie
5.3.3.3 Sonderkonditionen
5.3.4 Preisgestaltung der Verpflegung
5.3.5 Konditionenpolitik
5.4 Logistik
5.4.1 Definition der Logistik im Messewesen
5.4.1.1 Materialflüsse
5.4.1.2 Informationsflüsse
5.4.1.3 Personenflüsse
5.5 Prozessmanagement
5.5.1 Vorbereitungsphase
5.5.2 Durchführungsphase
5.5.3 Nachbereitungsphase
6 Marketingcontrolling
6.1 Bedeutung & Möglichkeiten des Messecontrollings
6.1.1 Im Allgemeinen
6.1.2 Im Rahmen der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“
6.2 Projektcontrolling im Messemanagement
6.2.1 Termin
6.2.2 Kosten
6.2.3 Qualität (Ergebnis)
6.3 Erfolgskontrolle mittels Balance Scorecard
6.4 Benchmarking als Vorbereitung für die Messeveranstaltung 2012
6.4.1 Messeinternes Benchmarking
6.4.2 Messeexternes Benchmarking
7 Umsetzungskonzept für die Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz 2010"
7.1 Standortmarketing als Voraussetzung für die regionale Firmenmesse
7.2 Ziele
7.3 Maßnahmen
7.4 Empfehlungen und Konsequenzen für die Umsetzung
7.4.1 Umsetzungsplan
7.4.2 Budgetierung
7.4.3 Werbeagentur
7.4.4 Organisation
8 Zusammenfassung und Ausblick
Anhangsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Konzeptionspyramide
Abb. 2: Stellung der Messe im Marketing-Mix
Abb. 3: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Themen auf Jobmessen nach Relevanz
Abb. 4: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Zielgruppe
Abb. 5: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Besucheranzahl
Abb. 6: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Messeorganisation
Abb. 7: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Messe-Werbung
Abb. 8: Bundesweiter Bedarf an Facharbeitskräften
Abb. 9: Marktteilnehmer
Abb. 10: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Anzahl der Mitarbeiter
Abb. 11: Zielmärkte der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“
Abb. 12: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Messenutzungsverhalten der Aussteller
Abb. 13: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Bedarf an Mitarbeitern
Abb. 14: Bedarf an Facharbeitskräften nach Branche
Abb. 15: Durchschnittliche Kaufkraft nach Altersklassen in Deutschland 2008
Abb. 16: Mediennutzung nach Geschlecht und Altersgruppe
Abb. 17: News-Countdown
Abb. 18: Skyscraper
Abb. 19: OTV – Marktanteile ab 18:00 Uhr in Kabelhaushalten
Abb. 20: Typische Blickverläufe von Lesern
Abb. 21: Plakatbeispiel (Messe „Food & Life“)
Abb. 22: Phasen des Produktlebenszyklus
Abb. 23: Konzentrische Gebietsausdehnung
Abb. 24: Selektive Gebietsausdehnung
Abb. 25: Inselförmige Gebietsausdehnung
Abb. 26: Basis-, Leistungs- und Begeisterungsfaktoren
Abb. 27: Beispiele für psychologische Positionierungen (BMW, Renault, Audi)
Abb. 28: Beispiel für stark ausgeprägte Kommunikationsgestaltung (Saturn)
Abb. 29: Beispiel für psychologische Wettbewerbsdifferenzierung (Nivea)
Abb. 30: Beispiel für Nutzenvorteile als Trittbrettfahrer (T-Com)
Abb. 31: Beispiel für kommunikative Lücken-Besetzung (Gigaset)
Abb. 32: Beispiel für Kommunikation besserer Performance (Zewa - Bounty)
Abb. 33: Beispiel für eine Relativierung (Dove)
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: SWOT-Matrix der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“
Tab. 2: Jobanforderungen von Facharbeitskräften
Tab. 3: Selektierte Zielsegmente
Tab. 4: SWOT-Analyse der Zielgruppe „Facharbeitskräfte“
Tab. 5: SWOT-Analyse der breiten Zielgruppe
Tab. 6: Maßnahmenplan
Tab. 7: Kennzahlen zur Erfolgskontrolle
Tab. 8: Wettbewerbsbezogenes Benchmarking
Tab. 9: Strategien innerhalb einer SWOT-Matrix
Tab. 10: Strategische Kombinationen der Marktfeldstrategie
Tab. 11: Formen der MarktparzellierungsstrategieTabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Ausgangssituation
Die Nordoberpfalz, eine kleine Region im Norden Bayerns, umfasst die Stadt Weiden in der Oberpfalz, den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und den Landkreis Tirschenreuth. Be-kannt ist die Gegend für ihre historische Glas-, Porzellan- und Bekleidungsindustrie.1
Seit der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 – insbesondere um Tschechien - hat sich die als oftmals hoffnungslose Lage der nördlichen Oberpfalz fundamental verän-dert.2 Die einst arme Nordoberpfalz, die ihre Wohlstandsbringer der Vergangenheit – Glas, Porzellan und Bekleidung - an Billiglohnländern verloren hatte, mauserte sich in den vergan-genen Jahrzehnten zu einer der wohlhabendsten Regionen Europas. Doch seit der Osterweite-rung schwankt die nördliche Oberpfalz zwischen Hoffnung, Zweckoptimismus und Angst. Viele Bürger sorgen sich um die eigene Zukunft, aber auch um die Zukunft der Region selbst.
Es ist nun die Verantwortung der regionalen Führungskräfte, Perspektiven aufzuzeigen und die Kräfte der Region zu mobilisieren. Dazu gehört unter anderem, die Bürger an die Region zu binden:3 Insbesondere junge und gut ausgebildete Fachkräfte, die das Potenzial und Know-how haben, Unternehmen zu gründen, innovative und konkurrenzfähige Produkte zu entwi-ckeln sowie neue Märkte zu erschließen. Ein fortschrittlicher Wandel der Region ist daher Voraussetzung, da immer mehr qualifizierte Arbeitnehmer ihre Heimat verlassen, um sich in größeren und wirtschaftlich sowie kulturell attraktiveren Orten niederzulassen.4
Die Umstrukturierung von Tradition zur Modernität wurde bereits in wesentlichen Bereichen geschafft. Die Nordoberpfalz zeigt in den Fachgebieten (Versand-)Handel, Maschinenbau und Automobilzulieferung ein großes Know-how.5 Diese Stärken werden aber leider nicht ausrei-chend nach außen kommuniziert. Eine weitere wesentliche Herausforderung der regionalen Führungskräfte ist es, die Besonderheiten der nordbayrischen Region nach außen hin zu prä-sentieren und sich erfolgreich zu positionieren. In diesem Zusammenhang haben sich die Ver-antwortlichen der Nordoberpfalz Gedanken gemacht, wie sie die regionalen Qualitäten öffent-lich präsentieren und gleichzeitig Facharbeitskräfte in die Region ziehen können. Diesbezüg-lich entstand die Idee, eine Arbeitsplatz-Messe zu veranstalten. Dabei sollen sich die regiona-len Unternehmen, sich selbst, ihre qualitativ hochwertigen Produkte oder Dienstleistungen und offene Stellen auf der Messe dar- und anbieten.
Nach einer aufwändigen Organisation fand die erste Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ im Juni 2008 in Weiden i. d. Opf. statt. Das Ergebnis war trotz kurzer Vorbereitungszeit von vier Monaten zufriedenstellend. Ein Großteil der Messebesucher (vierzig Prozent) bestand aller-dings aus Schulabgängern, die sich über Ausbildungsstellen informierten. Damit wurde das Ziel der Schau, Facharbeitskräfte zu akquirieren, nicht wie geplant erreicht.
Für den nächsten Messeauftritt im Frühjahr 2010 beschlossen alle Veranstalter einheitlich, dass sich die Messe hauptsächlich auf die Zielgruppe „Facharbeitskräfte“ beziehen soll, da sie in der Region am dringendsten gebraucht werden. Mit diesem Beschluss sollte der wirtschaft-lich-politische Hintergrund – Gewährleistung des Wohlstandes der Region Nordoberpfalz – stärker miteinbezogen werden. Um für den nächsten Messeauftritt eine strategisch optimale Vermarktung und Positionierung zu gewährleisten, haben sich die Veranstalter mit der Bitte um fachliche Unterstützung an die Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden in Weiden i. d. Opf. gewandt. Mit der fachlichen Betreuung soll nun ein Marketing-und Kommunikations-Konzept zur überregionalen Bewerbung der Messe „Arbeitsplatz Nord-oberpfalz“ erstellt werden.
1.2 Zielsetzung
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich, wie bereits oben kurz angedeutet, mit der Er-stellung eines Marketing- und Kommunikationskonzepts zur erfolgreichen Positionierung und Vermarktung der überregionalen Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“. Die Ausführungen sollen den Veranstaltern einen Orientierungsrahmen zur Messevermarktung bieten, um die komplexe Ausgestaltung und Implementierung des Messemarketings zu vereinfachen. Das Ziel der Arbeit ist somit die Ausarbeitung der Problemfelder und die Gestaltung strategisch relevanter Schritte und Faktoren für eine erfolgreiche Marketingkonzeption. Damit soll die Messe ein neues Profil bekommen, um die Messe-Bekanntheit aufzubessern und möglichst viele der angestrebten Kunden zu akquirieren. Genauer gesagt soll die Diplomarbeit mithilfe einer Situationsanalyse die Problemabschnitte der ersten Veranstaltung aufzeigen und Lö-sungsvorschläge in Form eines gesamten Marketingkonzepts liefern. Darauf aufbauend wer-den Empfehlungen für die Umsetzung der Arbeitsplatz-Messe unterbreitet.
1.3 Aufbau dieser Arbeit und methodisches Vorgehen
Einführend werden zunächst die begrifflichen Grundlagen von Marketing, Marketing-Konzeption und Messemarketing behandelt. Daraufhin beschäftigt sich das dritte Kapitel mit der Analysephase, aus der die Problemfelder der ersten Messeveranstaltung abgeleitet wer-den. In diesem Teil der Arbeit wird die Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ nach bestimmten messeinternen und -externen Bewertungsfaktoren untersucht. Aus dieser Situationsanalyse resultiert am Ende die SWOT-Analyse, die den gesamten Analysekreis umschließt.
Für das Verständnis des weiteren Verlaufs werden die Ziele der Messe, der Zielmarkt, die Marktbearbeitung, die Zielgruppe und folglich die Positionierung beleuchtet. Nachfolgend werden im fünften Kapitel der Aufbau und die Umsetzung des Marketing-Mixes beschrieben. Hier werden die einzelnen Marketing-Mix-Komponenten in Zusammenhang zur näher darge-stellt. Darauf aufbauend wird im nächsten Kapitel das Thema „Marketingcontrolling“ erläu-tert und zur Messe passende Controlling-Instrumente vorgestellt.
Im siebten Kapitel wird vorerst erläutert, warum Standortmarketing Voraussetzung für die überregionale Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ ist. Dann folgt eine Auflistung der Ziele sowie der nächsten Schritte. Hierbei werden Maßnahmen und Vorschläge für die kreative Konzeptumsetzung unterbreitet. Zu guter Letzt wird im Fazit eine Zusammenfassung und Trendbeurteilung der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ vorgenommen und argumentiert.
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Definition des Marketingbegriffs
Zum Marketing-Begriff gibt es in der Literatur unterschiedliche Auffassungen. Der Autor Jochen Becker beschreibt in seinem Buch „Marketing-Konzeption“ das Wesen des Marke-tings mit folgenden Worten: „Marketing als Führungsphilosophie kann umschrieben werden als die bewusste Führung des gesamten Unternehmens vom Absatzmarkt her.“6 Kurz gesagt, es ist ein Bündel an marktgerichteten Aktivitäten oder wird auch eine „marktorientierte Un-ternehmensführung“ genannt.7 Eine etwas ausführlichere Sichtweise kommt vom Schriftstel-ler Heribert Meffert. Er geht davon aus, dass marktorientierte Unternehmensführung sich so-wohl aus unternehmensinternen Prozessen wie Planung, Koordination und Kontrolle als auch aus unternehmensexternen Prozessen wie die Gestaltung aller – auch nicht-ökonomischen - Austauschbeziehungen zusammensetzt.8 Diesem modernen Verständnis entspricht auch die Definition der American Marketing Association (AMA): „Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of items, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives.“9
Das Aufgabenfeld des Marketings lässt sich grob in markt-, unternehmens- und gesellschafts-bezogene Aufgaben unterteilen.10 Marktbezogene Aktivitäten entsprechen der Nachfragesteu-erung. Diese beschränkt sich nicht allein auf die Befriedigung des Bedarfs, sondern umfasst auch, ihn im Sinne einer Verhaltenssteuerung der Marktteilnehmer zu wecken und zu beein-flussen.11 Die unternehmensbezogenen Tätigkeiten beziehen sich auf die Abstimmung der Marketingaktivitäten und Ausrichtung der Marketinginstrumente auf die Unternehmensziele.12 Marketing hat zudem noch die gesellschaftsbezogene Aufgabe, die soziale Verantwortung gegenüber verschiedensten Anspruchsgruppen der Gesellschaft zu erfüllen.13
Marketing wird immer bedeutsamer, denn in den zurückliegenden Jahrzehnten wurden die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen stets schwerer.14 Immer mehr Unternehmen und immer mehr Marken drängen auf den Markt. Markenprodukte werden durch Handelsmarken ersetzt. Konkurrierende Produkte und Dienstleistungen unterscheiden sich kaum noch vonein-ander. Die Marketer stehen seit langem vor der Herausforderung, bei zunehmendem Wettbe-werb ständig innovativeres Marketing zu führen. Denn Marketing ist heutzutage unerlässlich, um auf dem Markt erfolgreich zu agieren.
2.2 Marketing-Konzeption
2.2.1 Wesen und Aufgabe einer Marketing-Konzeption
„Eine Marketing-Konzeption kann aufgefasst werden als ein schlüssiger, ganzheitlicher Handlungsplan, der sich an angestrebten Zielen orientiert, für ihre Realisierung geeignete Strategien wählt und auf ihrer Grundlage die adäquaten Marketinginstrumente festlegt“, so definiert Jochen Becker die Bedeutung der Marketing-Konzeption.15 Hinter dieser Definition verbirgt sich ein Planungskonzept mit seinen wesentlichen Planphasen (s. Kap. 2.2.2).16
Ein solcher konzeptioneller Handlungsprozess dient der marktorientierten Unternehmenssteu-erung. Der Bedarf einer strategischen und zielfundierten Marketing-Konzeption ist angesichts der hohen Markt- und Unternehmenskomplexität sowie der erheblichen Veränderungsdyna-mik auf dem Markt sehr bedeutend.17 Doch viele Unternehmen erstellen nur Teillösungen anstelle eines ganzheitlichen Konzepts. Diese Bruchstücke passen später nicht zusammen oder sind nicht einheitlich zielführend und verursachen damit einen hohen Korrekturaufwand.
Die Hauptaufgabe der Marketing-Konzeption ist es, als grundlegender Leitplan des gesamten Unternehmens alle markt- und kundenrelevanten Maßnahmen zu planen, zu gestalten und umzusetzen.18 Sie gibt der Markt- und Unternehmensausrichtung mithilfe von Planungs- und Entscheidungsschritten eine exakte Struktur, um einen ganzheitlich orientierten Marketing-prozess zu gewährleisten und nachträgliche Korrekturen auszuschließen.19
2.2.2 Phasen der Marketingkonzeption
Zu den wesentlichen Bestandteilen eines so genannten „Handlungsplans“ zählen die Situati-onsanalyse, Ziele, Strategie, Marketing-Mix-Komponenten und das Marketing-Controlling (s. Abb. 1).20 21 Die Situationsanalyse bildet den Ausgangspunkt des Entscheidungsprozesses (s. Anhang 1).22 Darauf folgend sind konkrete Ziele zu definieren (s. Anhang 2). Auf Grundlage der Marketingziele erfolgt dann die Ableitung einer langfristigen Strategie (s. Anhang 3). Umgesetzt werden diese mithilfe marktgerichteter Marketing-Mix-Maßnahmen (s. Anhang 4).23 Zu diesen Komponenten zählen im Allgemeinen die Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik Schließlich wird das Konzept mittels Marketingcontrolling abge-schlossen (s. Anhang 5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Konzeptionspyramide24
2.2.3 Die Stellung der Messe im Marketing-Mix
Unter Messe wird grundsätzlich eine zeitlich und örtlich festgelegte Veranstaltung mit Markt-charakter verstanden.25 Sie ist Teil der Kommunikationspolitik im Marketing-Mix und unter dem Punkt Verkaufsförderung wiederzufinden (s. Abb. 2).26
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als absatzpolitisches Instrument verfolgt sie das Ziel der Präsentation und Information von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Aber auch Kommunikationsziele wie der direkte Verkauf, die direkte (Neu-)Kundenansprache oder Pflege der Kundenbeziehung sind Zweck einer Messe.27 Letzteres ist der Grund, warum Unternehmen Messen hoch bewerten. Firmen sehen in Messen die Chance, selbst gesehen zu werden, bestehende Geschäftsbezie-hungen zu nutzen und neue Beziehungen anzubahnen.28
Abb. 2: Stellung der Messe im Marketing-Mix29
2.3 Messemarketing
2.3.1 Bedeutung des Messemarketings
Dem Messemarketing kommt ein besonderer Stellenwert zu. In der Literatur findet der Beg-riff des Messemarketings sowohl für den Einsatz von Messen als Marketinginstrument im Rahmen des Marketing-Mixes von Ausstellern Verwendung (s. Kap. 2.2.3), als auch für das Marketing aus Sicht der Messeveranstalter.30 Im Folgenden wird unter Messemarketing das Marketing aus Sicht der Veranstalter verstanden. In diesem Sinne steht Messemarketing für die Planung, Koordination und Kontrolle aller marktgerichteten Aktivitäten einer Messe.31 Die Besonderheit dieses Messemarketings liegt in der Berücksichtigung zweier unterschiedlicher Kundengruppen: die Aussteller und die Besucher.32
2.3.2 Konzeption des Messemarketings
Im Einzelnen entspricht der Prozess des Messemarketings dem allgemeinen Entscheidungs-prozess der Marketing-Konzeption (s. Kap. 2.2.1).33 Dabei bildet die Situationsanalyse eben-falls den Ausgangspunkt des Entscheidungsprozesses im Messemarketing.34 Nach der Situati-onsanalyse folgt die Zieldefinition.35 Auf Grundlage der Marketingziele erfolgt die Ableitung langfristiger Marketingstrategien. Umgesetzt werden diese mithilfe marktgerichteter Marke-ting-Mix-Maßnahmen.36
Hierbei wird allerdings die Produktpolitik anders aufgefasst: Messen stellen Dienstleistungen dar und somit wird in diesem Fall von einer Leistungspolitik gesprochen.37 38 Im Rahmen der Leistungspolitik sind Entscheidungen über die Ausgestaltung der Messe zu treffen. Die Preis-politik umfasst die Kalkulation aller aussteller- und besucherseitigen Preise und Sonderkondi-tionen. Unter dem klassischen Punkt „Distribution“ fallen im Messewesen logistische Dienst-leistungen wie beispielsweise die Bereitstellung von Parkflächen oder öffentlichen Verkehrs-mitteln. Der Kommunikationspolitik sind alle Komponenten zuzuordnen, die sich mit der zielgruppengerichteten Kommunikation beschäftigen. Zusätzlich zählt im Messewesen neben den klassischen vier Komponenten auch das Prozessmanagement als Marketing-Mix-Instrument.39 Und schließlich ist das Marketing-Controlling für die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle im Rahmen des Messemarketingprozesses zu berücksichtigen.40
3 Analyse
Die Resultate der Situationsanalyse der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ basieren auf Grundlage primärer und sekundärer Daten. Die primäre Datenerhebung stützt sich auf Befra-gungen der Messeveranstalter und –aussteller, des Geschäftsführers der Messehalle (Herr Hagler) sowie eigenes Benchmarking der Jobmesse „Absolventenkongress“ in Köln (s. An-hang 6 - 7). Sekundäre Daten wurden über verfügbare Konzept- und Feedback-Unterlagen der Veranstalter, Handzettel, Presseberichte und Studien der Industrie- und Handelskammer Regensburg (IHK Regensburg) eingeholt (s. Anhang 8 - 10).41 42 Zum Abschluss der Untersu-chung werden anhand einer SWOT-Matrix die Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken der Arbeitsplatz-Messe gegenübergestellt und hilfreiche Strategien gebildet.
3.1 Interne Analyse
3.1.1 Analyse des Leistungsangebots (Eigenbild)
Zur Analyse des Leistungsangebots werden die berühmten vier P´s (Product, Promotion, Place, Price) des Marketing-Mixes herangezogen, da sie einen umfassenden Aufschluss über die Messe und deren Leistungsangebot geben.43
3.1.1.1 Leistungspolitik
Bei der Analyse der Ausgestaltung und des Leistungsangebots der Messe werden folgende Punkte untersucht: der Veranstaltungsort und –zeitpunkt, das Programm, das Catering sowie Serviceleistungen.
3.1.1.1.1 Veranstaltungsort
Als Veranstaltungsort wurde die Max-Reger-Halle der Stadt Weiden i. d. Opf. ausgesucht. Bei der Wahl des Veranstaltungsorts zählen Entscheidungskriterien wie ausreichende Ausstel-lungsfläche, Preise, Lage/Anbindung und Image bzw. Bekanntheitsgrad.44 45 Nach einem Ver-gleich der Max-Reger-Halle in Weiden mit dem Kultur- und Veranstaltungszentrum Kett-lerhaus in Tirschenreuth und der Stadthalle in Neustadt/WN stellen sich folgende Ergebnisse heraus:
Die Entscheidung, die Max-Reger-Halle als Veranstaltungsort zu nutzen, war eine gute Wahl (s. Anhang 11). Die Miete der Halle ist zwar etwas teurer als bei den beiden anderen Stadthal-len, aber sie bietet entsprechend mehr Platz und mehr Zusatzleistungen. Zudem ist sie sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und besitzt in der nordoberpfälzischen Region die größte Bekanntheit. Auch die teilnehmenden Firmen bewerteten den Veranstaltungsort zu insgesamt einhundert Prozent als gut bis sehr gut (s. Anhang 7).
3.1.1.1.2 Messezeitpunkt
Die Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ fand am 14. und 15. Juni 2008 - einem Samstag und Sonntag - statt. Der Messezeitpunkt Mitte Juni ist für eine Jobmesse mehr oder weniger unüb-lich.46 Dies zeigt eine Reihe von Online-Jobmesse-Portalen.47 48 Generell werden Jobmessen im Herbst oder Frühjahr veranstaltet. Für diese Aussage sprechen die Wetterverhältnisse. Vie-le der befragten Unternehmen gaben an, dass die Zielgruppe an warmen Sommertagen lieber andere Freizeitaktivitäten unternehmen als eine Messe zu besuchen. Daher ist die Wahl des Zeitpunktes für die Firmenmesse etwas riskant. Bei gutem Wetter besteht die Gefahr, dass potentielle Messebesucher abspringen. Allerdings sind noch Kriterien wie beispielsweise Schulferien, Feiertage und Parallel-Veranstaltungen zu berücksichtigen.49 Diesen Gesichts-punkten zufolge hatten die Organisatoren die Veranstaltung auf die richtige Zeit gelegt. 50
3.1.1.1.3 Rahmenprogramm
Im Allgemeinen ist das Rahmenprogramm von den Messezielen, der Zielgruppe und dem Budget abhängig.51 Des Weiteren werden die Gewichtung des Programms und die einzelnen Programmpunkte von der Art der Messe bestimmt.52
Das Programm der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ weist im Vergleich zu anderen Job-messen einige Schwächen auf. Die Vortragsthemen wurden beispielsweise ungleichmäßig auf beide Tage verteilt. Am ersten Veranstaltungstag gab es keine Wirtschaftsthemen, dafür wur-de der zweite Messetag zur Hälfte (von 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr) mit Vorträgen aus dem Wirtschaftsbereich besetzt. Hinzu kommt, dass die Menge der Vorträge aus der Welt der Wirtschaft insgesamt überwiegt und somit Abwechslung im Rahmenprogramm fehlt. Ferner zeigt die Grafik Nr. 3, welche Themen nach Ansicht der Aussteller auf einer Jobmesse relevant sind (s. Abb. 3). Demzufolge liegen Wirtschaftsthemen mit nur neun Prozent auf der Präferenz-Liste ganz weit unten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Themen auf Jobmessen nach Relevanz53
Ebenso wurden das Bewerbertraining und das Unterhaltungsspiel „Human Soccer“ laut Pro-grammplan nur am ersten Messetag angeboten. Damit wurden auch diese Punkte ungleichmä- ßig im Messezeitraum verteilt. Ein Blick in das Programm des „Absolventenkongresses“ zeigt, dass diese Services fortlaufend während der gesamten Messezeit angeboten werden.54
Auch unter Berücksichtigung der Zielgruppen wurden die Programminhalte ihnen nicht an-gepasst. „Auszubildende“ oder „Studenten“ fühlten sich durch wirtschaftliche Vortragsthe-men wie Mindestlohn oder Energieeffizienz im Gewerbebau nicht sonderlich angesprochen. Und nur eine kleine Gruppe der Facharbeitskräfte könnte sich für diese Themen interessiert haben, da nicht jede Fachkraft im Gewerbebau tätig ist. Themen, die sich auf das breite Publi-kum richten wie zum Beispiel „Bewerbung und Vorstellungsgespräch“ wurden kaum angebo-ten. Insgesamt gab es kaum etwas zum Thema Karriere und Beruf - was der Name „Arbeits-platz-Messe“ aber eigentlich verspricht.55
Des Weiteren wurden sonntags in einem „Unternehmer Café“ die Firmen der Region vorge-stellt. Am selben Tag liefen allerdings auch alle dreißig Minuten Unternehmenspräsentationen der teilnehmenden Aussteller. Somit wurden an einem Veranstaltungstag dieselben Themen präsentiert, was natürlich sehr uneffektiv und für die Zielgruppe uninteressant war.
Das Rahmenprogramm der Firmenmesse war insgesamt – insbesondere am Sonntag - zu tro-cken. Sechzig Prozent aller befragten Unternehmer beurteilten das Programm als befriedigend (s. Anhang 7). Ebenso gaben siebzig Prozent der Befragten an, dass ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Begleitprogramm auf einer Jobmesse sehr wichtig sei (s. Anhang 7). Demzufolge entsprach das Programm nicht allen Anforderungen eines Messeprogramms.
3.1.1.1.4 Catering
Neben dem Programm kommt auch dem Catering eine hohe Bedeutung zu.56 Je nach Dauer der Veranstaltung wird die Verpflegung immer wichtiger.57 Vor allem für die Besucher hat das Catering einen hohen Stellenwert. Sie stellen die Qualität des Catering direkt mit der Messequalität in einen Zusammenhang.58 Demzufolge muss die Verpflegung auf einer Messe gut durchdacht sein.59 Zugleich müssen die Speisen und Getränke der Ausstellung entspre-chend ausgewählt werden.
Im Fall der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ wurde neben Kaffee und Kuchen auch deutsche „Hausmannskost“ als Verpflegung angeboten. Kaffee und Kuchen anzubieten, ist auf Messen meistens kein Fehlgriff. Das Angebot heimischer Weiswürstchen mit Brezeln und Käsespätzle passte zur bayrischen Region. Zugleich war für jeden Geschmack, das heißt, für Fleischesser und Vegetarier, etwas dabei. Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, denn ein mehrstündiger Messeaufenthalt mit leerem Magen führt zu Unzufriedenheit der Messebesu-cher. Die Auswahl der Speisen war letztendlich angemessen, da sie der Region entsprach und sowohl Fleischesser als auch Vegetarier kamen auf ihre Kosten. Allerdings bewertete der Großteil aller befragten Firmen die Verpflegung eher negativ (s. Anhang 7).
3.1.1.1.5 Service
Dem Bereich Service muss rund um die Veranstaltung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.60 Denn damit ist die Kundenzufriedenheit verbunden, die schließlich zum Messeer-folg beiträgt. Zum Service gehört beispielsweise das fortlaufende Funktionieren der Gardero-be oder eine kostenlose Kinderbetreuung. Auf diese Weise wird verhindert, dass Kunden ge-nervt oder verärgert sind. Bei der oben erwähnten Messe gab es weder einen Garderoben-Dienst noch eine Kinderbetreuung. Nach Aussagen vieler Aussteller fehlte während der Mes-severanstaltung auch eine Servicekraft, die sich um die Verpflegung der Aussteller selbst kümmerte. Alle Messestände waren von den Unternehmern mit nur wenig Personal ausgestat-tet (ein bis zwei Personen pro Stand), das nur schlecht sein „Revier“ verlassen konnte. Denn die Interessenten kamen zu jeder Zeit an den Stand.
3.1.1.2 Kommunikationspolitik
In diesem Abschnitt werden die eingesetzten Kommunikationsinstrumente der Messe anhand der Medien-Auswahl und -Gestaltung untersucht. Die Unterlagen der ersten Messeveranstal-tung zeigen auf, dass folgende (Werbe-) Medien eingesetzt wurden: Fernsehen, Hörfunk, Au-ßen- und Flyerwerbung, Internet, Promotion und insbesondere Pressearbeit (s. Anhang 12).
Die Werbewirkung dieser Kommunikationsmittel wurde durch unterschiedliche Einflussgrö-ßen bestimmt. Zum einen wurden hauptsächlich Massenmedien wie TV oder Außenwerbung eingesetzt, die kaum eine zielgruppengenaue Ansprache ermöglichen und deren Streuverlust sehr hoch ist.61 Dennoch war aufgrund der verhältnismäßig kurzen Planungszeit von vier Mo-naten der Einsatz von Massenkommunikationsmitteln unerlässlich. Denn eine auf die Ziel-gruppe angepasste Auswahl der Werbemedien nimmt in der Regel mehr Planungszeit in An-spruch, da die Auswahl und Gestaltung der Werbeträger gut durchdacht werden müssen. Au-ßerdem ermöglichen Massenmedien eine schnelle und kurzfristige Bekanntmachung.62 Des-halb war die Entscheidung angemessen, unter Berücksichtigung der kurzen Vorbereitungszeit, Massenmedien einzusetzen.
Neben der Auswahl der Medien ist auch deren Gestaltung nicht zielgruppengerecht gewesen. Es fehlte eine einheitliche Ansprache der Zielgruppe. Zudem hatten die Handzettel und Plaka-te einige gestalterische Mängel (s. Anhang 13). Die Postwurfsendung der Flyer erschwerte ebenfalls die Besucherakquisition. Und schließlich wurde die Werbewirkung auch durch die seltenen - und unregelmäßigen Werbeschaltungen - negativ beeinflusst.
3.1.1.3 Logistik
In Bezug auf Messen ist festzuhalten, dass die Logistik alle Aktivitäten beinhaltet, die not-wendig sind, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.63 In diesem Fall beinhaltet die Logistik jegliche Art von Material-, Informations- und Personenflüssen.64 Beispielsweise zählt hierzu neben der rechtzeitigen Anlieferung von Verpflegung und Tech-nik auch die Organisation eines Shuttlebusses.
Die Verpflegung für die Firmenmesse wurde (vertragsbedingt) vom zugehörigen Restaurant der Veranstaltungshalle organisiert. Sämtliche Technik stellten die Verantwortlichen der Halle bereit und die Messestände wurden von den Unternehmern angeliefert und aufgebaut. Was fehlte, war die Organisation von Taxis oder ein Busshuttle, sodass die Messebesucher einfa-cher zur Messe hin und wieder nach Hause hätten gelangen können.
3.1.1.4 Preispolitik
In der Untersuchung der Preispolitik der nordoberpfälzischen Messe wird herausgestellt, ob Preisgelder verlangt wurden und ob diese der Leistung entsprachen. Zudem soll geprüft wer-den, ob Preisaktionen stattfanden und welche Wirkung sie zeigten. Von der Arbeitsplatz-Messe sind drei erhobene, relevante Preise bekannt: Die Eintrittsgelder für Besucher, die Aus-stellermarge für die Unternehmer sowie das Entgelt für die Verpflegung.
Der Eintritt für Besucher auf der Recruiting-Messe war kostenlos. Grundsätzlich bietet ein Eintrittsgeld die Möglichkeit, Besucher zu selektieren und damit eine Kontrolle der Gäste sowie deren Anzahl durchzuführen.65 Eintrittsfreie Veranstaltungen dagegen bergen die Ge-fahr, dass andere als die angestrebten Zielpersonen auftauchen.66 Außerdem lässt sich bei ein-trittfreien Messen die tatsächliche Besucherzahl nur kaum oder sehr grob erfassen.67
Da aber die Kosten der Messe gedeckt waren und kein Gewinn geplant war, war die Ent-scheidung für einen kostenlosen Eintritt somit gerechtfertigt. Für die Zählung der Besucher-anzahl wurden ersatzweise die verteilten Handzettel herangezogen. Die Kosten für die Ver-pflegung wurden von den Ausstellern und Besuchern übernommen. Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn das Catering kann, je nach Anzahl der Personen, hohe Kosten erzeugen. Außer-dem würden sonst Besucher angelockt, die sich nicht unbedingt für die Messe interessieren, sondern nur die Verpflegung und Unterhaltung ausnutzen. Unter Berücksichtigung der kurzen Planungszeit und der damit einhergehenden geringen Möglichkeit, intensiv zu werben, war es sicherlich nicht falsch, keinen Eintritt zu erheben. Aber ebenso bieten vergleichbare Arbeits-platz-Messen einen kostenlosen Eintritt an.68
Die Aussteller dagegen bezahlten, in Abhängigkeit von Lage und Größe des Standes, einen Flächenpreis zwischen 300,- Euro (2,4 m x 2,4 m) und 750,- Euro (4,8 m x 2,4 m) (s. Anhang 14). Der Regelbetrag lag bei 400,- Euro pro Stand bei einer Fläche von 2,4 m x 2,4 m. Laut Aussteller-Umfrage war der Großteil aller Unternehmen mit dem Preis-Leistungsverhältnis mehr als zufrieden (s. Anhang 7).
Auch an Preisaktionen wie eine „Happy-Hour“ wurde gedacht. Dies ist sicherlich eine sinn-volle Marketing-Idee, weil diese Preisaktion viele Vorzüge aufweist: Der Markt wird stimu-liert und damit die Kundenfrequenz erhöht. Schließlich wurde auch kurzfristig eine deutliche Umsatzsteigerung erzielt, die dem Restaurant zugute kam.69 Wie gesagt war die Happy-Hour-Aktion ein sehr guter Gedanke, um Besucher anzulocken, allerdings wurde er in den Werbe-mitteln schlecht kommuniziert. Eine Happy-Hour sollte sich auch – dem Namen entsprechend – auf volle Stunden beziehen.
Die erste preispolitische Aktion begann um 10:30 Uhr und endete um 11:00 Uhr. Abgesehen davon, dass es zu einer ungeraden Uhrzeit begann, entspricht dieses auch keiner vollen Stun-de. Einerseits sind volle Stundenanzeigen einfacher zu merken, andererseits ist eine halbe Stunde zu kurz, um viele Besuchern zu bedienen. Hinzu kommt, dass die Aktionszeit - wäh-rend der Messeeröffnung - sicherlich wenig sinnvoll war, da sich die meisten Gäste bei der Eröffnungsrede befanden. Die Idee, Happy Hours ins Programm einzufügen, war eine sehr gute Wahl. Allerdings wurde sie nicht effektiv umgesetzt und verlor daher teilweise ihre Wir-kung.
3.1.2 Analyse der Leistungswahrnehmung (Fremdbild)
Die Leistungswahrnehmung der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ wurde von den teilneh-menden Firmen mittels Befragung eingeholt (s. Anhang 7). Dabei wurden folgende messere-levante Punkte abgefragt: Messe-Idee, Veranstaltungszeitpunkt und -ort, Rahmenprogramm, Zielgruppe, Besucherzahl, Messeorganisation, regionale und überregionale Werbung, Preis-Leistungsverhältnis und Verpflegung.
Den Einfall, solch eine Jobmesse in der Region zu veranstalten, fanden einhundert Prozent der Befragten gut bis sogar sehr gut. Der Veranstaltungszeitpunkt dagegen wurde von fast sechzig Prozent nur als befriedigend bis schlecht eingestuft. Als Grund nannten die Teilneh-mer das warme Wetter. Laut Aussage der befragten Unternehmen bevorzugen sie eher den Herbst und insbesondere das Frühjahr für die Veranstaltung einer Messe.
Des Weiteren hielten die Unternehmen den Veranstaltungsort für insgesamt gut bis sogar sehr gut. Das Rahmenprogramm war für sechzig Prozent relativ befriedigend. Hierzu gab es An-merkungen, dass sie das Programm selbst weniger interessiert und dass es hauptsächlich dazu dient, Besucher anzuziehen. Die Zielgruppe wurde von den Befragten zu fast sechzig Prozent als befriedigend bis eher schlecht bewertet (s. Abb. 4). Die fatalsten Fehler waren nach Anga-ben der Unternehmen, dass die Zielgruppe einerseits zu breit definiert war und andererseits nicht zielgruppengerecht angesprochen wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Zielgruppe70
Die Anzahl der Messebesucher bewerteten die befragten Teilnehmer insgesamt zu ungefähr sechzig Prozent mit befriedigend bis eher schlecht (s. Abb. 5). Die meisten fanden, dass zu wenige Gäste gekommen waren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Besucheranzahl71
Die Organisation der Firmenmesse beurteilten fast neunzig Prozent der befragten Aussteller mit gut bis sehr gut (s. Abb. 6). Allerdings gab es hierzu kritisch zu bemerken, dass Kleinig-keiten zu Verärgerung geführt hätten. Einige der Befragten hätten sich mehr Unterstützung beim Aufbau gewünscht. Und einer erwähnte, dass die vorgegebene Zeit für den Aufbau sei-tens der Veranstalter nicht eingehalten wurde. Die Aussteller hätten vor geschlossenen Türen gestanden, was zu Missstimmung bei den Ausstellern geführt habe. Des Weiteren wurde oft die schlechte Akustik in der Veranstaltungshalle bemängelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Messeorganisation72
Die regionale Messe-Werbung wurde mit insgesamt achtundfünfzig Prozent als befriedigend bis schlecht bewertet (s. Abb. 7). Laut den Befragten fehlte eine zielgruppenspezifische An-sprache, aber auch die Werbeaktionen insgesamt wurden als zu gering eingeschätzt. Dagegen wurde die überregionale Werbung mit neunzig Prozent noch schlechter bewertet. Überregio-nale Zielgruppen wurden den Angaben der Firmen zufolge kaum umworben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Messe-Werbung73
Im Gegensatz dazu gaben fiber siebzig Prozent aller Befragten an, dass sie das Preis-Leistungsverhältnis gut bis sehr gut fanden. Allerdings empfanden ffinfundffinfzig Prozent der Aussteller die Verpflegung – und zwar aufgrund der fehlenden Bedienung - als befriedigend bis eher schlecht.
3.2 Externe
3.2.1 Marktsituation
Um einen Überblick fiber die Marksituation zu bekommen, wird auf die Marktstruktur, das Marktvolumen mit seinem Marktbestand und –bedarf sowie auf den Markttrend und Marktab-schnitt eingegangen (s. Anhang 15).74 Anschließend werden die Marktteilnehmer und schließ-lich die Abgrenzung des relevanten Marktes analysiert.75
3.2.1.1 Marktstruktur
In diesem Abschnitt wird zunächst die Nordoberpfalz betrachtet. Schließlich wurde und wird die Messe in diesem Gebiet veranstaltet. Danach wird die gesamte Oberpfalz untersucht und im letzten Schritt folgen die umliegenden Regionen Oberfranken, Mittelfranken und Nieder-bayern.
Die Nordoberpfalz hat insgesamt 218.688 Einwohner.76 Davon sind 67.376 berufstätig. 23.823 der Nordoberpfälzer leben in der Stadt Weiden i. d. Opf., 19.627 im Landkreis Tirschenreuth und 23.926 im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.77 Laut einiger Studien der IHK Regensburg ist die Einwohnerzahl in der Nordoberpfalz in den vergangenen Jahren leicht gesunken. Stärker gefallen ist die Beschäftigtenzahl, insbesondere im Umkreis von Tirschenreuth. Die Bruttoinlandsprodukte in den nordoberpfälzischen Regionen sehen wie folgt aus: Die Stadt Weiden besitzt ein BIP von 45.870 Euro und gehört damit zu den Top-Städten der gesamten Oberpfalz (Stand 2006).78 Der Kreis Tirschenreuth verffigt fiber einen Pro-Kopf-BIP von 21.618 Euro.79 Und der Landkreis Neustadt/WN hat ein BIP von 18.694 Euro.80
Weiter ausgeholt ist die Oberpfalz mit insgesamt 1.201.217 Einwohnern eine kulturell attrak-tive Region im Norden Bayerns. 399.884 sozialpflichtige Beschäftigte wohnen hier.81 Das BIP der Oberpfalz liegt bei 29.180 Euro pro Kopf.82
Im umliegenden Bezirk Oberfranken leben 1,1 Millionen Einwohner. Davon sind 527.700 Menschen erwerbstätig.83 Das BIP in der oberfränkischen Region beträgt ungefähr 26.302 Euro je Einwohner.84 Der bayrische Bezirk Mittelfranken zählt 1.714.453 Einwohner.85
Die Region hat 800.000 Erwerbstätige.86 Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei ungefähr 54.797 Euro. Niederbayern dagegen verfügt über 1,2 Millionen Einwohner mit insgesamt 571.000 erwerbstätigen Personen.87 Das Pro-Kopf-BIP liegt bei 27.657 Euro (Stand 2006).88
3.2.1.2 Marktvolumen
Die Arbeitsplatz-Messe wurde eingeführt, um junge und insbesondere qualifizierte Fachar-beitskräfte für die Region zu gewinnen. Das Marktvolumen zeigt auf, ob ein Bestand ver-gleichbarer Messen im relevanten Markt vorhanden ist. Ebenso soll überprüft werden, ob ü-berhaupt ein Bedarf für die Firmenmesse besteht.89
3.2.1.2.1 Messebestand
Der allgemeine Messebestand ist in Deutschland, wie überall in der Welt enorm. Allerdings interessiert hier, wie der Bestand vergleichbarer Arbeitsplatz-Messen auf dem Markt aussieht. In Bezug auf das Zielsegment „Facharbeitskräfte“ ist die Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ in dieser Form allein auf dem gesamten oberpfälzischen Markt.90 91 Es werden zwar Jobmes-sen und –börsen angeboten, aber keine, die der Arbeitsplatz-Messe ähnelt. Die meisten der Veranstaltungen beziehen sich auf Auszubildende und vor allem angehende Akademiker.92 Auch in den naheliegenden Bezirken und weiter auswärts sind ebenfalls keine identischen Arbeitsplatz-Messen zu finden. Aber ähnliche bzw. indirekt vergleichbare Messen sind au-ßerhalb der Oberpfalz vorzufinden. Daraus lässt sich folglich ableiten, dass die Messe „Ar-beitsplatz Nordoberpfalz“ die einzige Veranstaltung ihrer Art ist, aber indirekte Wettbewerber vorhanden sind (s. Kap. 3.2.2.3.1).
3.2.1.2.2 Messebedarf
Die Nordoberpfalz hat - wie jede andere Region auch - ihre Stärken und Schwächen. Zu den Stärken zählen beispielsweise die zentrale Lage mitten im Herzen Europas, optimale und viel-seitige Bildungsmöglichkeiten, niedrige Lebenshaltungskosten und eine gute Verkehrsinfra-struktur.93 Demgegenüber liegen die Schwächen beispielsweise in der fehlenden Attraktivität der Region für Fachpersonal, im Mangel an jungen und qualifizierten Facharbeitskräften, im schlechten Image der Region oder auch im demografischen Wandel.94
Aufgrund der relativ kritischen Lage der Nordoberpfalz besteht ein großer Bedarf für diese Messe, denn mehr und mehr Facharbeitskräfte verlassen die Region und neue kommen nur schwer hinzu.95 Über das daraus resultierende Defizit an qualifiziertem Personal beschweren sich auch immer mehr Unternehmen. Da bietet sich eine Recruiting-Messe bestens an, denn viele Firmen sehen inzwischen den Vorteil von Jobmessen darin, dass sie persönlichen und direkten Kontakt mit den Bewerbern aufnehmen können.96
Zudem reicht eine Stellenanzeige beim Kampf um qualifiziertes Personal heutzutage nicht mehr aus. Deshalb sind Recruiting-Messen mittlerweile sehr beliebt geworden.97 Ein weiterer Punkt, der für die Arbeitsplatz-Messe spricht, sind die national und international erfolgreichen Unternehmen der Region, die dem Zielsegment auch eine interessante Karriere ermöglichen. Schließlich trägt eine solche Messe auch zum Regionalmarketing bei, denn Messen sind Teil der Kommunikationspolitik im Marketing.98 All diese Punkte sprechen für die Messe und da-für, dass ein hohes Besucherpotenzial generiert werden kann.
Bei Betrachtung der aktuellen Wirtschaftslage in Deutschland und der Welt steht die Messe allerdings vor folgenden Tatsachen: Ein Blick in die Tageszeitung gibt einen Eindruck über die derzeitige Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Doch obwohl der Aufschwung we-gen der Finanzkrise an Fahrt verloren hat, kann Entwarnung gegeben werden: Der Personal-bedarf der Unternehmen bleibt auf hohem Niveau.99 Das heißt, Fachkräfte werden nach wie vor gesucht.100 Zwar stagnieren die Gehälter für Fachkräfte, aber auf sehr hohem Niveau.101 Wegen der internationalen Finanzkrise stehen dem Arbeitsmarkt schwere Zeiten bevor. Den-noch sehen Wirtschaftsverbände keinen Anlass, den von ihnen diagnostizierten Mangel bei Fachkräften zu relativieren.102
Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) wollen bis Ende des Jahres 2009 gut sechsunddreißig Prozent der Unternehmen mehr Fachkräfte mit abgeschlos-sener Berufsausbildung einstellen und nur sechs Prozent entsprechende Stellen abbauen (s. Abb. 8).103 Knapp achtunddreißig Prozent der Unternehmen klagen vor allem über einen Man-gel an Fachkräften und Akademikern der Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwis-senschaften und Technik.104 Insbesondere größere Betriebe mit mehr als fünfhundert Mitarbei-tern fahnden regelrecht nach Technikern, weil viele Kollegen in den Ruhestand gehen und Nachwuchs nur schwer zu bekommen ist.105
Die Aussagen der Experten und der Studien deuten darauf hin, dass die aktuelle Wirtschafssi-tuation in Deutschland für die Recruiting-Messe in der Nordoberpfalz nicht bedrohlich ist. Im Gegenteil. Trotz Krise und leichtem Rückgang offen gemeldeter Arbeitsplätze herrscht noch immer ein hoher Bedarf an Facharbeitskräften. Und demzufolge gibt es einen großen Bedarf für die Messe.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Bundesweiter Bedarf an Facharbeitskräften106
3.2.1.3 Branchenentwicklung
Einer Studie des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses der deutschen Wirtschaft e. V. (AU-MA) zufolge ist die Anzahl der Messeveranstaltungen in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.107 Messen bieten viele Vorteile: Kontakte zwischen Ausstellern und Besucher können geknüpft, die stark erklärungsbedürftigen Produkte erläutert und die Kun-denbeziehungen intensiviert werden. Der persönliche Kontakt zum Kunden bekommt dabei einen immer höheren Stellenwert.108 All diese Gründe reizen immer mehr Unternehmen, sich an Messen zu beteiligen.
Bei Jobmessen geht es dann eher ums Sehen und Gesehenwerden sowie um das frühzeitige Knüpfen von Kontakten zwischen den Firmen und Bewerbern.109 Wenn Unternehmen heutzu-tage nach Top-Talenten suchen, reicht die klassische Anzeige oder eine interne Ausschrei-bung längst nicht mehr aus. 110 Der Kampf um hochqualifizierte Mitarbeiter ist groß und nimmt stetig zu.111 Und das gilt nicht nur für die Global Player. In Anbetracht des zunehmen-den Fachkräftemangels reagieren auch Mittelständler und setzen inzwischen auf größere An-werbemaßnahmen wie Jobmessen und Events.112
Die von der AUMA aufgestellte Analyse besagt ebenfalls, dass sich der Messetrend bis zum Jahre 2020 positiv entwickeln wird.113 Damit werden das Interesse und die Teilnahme an Mes-sen im Allgemeinen weiterhin steigen. Angesicht der Tatsache, dass Jobmessen aufgrund des steten Kampfes um qualifiziertes Fachpersonal immer beliebter werden, entspricht dieser Trend auch der Entwicklung von Jobmessen.114 Ebenso bestätigen viele Fachartikel und kleine Studien den bisherigen Anstieg oder Ausbau von Jobmessen.115 116 Ein reelles Beispiel hierfür ist die Berufsinfomesse in Offenburg: Zu Beginn verzeichnete diese europaweit bekannte Messe circa 7.500 Besucher. Bis zum Jahre 2008 stieg die Zahl auf fast 21.000 Gäste.117
Auch andere Jobmessen weisen diesen Trend auf.118 Auch die Messe „My Job – OWL“ be-weist, dass sich der Trend von Jobmessen trotz aktueller Finanzkrise positiv entwickelt.119 Denn sie verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr (2008) einen Anstieg der Aussteller- und Besucherzahl. Daraus lässt sich folgern, dass auch der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ gute Wachstumschancen bevorstehen.
3.2.1.4 Marktabschnitt
Da sich die Marketingaktivitäten vom Marktabschnitt im Lebenszyklus beeinflussen lassen, muss auch dieser Faktor bei der Werbeplanung berücksichtigt werden.120 Die Messe „Arbeits-platz Nordoberpfalz“ fand im Sommer 2008 das erste Mal statt. Somit liegt sie eindeutig in der Einführungsphase des Produktlebenszyklus. Dieser Marktabschnitt zeichnet sich dadurch aus, dass hier versucht wird, Marktzugang zu erhalten und Messebekanntheit zu gewinnen.121
Auf Grundlage dessen, dass sich die Messe in der Einführung befindet, sind in dieser Phase wichtige Eintrittsbarrieren zu erwähnen. 122 Zu den Anfangshindernissen der Firmenmesse zählen zum einen die hohen Werbeinvestitionen, denn intensive Vermarktungsaktionen sind unerlässlich, bis die Messe an Bekanntheit gewinnt und im Gedächtnis des Zielsegments fest verankert ist.123 Zum anderen macht das kaum verfügbare Know-how in diesem Fachgebiet Sorge. Auch das Marktpotenzial und der –anteil sind bei der Einführung der Messe nicht ein-deutig überschaubar. Dementsprechend ist die Leistung mit hohem Risiko verbunden, sodass die Schau ein Misserfolg werden könnte.124
3.2.2 Markteilnehmer
Im Fall der regionalen Arbeitsplatz-Messe handelt es sich hierbei um folgende Akteure: die Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“, konkurrierende Jobmessen und die Kunden, also Aus-steller und Besucher (s. Abb. 9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Marktteilnehmer125
3.2.2.1 Kundensituation
In diesem Kapitel werden die aktuellen Kundengruppen analysiert, um später eine zielgrup-penorientierte Marktabgrenzung vornehmen zu können. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Erfassung und Beschreibung der charakteristischen Merkmale der sogenannten Kunden-gruppen.126 In Bezug auf die Untersuchungsfaktoren gibt es viele Möglichkeiten. Für die Kundenanalyse der Messe „Arbeitsplatz Nordoberpfalz“ werden demografische und sozio-ökonomische Eigenschaftsmerkmale herangezogen, da alle weiteren Untersuchungskriterien mangels Datenbestand nicht genutzt werden können. Demografische (zum Bespiel Geschlecht oder Alter) und sozioökonomische Merkmale (beispielsweise Bildungsstand oder Berufser-fahrung) setzen an messbaren und äußerlich leicht erkennbaren Merkmalen an, die sich so-wohl für Privatpersonen, als auch für Unternehmen (zum Beispiel Branche oder Unterneh-mensgröße) anwenden lassen.127 Die Kundenanalyse bringt schließlich folgende Erkenntnisse:
3.2.2.1.1 Aussteller
Bei den Ausstellern waren Unternehmen aus verschiedensten Branchen in unterschiedlicher Größenordnung vertreten. Der Großteil der Messeaussteller stammte aus Weiden i. d. Opf. und der näheren Umgebung (s. Anhang 10). Vereinzelt waren auch Firmen von außerhalb der Nordoberpfalz an der Messe beteiligt - wie beispielsweise die I. K. Hofmann GmbH aus Schwandorf. Die Mehrheit der Aussteller bestand aus Mittel- bis Großunternehmen, die bis zu 1000 Mitarbeiter oder mehr beschäftigen (s. Abb. 10).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10: Ergebnis der Ausstellerbefragung: Anzahl der Mitarbeiter128
3.2.2.1.2 Besucher
Obwohl die Aussteller für die Messeveranstalter die ökonomisch interessantere Kundengrup-pe ist, ist es vor allem aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Aussteller- und Besucher-bindung unumgänglich, die Gäste zukünftig stärker in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen.129
Bisher war eine hohe Besucherzahl (quantitativer Aspekt) der Indikator für die Attraktivität einer Messe. Qualitative Aspekte wurden wenig beachtet. Doch müssen auch die Ansprüche der Aussteller, die sich eine qualitativ hochwertige Besucherstruktur wünschen, von den Mes-severanstaltern befriedigt werden, wenn sie ebenfalls dauerhaft gebunden werden sollen.130 Damit klar wird, um welche Zielpersonen es sich bei der Firmenmesse genau handelt, werden sie in diesem Abschnitt nach demografischen und sozioökonomischen Kriterien untersucht.
Zur Analyse der bisherigen Besucher (Azubis, Studenten und Facharbeitskräfte) werden Ge-schlecht und Alter, der Bildungsstand sowie die Berufserfahrung als Untersuchungsfaktoren herangezogen. Diese vier Angaben geben ausreichend Auskunft darüber, ob diese Personen-gruppen für die Firmenmesse und deren Zielsetzung relevant sind. Insbesondere der Bil-dungsgrad und die Berufserfahrung sind für die Messeziele wichtig, denn diese leisten einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Fortschritt der Region.131
Grundsätzlich zeigt sich ein deutlich geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten bei allen Besuchersegmenten: Frauen bevorzugen Berufe, bei denen der tägliche Umgang mit Men-schen im Vordergrund steht (Kauffrau im Einzelhandel oder Friseurin) oder streben kaufmän-nische Bürotätigkeiten an (Büro- oder Industriekauffrau). Männliche Arbeitskräfte ziehen eher technische Berufe (Kfz- oder Industriemechaniker) und handwerkliche Berufe (Tischler, Maler und Lackierer) vor.132
3.2.2.1.2.a Auszubildende
Nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sind Azubis im Durchschnitt zwischen sechzehn und fünfundzwanzig Jahren alt.133 Der Bildungsgrad für an-gehende Lehrlinge sieht laut BMBF folgendermaßen aus: 2,1 % sind ohne Schulabschluss, 30,8 % haben einen Hauptschulabschluss.134 Knapp 40 % der Auszubildenden mit neu abge-schlossenen Verträgen hatten zuvor einen Realschulabschluss gemacht und 17,3 % begannen eine Lehre mit einem Fach- oder allgemeinen Abitur (Stand 2005).135 Die Zahl der Gesellen mit Realabschluss stellt momentan den größten Anteil dar, wobei die Anzahl der Auszubil-denden mit Abitur stetig steigt.136 Lehrlinge besitzen jedoch keine Berufserfahrung, da sie – wie der Name schon sagt – einen Beruf erst erlernen müssen.
3.2.2.1.2.b Studenten und Hochschulabsolventen
Studenten und Hochschulabsolventen gehörten auch zu einer der angestrebten Zielgruppen. Studenten und Absolventen sind laut BMBF im Schnitt 24,9 Jahre alt.137 Bei einem Vergleich der Geschlechter sind die männlichen Studenten mit 25,2 Jahren um 0,7 Jahre älter als ihre weiblichen Kommilitoninnen.138 Studenten und Absolventen verfügen zudem häufig über ei-nige Jahre Berufserfahrung. Durch eine vorherige Berufsausbildung, Pflicht- und freiwillige Praktika sowie Werkstudententätigkeiten sammeln sich diverse Berufsjahre an.
3.2.2.1.2.c Facharbeitskrafte
Die dritte, angestrebte Besuchergruppe umfasste die Facharbeitskräfte. Die Bezeichnung „Facharbeitskräfte“ wird durch eine zwei- bis dreieinhalbjährige Ausbildung mit einer be-standenen Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer er-worben.139 Allerdings kann auch diese Definition weiter konkretisiert werden, indem der Begriff „Facharbeitskraft“ auf bestimmte Berufszweige eingegrenzt wird. Die Entscheidung hierfür liegt allerdings bei den Messeverantwortlichen.
Begriff „Facharbeitskraft“ auf bestimmte Berufszweige eingegrenzt wird. Die Entscheidung hierfür liegt allerdings bei den Messeverantwortlichen.
Die qualifizierten Facharbeitskräfte können bereits in einem Arbeitsverhältnis stehen oder arbeitssuchend sein. In Hinblick auf das Alter dieser Zielgruppe ist zu bedenken, dass wo-möglich nicht nur „junge“ Menschen kommen. Laut einer Studie der Bundeszentrale für poli-tische Bildung (BPB) wird sich der demografische Wandel in der nächsten Zeit drastisch ver-ändern. Danach werden die Menschen älter und die Personenzahl der älteren Generation wird zunehmen.140 Laut IHK Regensburg wird sich folglich in den kommenden Jahren auch das Erwerbspersonenpotenzial in der Nordoberpfalz deutlich zum Negativen verändern.141 Wäh-rend der Anteil der Fünfzehn- bis Dreißigjährigen um drei Prozentpunkte zurückgeht, nimmt der Anteil der dreißig bis fünfundvierzig Jahre alten Bevölkerungsgruppe um achtzehn Pro-zent zu.142 Bei der Altersgruppe über fünfundvierzig steigt die Anzahl sogar um siebenund-zwanzig Prozent.143 Besonders betroffen ist der Landkreis Tirschenreuth.144
Hinzu kommt, dass das Renteneintrittsalter auf siebenundsechzig erhöht wurde. Demzufolge muss mit mehr älteren Messebesuchern gerechnet werden.145 Manche Behauptungen lauten, dass Facharbeitskräfte im höheren Alter weniger mobil sind, die Firmen mehr kosten und sie weniger dynamisch arbeiten würden als junges Personal.146
Allerdings belegen auch viele Studien das Gegenteil. Sie besagen, dass ältere Menschen zahl-reiche Vorteile mitbringen – auch wenn sie mehr kosten. Zu diesen Vorzügen gehören - neben langjähriger Arbeitserfahrung und hohem Fachwissen - auch Fähigkeiten wie beispielsweise strategisches Denken, überlegtes Handeln, ein ganzheitliches Verständnis, ein differenzierte-rer Sprachgebrauch und soziale Kompetenzen.147 148 Zudem belegen Studien, dass auch die ältere Generation bereit ist, sich Neues anzueignen und sich weiterzubilden.149 Damit steht diese Arbeitnehmer-Gruppe gar nicht so schlecht da, wie viele denken.
Laut Aussage der Messeveranstalter und –aussteller stehen insbesondere Ingenieure ganz o-ben auf der Liste der Zielgruppen. Die Techniker und Tüftler sind nach Auskunft des Instituts für Wirtschaft in Köln (IWK) „Mangelware“ auf dem deutschen Arbeitsmarkt.150 Da ein Großteil der Unternehmen in der Nordoberpfalz in der Technologiebranche zu Hause ist, sind diese Zielpersonen besonders zu berücksichtigen.
3.2.2.2 Medien
Medien stellen ein Bindeglied zwischen allen Interessengruppen einer Messe dar.151 Da sie Multiplikatoren, Meinungsbildner und Sprachrohre der öffentlichen Meinung sind, haben sie einen starken Einfluss.152 Messeveranstalter und –aussteller werden über die Presse zur unmit-telbaren Zielgruppe der Kommunikation und daher müssen Journalisten unbedingt an der Firmenmesse teilnehmen. Umgekehrt hat wiederum die Presse ein Interesse an Messebeteili-gungen.153 Noch geraume Zeit nach der Messeveranstaltung profitieren sie von den Ergebnis-sen ihrer Berichterstattungen, weil sie ebenso auf geknüpfte Kontakte zurückgreifen können.
[...]
1 www.ihk-regensburg.de
2 www.albert-rupprecht.de
3 www.albert-rupprecht.de
4 www.albert-rupprecht.de
5 www.albert-rupprecht.de
6 Becker, Jochen, Marketing-Konzeption, 2001, S. 1
7 Vgl. Pesch, J., Marketing, 2005, S.ß
8 Vgl. Zerres, Ch., Zerres, M. P., Handbuch Marketing-Controlling, 2006, S. 1
9 Vgl. Zerres, Ch., Zerres, M. P., Handbuch Marketing-Controlling, 2006, S. 1
10 Vgl. Zerres, Ch., Zerres, M. P., Handbuch Marketing-Controlling, 2006, S. 2
11 Vgl. Zerres, Ch., Zerres, M. P., Handbuch Marketing-Controlling, 2006, S. 2
12 Vgl. Zerres, Ch., Zerres, M. P., Handbuch Marketing-Controlling, 2006, S. 2
13 Vgl. Zerres, Ch., Zerres, M. P., Handbuch Marketing-Controlling, 2006, S. 2
14 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, Vorwort
15 Becker, Jochen, Marketing-Konzeption, 2001, S. 5
16 Vgl. Pesch, J., Marketing, 2005, S. 80
17 Vgl. Becker, Jochen, Marketing-Konzeption, 2001, S. 822
18 Vgl. Becker, Jochen, Marketing-Konzeption, 2001, S. 822
19 Vgl. Pesch, J., Marketing, 2005, S. ß
20 Vgl. Pesch, J., Marketing, 2005, S. 81
21 Vgl. Becker, Jochen, Marketing-Konzeption, 2001, S. 11
22 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 368
23 Vgl. Kotler, Ph., Bliemel, F., Marketing-Management, 2001, S. 149
24 Quelle: Eigendarstellung
25 Vgl. Meffert, H., Marketing, 2000, S. 741
26 Vgl. Clausen, E., Mehr Erfolg auf Messen, 2000, S. 19
27 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, S. 435
28 Vgl. Arnold, D., Messepraxis, 2008, S. 18
29 Quelle: Eigendarstellung
30 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 367
31 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 367
32 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 367
33 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 368
34 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 368
35 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 368
36 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 369
37 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 53
38 Vgl. Meffert, H., Bruhn, M., Dienstleistungsmarketing, 2006, S. 390
39 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 369
40 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 370
41 Vgl. Berekoven, L., Eckert, W., Ellenrieder, P., Marktforschung, 2004, S. 100
42 Vgl. Homburg, Ch., Krohmer, H., Marketingmanagement, 2003, S. 216
43 Vgl. Kuß, A., Tomczak, T., Marketingplanung, 2002, S. 203
44 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 57
45 Vgl. Schäfer-Mehdi, St., Event-Marketing, 2006, S. 60
46 www.kontaktmessen.de
47 www.jobfair24.de
48 www.kontaktmessen.de
49 Vgl. Schäfer-Mehdi, St., Event-Marketing, 2006, S. 59
50 www.schulferien.org
51 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 56
52 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 56
53 Quelle: Eigendarstellung
54 www.absolventenkongress.de
55 www.absolventenkongress.de
56 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 59
57 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 59
58 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 97
59 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 97
60 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 60
61 Vgl. Fill, Ch., Marketing-Kommunikation, 2001, S. 351
62 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, S. 359
63 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 96
64 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 96
65 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 62
66 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 62
67 Vgl. Holzbauer, U., Jettinger, E., Knauss, B., Eventmanagement, 2003, S. 62
68 www.myjob-owl.de
69 www.handelswissen.de
70 Quelle: Eigendarstellung
71 Quelle: Eigendarstellung
72 Quelle: Eigendarstellung
73 Quelle: Eigendarstellung
74 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, S. 134
75 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, S. 134
76 www.ihk-regensburg.de
77 www.ihk-regensubrg.de
78 www.oberpfalz-plus.de
79 www.oberpfalz-plus.de
80 www.oberpfalz-plus.de
81 www.ihk-regensburg.de
82 www.oberpfalz-plus.de
83 www.bayreuth.ihk.de
84 www.oberfranken.de
85 www.ihk-nuernberg.de
86 www.ihk-nuernberg.de
87 www.ihk-niederbayern.de
88 www.ihk-niederbayern.de
89 Vgl. Diller, H., Marketingplanung, 1998, S. 77
90 www.ihk-regensburg.de
91 www.messen.de
92 www.ihk-regensburg.de
93 www.ihk-regensburg.de
94 www.ihk-regensburg.de
95 www.ihk-regensburg.de
96 www.manager-magazin.de
97 www.manager-magazin.de
98 Vgl. Clausen, E., Mehr Erfolg auf Messen, 2000, S. 19
99 www.iwkoeln.de
100 www.iwkoeln.de
101 www.elektroniknet.de
102 www.monster.de
103 www.iwkoeln.de
104 www.iwkoeln.de
105 www.iwkoeln.de
106 Quelle: www.iwkoeln.de
107 www.auma-messen.de
108 www.auma-messen.de
109 www.t5-futures.de
110 www.impulse.de
111 www.manager-magazin.de
112 www.impulse.de
113 www.auma-messen.de
114 www.manager-magazin.de
115 www.manager-magazin.de
116 www.alma-mater.de
117 www.berufsinfomesse.de
118 www.alma-mater.de
119 www.myjob-owl.de
120 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, S. 139
121 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, S. 140
122 Vgl. Homburg, Ch., Krohmer, H., Marketingmanagement, 2003, S. 365
123 Vgl. Bruhn, M., Kommunikationspolitik, 2007, S. 142
124 Vgl. Homburg, Ch., Krohmer, H., Marketingmanagement, 2003, S. 364
125 Quelle: Eigendarstellung
126 Vgl. Diller, H., Marketingplanung, 1998, S. 78
127 Vgl. Becker, J., Marketingkonzeption, 2002, S. 292
128 Quelle: Eigendarstellung
129 Grimm, C., Kundenbedürfnisse und Kundenorientierung im Messewesen, 2002, S. 1
130 Grimm, C., Kundenbedürfnisse und Kundenorientierung im Messewesen, 2002, S. 1
131 www.oenb.at
132 www.pub.arbeitsagentur.de
133 www.bmbf.de
134 www.bmbf.de
135 www.bmbf.de
136 www.bmbf.de
137 www.bmbf.de
138 www.bmbf.de
139 www.unternehmerinfo.de
140 www.bpb.de
141 www.ihk-regensburg.de
142 www.ihk-regensburg.de
143 www.ihk-regensburg.de
144 www.ihk-regensburg.de
145 www.business-wissen.de
146 www.iwkoeln.de
147 www.sueddeutsche.de
148 www.wirtschaftsblatt.at
149 www.sueddeutsche.de
150 www.iwkoeln.de
151 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 571
152 Vgl. Marquart, Ch., Messe-Manager, 1. Aufl., Verlag avedition, Ludwigsburg, 2000, S. 38
153 Vgl. Kirchgeorg, M., Dornscheidt, W. M., Giese, W., Handbuch Messemanagement, 2003, S. 571
- Quote paper
- Mine Krasniqi (Author), 2009, Entwicklung eines Marketing- und Kommunikationskonzepts zur überregionalen Positionierung und Vermarktung der Firmenmesse "Arbeitsplatz Nordoberpfalz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137312