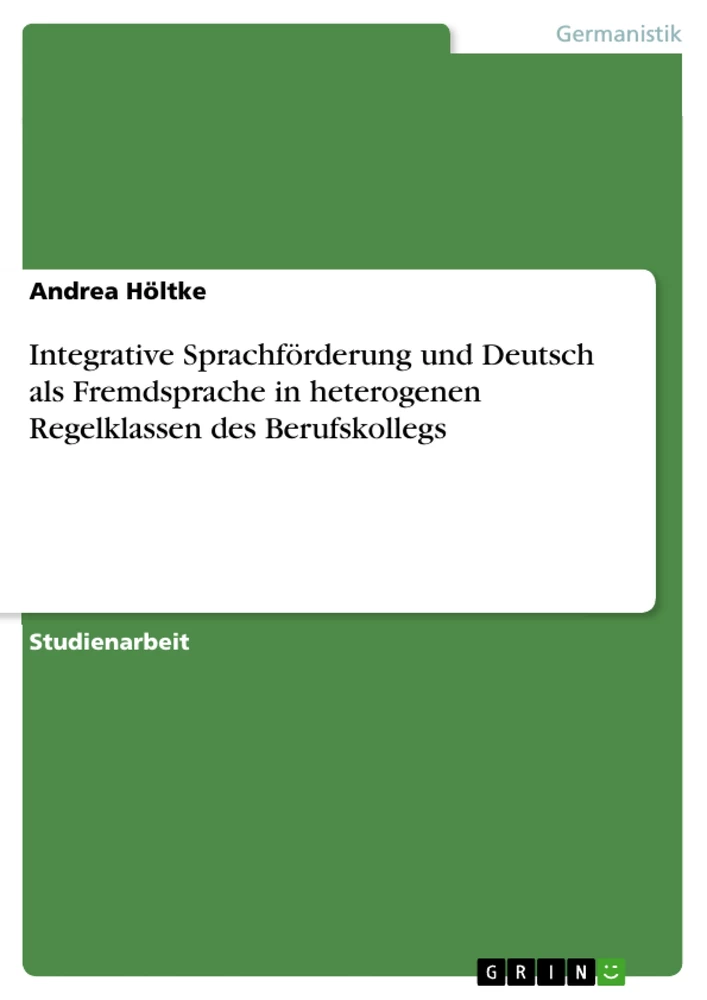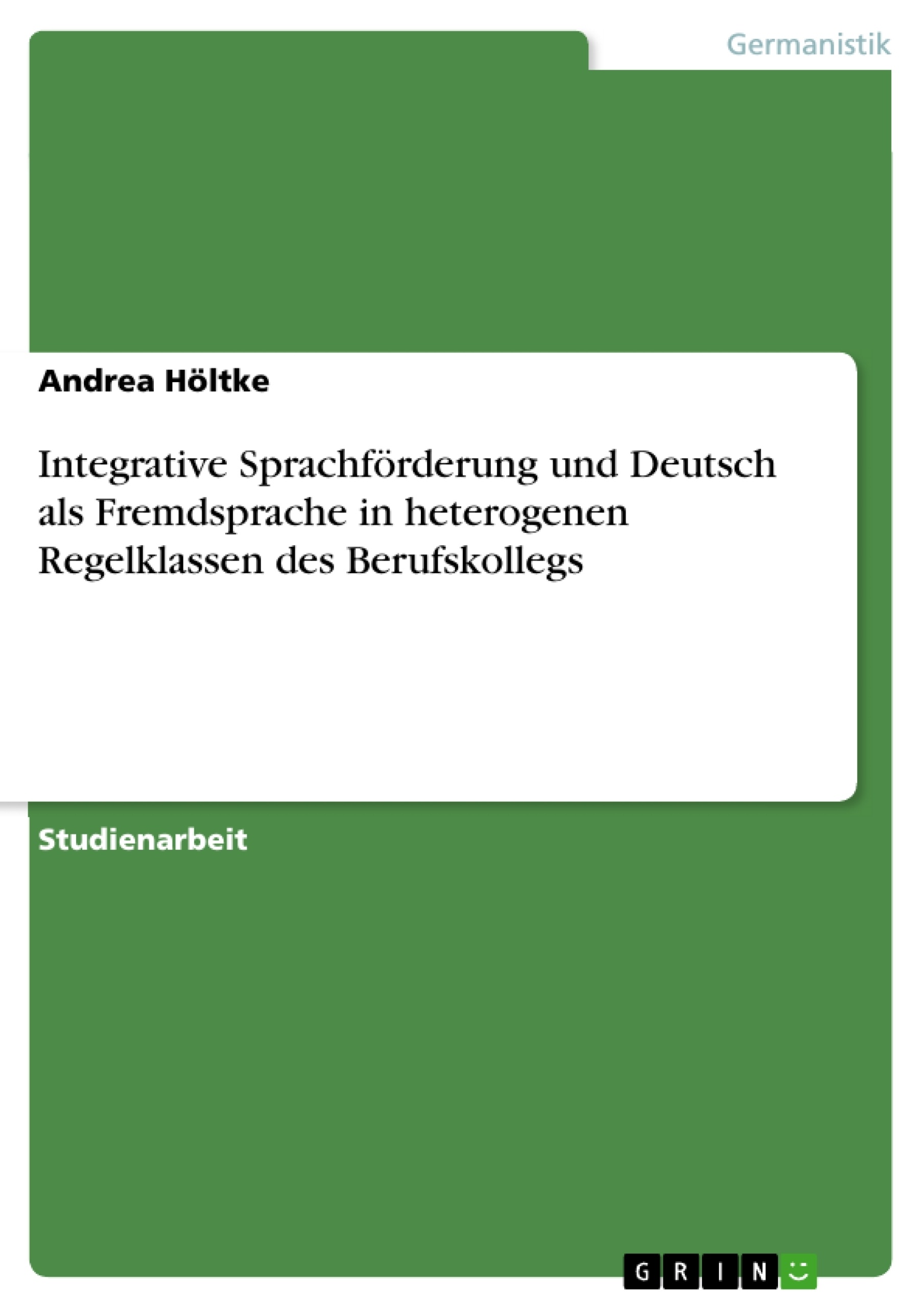Diese Hausarbeit leistet einen Beitrag zur Diskussion um integrative Sprachförderung und Deutsch als Fremdsprache in heterogenen Regelklassen.
Innerhalb der Berufsschule ist es zum einen wichtig, den fachlichen Unterricht weiterzuführen und zum anderen auf die jeweiligen sprachlichen Mängel der unterschiedlichen
Schüler einzugehen. Es kommt immer häufiger vor, dass Deutsch für Schüler eine Fremdsprache ist und dies sollte berücksichtigt und der Umgang mit dieser Problematik verbessert werden. Nicht jeder Schüler hat dieselben Voraussetzungen oder Vorbildungen,
die für einen Beruf notwendig sind und darauf sollte eingegangen werden.
Zunächst geht es um eine Begriffsklärung, bei der die Bezeichnungen „integrative Sprachförderung“ und „Deutsch als Fremdsprache“ definiert werden. Anschließend wird beides in Bezug zum Schulalltag in heterogenen Regelklassen gesetzt. Hierbei soll
herausgefunden werden, wie man mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen innerhalb einer heterogenen Klasse umgehen kann, was verbessert werden kann, welche Maßnahmen,
Materialien und Methoden angewendet werden können. Innerhalb einer heterogenen Klasse befinden sich viele Schülerinnen und Schüler (SuS) unterschiedlichster Herkunft, Umgebung, Leistungsstärken. Es handelt sich um eine ungleiche Verteilung
der Vorbildung und auch sprachlicher Kenntnisse. Unterrichten innerhalb einer heterogenen Klasse ist immer mit besonderer Vorbereitung zu beachten.
Der letzte Abschnitt der Arbeit befasst sich schließlich mit verschiedenen Förderungsprogrammen, wobei zum Teil auch außerschulische Programme vorgestellt werden.
Inhalt
1. EINLEITUNG
1.1 Erläuterung: integrative Sprachförderung
1.2 Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache (DaF bzw. DaZ)
2. INTEGRATIVE SPRACHFÖRDERUNG IN HETEROGENEN REGELKLASSEN
2.1 Problemdarstellung
2.2 Mögliche Ansätze zur Problembehebung
2.2.1 Zusammenarbeit auf allen Ebenen
2.2.2 Vielfältiges Methoden- und Arbeitsrepertoire
3. VERSCHIEDENE FÖRDERUNGSPROGRAMME IM BLICK
3.1 Die Modulare Duale Qualifizierungsmaßnahme (MDQM) als Kontext der Sprachförderung
3.2 Die Mercator Stiftung
3.3 Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund - FörMig
4. FAZIT
5. LITERATURVERZEICHNIS
1. Einleitung
Diese Hausarbeit leistet einen Beitrag zur Diskussion um integrative Sprachförderung und Deutsch als Fremdsprache in heterogenen Regelklassen.
Innerhalb der Berufsschule ist es zum einen wichtig, den fachlichen Unterricht weiter-zuführen und zum anderen auf die jeweiligen sprachlichen Mängel der unterschiedli-chen Schüler einzugehen. Es kommt immer häufiger vor, dass Deutsch für Schüler eine Fremdsprache ist und dies sollte berücksichtigt und der Umgang mit dieser Problematik verbessert werden. Nicht jeder Schüler hat dieselben Voraussetzungen oder Vorbildun-gen, die für einen Beruf notwendig sind und darauf sollte eingegangen werden.
Zunächst geht es um eine Begriffsklärung, bei der die Bezeichnungen „integrative Sprachförderung“ und „Deutsch als Fremdsprache“ definiert werden. Anschließend wird beides in Bezug zum Schulalltag in heterogenen Regelklassen gesetzt. Hierbei soll herausgefunden werden, wie man mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen innerhalb einer heterogenen Klasse umgehen kann, was verbessert werden kann, welche Maß-nahmen, Materialien und Methoden angewendet werden können. Innerhalb einer hete-rogenen Klasse befinden sich viele Schülerinnen und Schüler (SuS) unterschiedlichster Herkunft, Umgebung, Leistungsstärken. Es handelt sich um eine ungleiche Verteilung der Vorbildung und auch sprachlicher Kenntnisse. Unterrichten innerhalb einer hetero-genen Klasse ist immer mit besonderer Vorbereitung zu beachten.
Der letzte Abschnitt der Arbeit befasst sich schließlich mit verschiedenen Förderungs-programmen, wobei zum Teil auch außerschulische Programme vorgestellt werden.
1.1 Erläuterung: integrative Sprachförderung
Es gibt vor allem im Kindes- und Jugendalter Personen, die Sprachprobleme und Kom-munikationsprobleme aufweisen.1 Aber nicht nur dort, sondern auch im Erwachsenenal-ter; besonders dann, wenn in der Schule keine Förderung stattgefunden hat. All diese SuS oder Azubis haben den Anspruch und das Recht auf eine auf sie abgestimmte, un-entgeltliche Förderung und Unterstützung innerhalb der Schule. Um eine ernsthafte Hil-fe anbieten zu können, wird ein in diesem Bereich speziell ausgebildetes Personal benö-tig, wie z.B. Sprachpädagogen oder Sprachtherapeuten.
Dass Sprachstörungen oder Kommunikationsprobleme vorliegen, ist seit vielen Jahren bekannt.2 In den letzten Jahren ist eine Entwicklung zu einer vermehrt integrativen Sprachförderung zu beobachten, was unter Umständen verschiedene Probleme mit sich bringt. Beispielsweise wäre es schwieriger eine Sprachpädagogin zusätzlich zum eigent-lichen fachlichen Unterricht einer heterogenen Regelklasse einzustellen. Bei der integra-tiven Förderungen gilt es, noch mehr Wert auf Kompetenz zu legen, im Sinne von „Wissen was zu tun ist“. Durch diese Veränderung, zu einem mehr integrativen Sprach-förderunterricht zu Beginn der 90er Jahre, ändern sich auch die jetzigen Aufgaben für die die Sprachtherapeuten derzeit zuständig sind.
Wenn also durch eine solche Entwicklung innerhalb der Bildungspolitik eine integrative Pädagogik gefordert ist, müssen sich auch Sprachpädagogen daran orientieren und nach diesem Konzept arbeiten. 3 Eine solche Entwicklung gab es nach Lütje-Klose zwar schon in den 70er Jahren, zu der Zeit hat es die Sprachpädagogen allerdings nicht be-troffen; sie blieben außen vor. Nachdem nun auch Sprachpädagogen aufgefordert sind, sich an integrativer Pädagogik zu beteiligen, wird deutlich, dass es dort Interdifferenzen gibt. Vielen sind sich unsicher, ob sich dadurch nicht die eigentliche Arbeit zum schlechten verändern würde und Lütje-Klose spricht (in Anlehnung an Ahrenberg, Schuck und Welling) von „Deprofessionalisierung und Enttherapeutisierung“. Sie den-ken, dass auf Dauer der Einsatz von Sprachtherapeuten nicht mehr genutzt wird.
1.2 Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache (DaF bzw. DaZ)
Schüler und Schülerinnen (SuS) lernen in der heutigen Zeit schon in der Grundschule Englisch; für die meisten in Deutschland eine Fremdsprache. Da auch hier nicht nur Personen leben, deren Muttersprache Deutsch ist, gibt es auch ein Unterrichtsfach (und Studiengänge), das Deutsch als Fremdsprache (DaF) heißt.4 DaF wird von denjenigen erlernt, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Zu unterscheiden ist DaF allerdings von Deutsch als Zweisprache (DaZ). Für Personen, die in Deutschland leben und aufge-wachsen sind, von jungen Jahren an Deutsch sprechen und schreiben, aber innerhalb ihres Elternhauses oder der familiären Umgebung zeitgleich mit einer zweiten Sprache konfrontiert werden, gilt Deutsch nicht als eine Fremdsprache. In diesem Zusammen-hang spricht man von Deutsch als Zweitsprache. Beide Sprachen werden mehr oder weniger fließend gesprochen und verstanden, weil die Betroffenen es nicht anders ge-lernt haben, als mit zwei (oder mehr) Sprachen aufzuwachsen. Allerdings kann es auch bei Lernen von DaZ zu grammatikalischen Lücken kommen. Diese werden dann im Fach DaZ aufgebessert.
Innerhalb der Arbeit am Berufskolleg kommt es also meist zu einer Vermischung der Anwendungen DaF und DaZ. Man muss vor allem in heterogenen Regelklassen wissen, wie damit umzugehen ist. Bisher gibt es leider kaum bis gar keine Lehrwerke für DaZ, was viele Lehrer bemängeln und weswegen es umso wichtiger ist, einige Problemstellen lösen zu können. Außerdem sollte und wird an solchen Lehrwerken gearbeitet werden.5
2. Integrative Sprachförderung in heterogenen Regelklassen
2.1 Problemdarstellung
Die Sprache ist eines der wichtigsten Mittel, die man in seinem Leben benötigt.6 Kom-munikation ist nicht nur im Freundeskreis wichtig, sondern insbesondere auch für die berufliche Zukunft. Schüler und Schülerinnen (SuS) müssen lernen, sich ausdrücken zu können. Ob es ihnen daran fehlt, die deutsche Sprache korrekt zu gebrauchen, oder, ob ihnen Fachbegriffe der unterschiedlichen Berufsgruppen fehlen: Das Ziel der erfolgrei-chen Sprachförderung sollte auch an Berufskollegs und somit auch in heterogenen Re-gelklassen nie außer Acht gelassen werden; allerdings handelt es sich bei der Sprach-förderung auch gleichzeitig um Schulabschlüsse. Diese bilden wichtige Voraussetzun-gen für den weiteren Lebensweg in der wirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft der Jugendlichen. Seit sich viele handwerkliche Berufe in einer so genannten Umstrukturie-rung befinden und die Ausbildung, sowie der spätere Beruf mehr und mehr zu einer ‚Kopfarbeit’ (man spricht auch von ‚Verkopfung der Berufe’) statt zu einem Handwerk wird (Vgl. kfz-Mechaniker mit kfz-Mechatroniker), nimmt auch die Bedingung zu, dass SuS einen kompetenten Wortschatz kennen. Abgesehen von einem großen, fundamenta-len Wortschatz müssen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen, wie sie die-sen in allen Lebens- und Berufslagen in Wort und Schrift einsetzen können.
Ein weiterer Punkt innerhalb der Förderungen der Jugendlichen in heterogenen Rege-klassen wird deutlich, wenn man die letzten internationalen und nationalen Leistungs-studien im Vergleich sieht (PISA 2000, PISA 2003). Dabei fallen nicht nur bei deut-schen SuS Leistungsdefizite auf, sondern auch Sprachdefizite und somit fehlendes Ver-ständnis bei SuS nichtdeutscher Herkunft. Folglich ist zu erkennen, dass ein großer Teil der Jugendlichen eine Sprachförderung dringend nötig hat.
Auch wenn die SuS die deutsche Sprache soweit beherrschen, dass sie sich ausdrücken können und in der Lage sind, z.B – mit Hilfe – ein Bewerbungsschreiben anzufertigen, sagt dies nichts über die Fähigkeit ihres Verstehenshorizontes beim Lesen von zu erle-digenden Aufgaben aus. Aus den Studien geht auch hervor, dass ein „Zusammenhang zwischen Sprachkompetenzen einerseits und mathematischer und naturwissenschaftli-cher Grundbildung andererseits [die Notwendigkeit] an Sprachförderung bei einem Großteil der Jugendlichen deutlich [macht].“7 Das Problem geht soweit, dass durch mangelnde Sprachkompetenz den SuS ein Abschluss verwährt bleiben kann und somit die Zahl der Jugendlichen ohne Ausbildung stetig wächst.8 Hinzu kommt der eben er-wähnte Anstieg an Ausbildungsplätzen, die ein hohes Niveau anstreben und am liebsten nur noch Abiturienten einstellen würden. In Zusammenhang mit den „doppelten Abitu-rientenzahlen“, die aufgrund der Verkürzung der Schulzeit im Jahre 2012/13 auf NRW zukommen, wird die Aussicht für Jugendliche ohne Ausbildung nicht positiver.
Eine große Schwierigkeit, die Förderung der Sprache betreffend, ist darin zu sehen, dass man sich mit jedem Einzelnen befassen muss, um herauszufinden, wo seine Stärken, bzw. Schwächen liegen. Besonders in heterogenen Klassen bedarf dieses Phänomen einer zu verwirklichenden Lösung. SuS haben unterschiedliche Hintergründe in allen Lebenslagen und so auch in ihrem Erwerb der Sprache. Als Lehrer kann man nicht pau-schal zwischen z. B. SuS mit deutscher Herkunft und denen mit Migrationshintergrund unterscheiden. Selbst bei SuS mit Migrationshintergrund, bei denen evtl. vorurteilshaft angenommen wird, dass ihr Deutsch nicht gut ist und es deshalb gefördert werden muss, gibt es gravierende Unterschiede. Zum Beispiel gibt es SuS, die seit ihrer Geburt mit zwei Sprachen aufgewachsen sind, weil ihre Eltern unterschiedlicher Herkunft sind.9Im besten Fall ist ein Elternteil deutscher und das andere Elternteil anderer Herkunft. Durch die Kombination von Bezugsperson und Sprache erlernen diese SuS – bei ungestörtem Aufwachsen – simultan zwei Sprachen. Aus diesem Grund spricht man hier von einem „Simultanen Sprachgebrauch“10 Der Vorteil besteht darin, dass der Spracherwerb sehr gleichmäßig abläuft und beide Sprachen zu gleichen Teilen erlernt und beherrscht wer-den. Wie aber die oben genannten Studien gezeigt haben, kann es auch hier im späteren Leben, z. B. kurz vor dem Erlernen eines Berufes, noch zu Unverständnissen kommen, auf die innerhalb des Unterrichtes eingegangen werden muss.
Eine weitere Möglichkeit des Spracherwerbs ist der „Sukzessive Spracherwerb“11. Bei dieser Art erlernt das Kind zunächst die Sprache, die innerhalb der Familie gesprochen wird und erst wenn es z. B. in den Kindergarten kommt, wird es mit einer zweiten Spra-che – in unserem Falle deutsch – konfrontiert. Das hat zur Folge, dass das Kind die erste Sprache noch nicht fließend beherrschen kann und zudem nun noch eine Weitere hinzu-kommt. Aus diesem Grund ist es für das Kind und den späteren Jugendlichen nicht ein-fach, die eigentliche Hauptsprache (deutsch) korrekt zu erlernen. Wenn SuS ihre deut- sche Sprache erst sehr spät im Kindesalter erlernt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwann mit monolingual aufgewachsenen Sprechern der deutschen Sprache vergleichen können – und dabei gut abschneiden – so gut wie unmöglich.
[...]
1 Vgl. hierzu u. z. Folgenden Lütje-Klose, 15.
2 Vgl. Ebd., 16.
3 Vgl. Ebd 17f.
4 Vgl hierzu u. a Sitzung vom 2.12.2008 HS WiPäd Lehren und Lernen und Wikipedia.
5 Vgl. Kaminski/ Müller, 1.
6 Vgl. hierzu u. z. Folgenden Badel, 1f.
7 Ebd., 2.
8 Vgl. Ebd., 3.
9 Vgl. hierzu u. z. Folgenden Wiedenmann, 39f.
10 Ebd., 39.
11 Ebd., 40.
- Quote paper
- Andrea Höltke (Author), 2009, Integrative Sprachförderung und Deutsch als Fremdsprache in heterogenen Regelklassen des Berufskollegs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137268