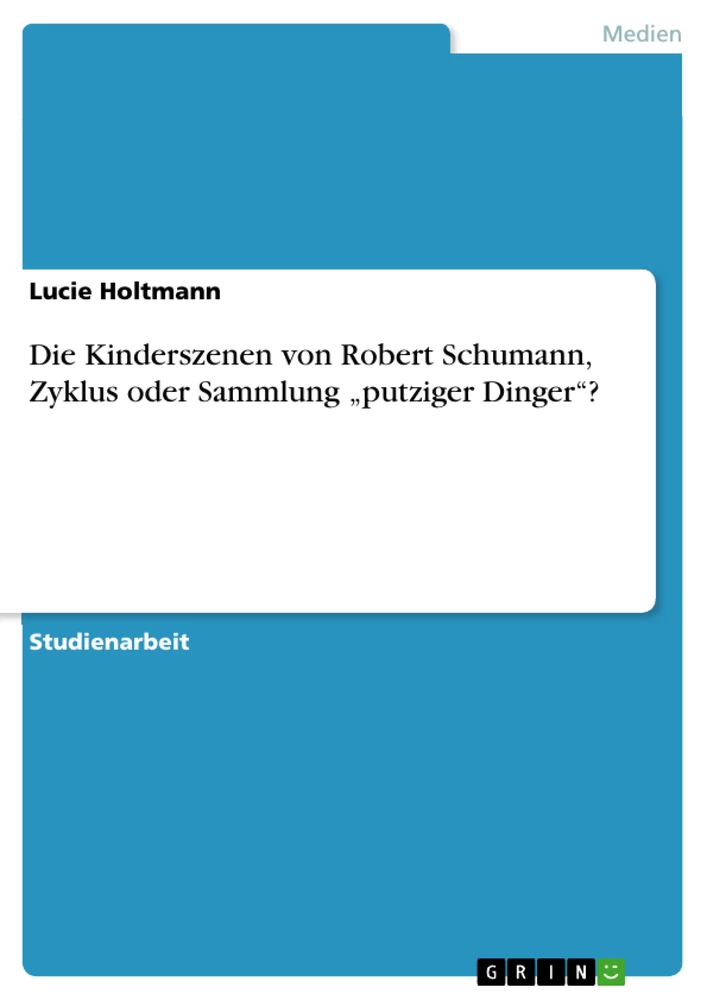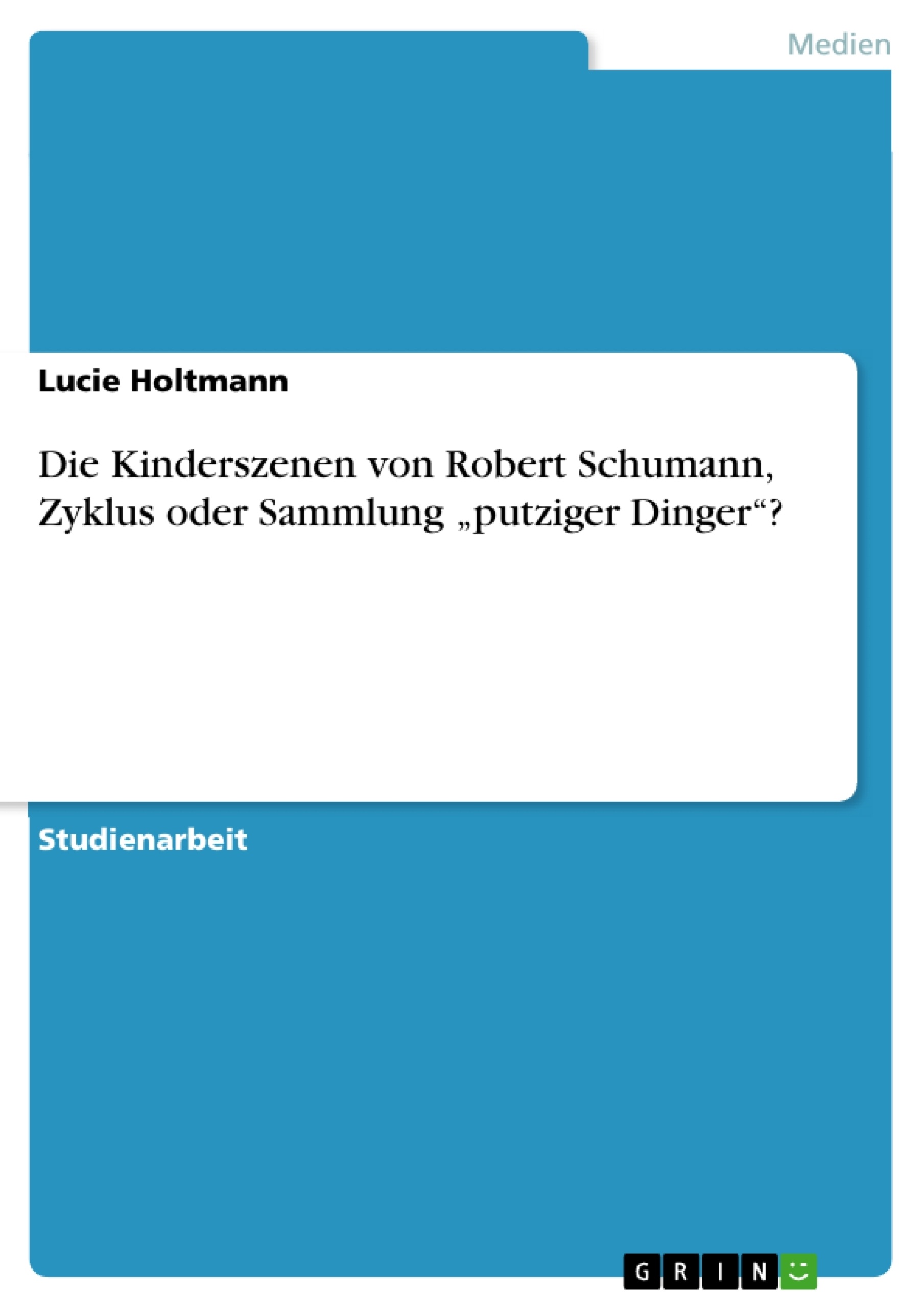Diese Hausarbeit widmet sich der Entstehung der Kinderszenen und der Fragestellung, ob die Zusammenstellung der 13 Kinderszenen im Gesamtbild einen zyklischen Charakter aufweisen, und woran sich dieser, wenn vorhanden, festmachen ließe.
Vorab möchte ich kurz auf den Kompositionsstil des Robert Schumann und dessen, in unterschiedliche Schaffensperioden eingebettetes kompositorisches Werk eingehen, nicht zuletzt, da es mir dieser Einstieg ermöglicht, die Kinderszenen vor dem Hintergrund des Gesamtkontextes des musikalischen Werks Schumanns zu betrachten.
Um meiner Leitfrage auf dem Grund zu gehen, werde ich mich zunächst mit der Entstehung der Kinderszenen auseinandersetzen, soweit es die Tagebucheinträge Schumanns und der Briefwechsel zwischen Robert und Clara Schumann heute noch ermöglichen und soweit gegenwärtige Sekundärliteratur die genannte Fragestellung aufbereitet.
Im Anschluss wende ich mich dem Terminus Zyklus im musikalischen Sinne zu, ich möchte den Begriff und dessen Qualitätskriterien genauer fokussieren, um anschließend eine Überprüfung vorzunehmen, ob Schumanns Kinderszenen mit den Qualitätskriterien des Zyklusgedankens übereinstimmen. Vor diesem Hintergrund gilt es zu untersuchen, ob auf musikalischer und epischer Ebene ein inhaltlicher Zusammenhang innerhalb der Kinderszenen auszumachen ist. Abschließend arbeite ich exemplarisch anhand einer kleineren Auswahl von Kinderszenen die kompositorischen Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten der einzelnen Stücke heraus und überprüfe, ob sie mit dem Zyklusgedanken vereinbar sind.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Robert Schumanns besonderer Kompositionsstil und Schwerpunkte seines Schaffens
- Der junge Komponist Robert Schumann
- Motivation zur Komposition der Kinderszenen
- Zyklus oder Sammlung von Albumblättern?
- Sinnkonstitutive Elemente: Die musikalischen Bezüge der Kinderszenen untereinander und werkübergreifende Bezüge
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung von Robert Schumanns Kinderszenen und analysiert, ob die 13 Charakterstücke einen zyklischen Aufbau besitzen. Die Arbeit beleuchtet Schumanns Kompositionsstil im Kontext seines Gesamtwerks und untersucht die Kinderszenen hinsichtlich ihrer musikalischen und epischen Zusammenhänge.
- Schumanns Kompositionsstil und seine Entwicklung
- Die Entstehungsgeschichte der Kinderszenen
- Der Begriff "Zyklus" in der Musik und seine Kriterien
- Analyse der musikalischen Bezüge innerhalb der Kinderszenen
- Zusammenhang zwischen biografischen Aspekten und musikalischem Ausdruck
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Diese Einleitung erläutert die Forschungsfrage der Arbeit: die Untersuchung des zyklischen Charakters von Schumanns Kinderszenen. Sie kündigt den methodischen Ansatz an, der sowohl Schumanns Kompositionsstil als auch die Entstehungsgeschichte der Kinderszenen berücksichtigt, um die zentrale Frage zu beantworten.
Robert Schumanns besonderer Kompositionsstil und Schwerpunkte seines Schaffens: Dieses Kapitel charakterisiert Schumanns Kompositionsstil als eine sensible Balance zwischen traditioneller Kontrapunkttechnik und innovativer harmonischer Gestaltung. Es verortet die Kinderszenen innerhalb seines Œuvres, das von frühen Klavierwerken bis hin zu großen Vokal- und Bühnenwerken reicht, und hebt die Bedeutung der kurzen Charakterstücke hervor.
Der junge Komponist Robert Schumann: Dieses Kapitel untersucht den biographischen Hintergrund des jungen Schumann, insbesondere seine sozialen Beziehungen und die Unsicherheiten, die sein Leben zu dieser Zeit prägten. Es wird der Einfluss dieser Umstände auf sein künstlerisches Schaffen, einschließlich der Entstehung der Kinderszenen, beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Beziehung zu Clara Wieck und dem Einfluss des Vaters auf diese Beziehung.
Motivation zur Komposition der Kinderszenen: [Der Text liefert keine Informationen zu diesem Kapitel. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.]
Zyklus oder Sammlung von Albumblättern?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Zyklus" im musikalischen Kontext und legt die Kriterien fest, anhand derer die Kinderszenen auf ihre zyklische Struktur hin untersucht werden. Es bereitet den Weg für die folgende Analyse der musikalischen und epischen Zusammenhänge innerhalb des Werkes.
Sinnkonstitutive Elemente: Die musikalischen Bezüge der Kinderszenen untereinander und werkübergreifende Bezüge: Dieses Kapitel analysiert die Kinderszenen auf musikalische und epische Zusammenhänge. Es wird exemplarisch an ausgewählten Stücken gezeigt, wie kompositorische Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten den Zyklusgedanken unterstützen oder widerlegen könnten.
Schlüsselwörter
Robert Schumann, Kinderszenen, Zyklus, Charakterstück, Romantik, Kompositionsstil, biografischer Kontext, musikalische Analyse, Klaviermusik.
Häufig gestellte Fragen zu: Robert Schumanns Kinderszenen - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung von Robert Schumanns Kinderszenen und analysiert, ob die 13 Charakterstücke einen zyklischen Aufbau besitzen. Die Analyse beleuchtet Schumanns Kompositionsstil im Kontext seines Gesamtwerks und untersucht die Kinderszenen hinsichtlich ihrer musikalischen und epischen Zusammenhänge. Die zentrale Forschungsfrage ist somit die Klärung des zyklischen Charakters der Kinderszenen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Schumanns Kompositionsstil und seine Entwicklung, die Entstehungsgeschichte der Kinderszenen, den Begriff "Zyklus" in der Musik und seine Kriterien, die Analyse der musikalischen Bezüge innerhalb der Kinderszenen und den Zusammenhang zwischen biografischen Aspekten und musikalischem Ausdruck. Dabei wird insbesondere die Beziehung Schumanns zu Clara Wieck und der Einfluss ihres Vaters thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Robert Schumanns besonderer Kompositionsstil und Schwerpunkte seines Schaffens, Der junge Komponist Robert Schumann, Motivation zur Komposition der Kinderszenen, Zyklus oder Sammlung von Albumblättern?, Sinnkonstitutive Elemente: Die musikalischen Bezüge der Kinderszenen untereinander und werkübergreifende Bezüge, und Fazit.
Wie wird der Kompositionsstil Schumanns beschrieben?
Schumanns Kompositionsstil wird als sensible Balance zwischen traditioneller Kontrapunkttechnik und innovativer harmonischer Gestaltung charakterisiert. Die Arbeit verortet die Kinderszenen innerhalb seines Gesamtwerks und hebt die Bedeutung der kurzen Charakterstücke hervor.
Wie wird der biographische Kontext berücksichtigt?
Der biographische Kontext, insbesondere die sozialen Beziehungen und Unsicherheiten im Leben des jungen Schumann, wird untersucht, um den Einfluss dieser Umstände auf sein künstlerisches Schaffen und die Entstehung der Kinderszenen zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der Beziehung zu Clara Wieck und dem Einfluss ihres Vaters.
Was ist die zentrale Forschungsfrage bezüglich der Kinderszenen?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob die Kinderszenen einen zyklischen Aufbau besitzen. Die Arbeit untersucht dies anhand einer Definition des Begriffs "Zyklus" im musikalischen Kontext und analysiert die musikalischen und epischen Zusammenhänge innerhalb des Werks.
Welche Methode wird zur Analyse verwendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Vorgehensweise, die sowohl Schumanns Kompositionsstil als auch die Entstehungsgeschichte der Kinderszenen berücksichtigt, um die zentrale Frage nach dem zyklischen Charakter der Kinderszenen zu beantworten. Die Analyse fokussiert sich auf die musikalischen Bezüge innerhalb der einzelnen Stücke und deren mögliche thematische Verbindungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Robert Schumann, Kinderszenen, Zyklus, Charakterstück, Romantik, Kompositionsstil, biografischer Kontext, musikalische Analyse, Klaviermusik.
Welche Informationen fehlen in der Zusammenfassung?
Die Zusammenfassung enthält keine Informationen zum Kapitel "Motivation zur Komposition der Kinderszenen". Eine Zusammenfassung dieses Kapitels ist daher nicht möglich.
- Quote paper
- Lucie Holtmann (Author), 2009, Die Kinderszenen von Robert Schumann, Zyklus oder Sammlung „putziger Dinger“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137227