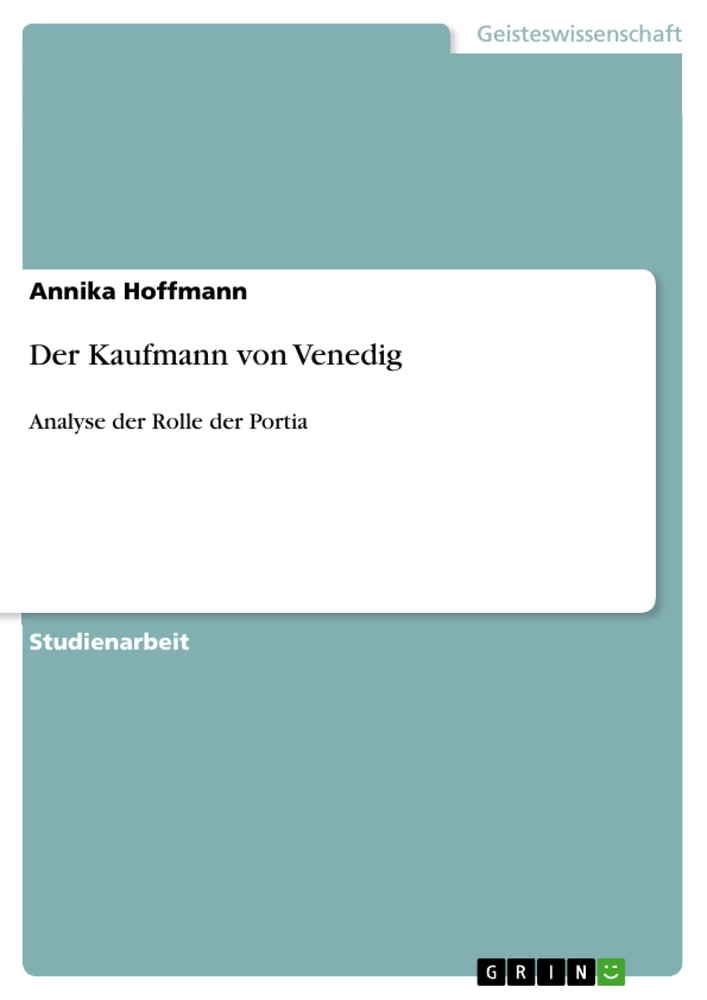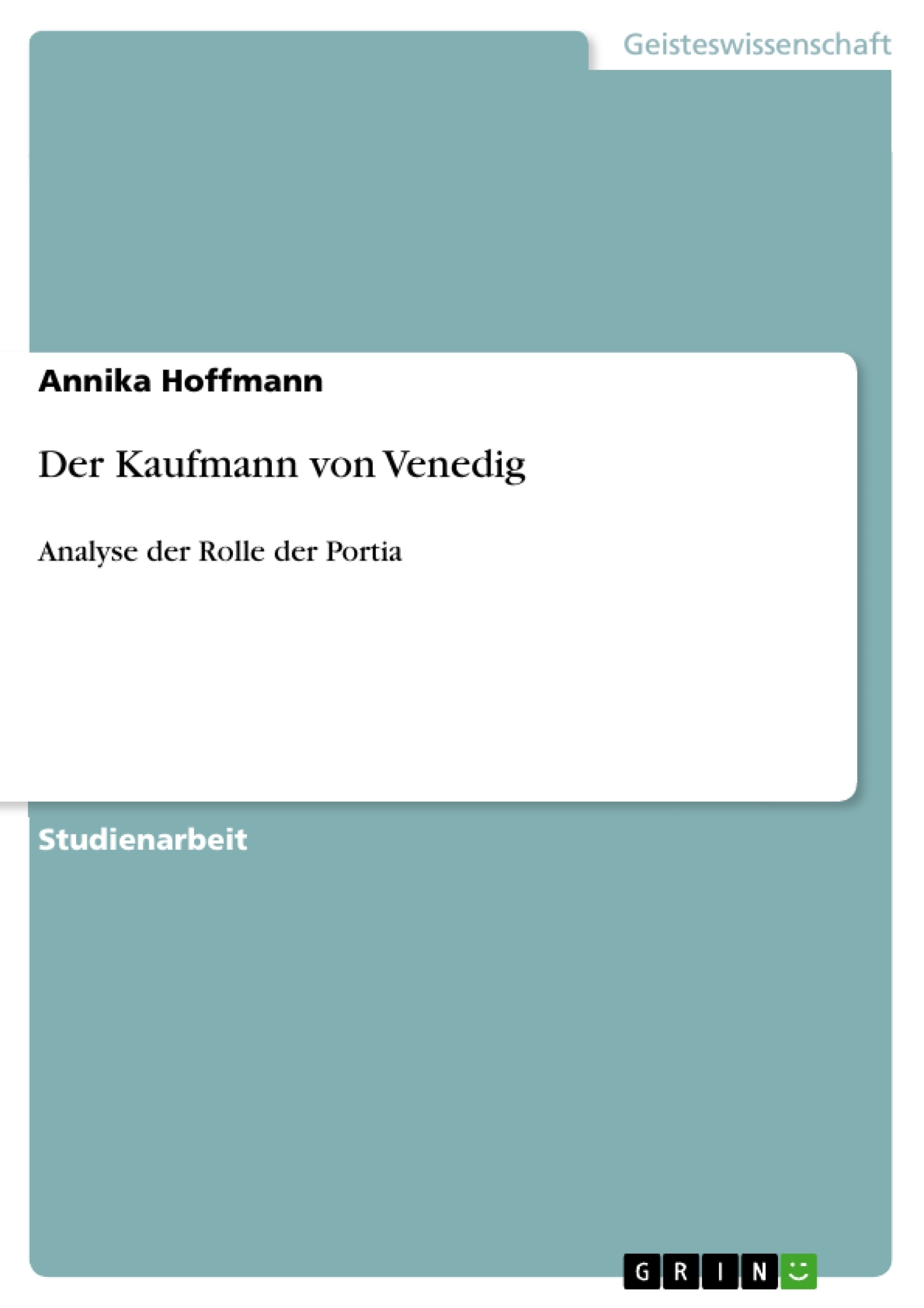Wenn heute Shakespeare’s „Kaufmann von Venedig“ aufgeführt wird, erregt die Figur des Juden Shylock in der Regel die größte Aufmerksamkeit und spaltet sowohl die Meinungen der Zuschauer, als auch die der Regisseure und Schauspieler. Viele haben gerade in Deutschland immer noch Schwierigkeiten im Umgang mit der Tatsache, dass in diesem Stück ein Jude von seinen christlichen Mitbürgern auf Grund seiner Religion verachtet und gedemütigt wird, und zusätzlich auch noch als unsympathisch dargestellt wird.
Die Schwierigkeit der Interpretation der Figur Shylock ist zwar interessant, doch ist eine andere Figur in William Shakespeare’s Stück noch viel spannender zu betrachten: Die reiche Erbin Portia.
Shakespeare lässt diese Frau intelligenter auftreten als seine männlichen Charaktere, und bewahrt durch sie und ihre Klugheit den Kaufmann Antonio in letzter Sekunde davor, dass Shylock ihm ein Stück Fleisch aus dem Körper schneidet. Ohne Portia wäre die Komödie zur Tragödie geworden.
Aus diesem Grund soll die Rolle der Portia in dieser Arbeit genauer betrachtet und analysiert werden. Was zeichnet sie aus? Wie wird sie dargestellt? Wie ist ihr Charakter?
Auch soll ihr Umfeld und ihr Stand in der Gesellschaft beleuchtet werden.
Dazu wird hauptsächlich die Inszenierung des Kaufmanns von Venedig im Kölner Schauspielhaus des Regisseurs Michael Talke herangezogen und mit anderen Inszenierungen - wie zum Beispiel der von Peter Zadek aus dem Jahr 1988 am Wiener Burgtheater – verglichen.
Des Weiteren lohnt sich in diesem Zusammenhang eine nähere Betrachtung der gesellschaftlichen Position der Frau zu Shakespeare’s Lebzeiten. Portia wird als moderne, unabhängige Frau gezeigt, die sich nicht still ihrem Schicksal fügt, sondern eine eigene Meinung hat und diese auch kundtut. Doch im Elisabethanischen Zeitalter war die Rolle der Frau genau gegenteilig definiert. Warum gab Shakespeare also einer Frau eine so bedeutende Rolle?
Diese und weitere Aspekte werden im Folgenden beschrieben, analysiert und interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Frauenwelt im Elisabethanischen Zeitalter
2.1 Die gesellschaftliche Position der Frau
2.2 Männertheater
3. Der Kaufmann von Venedig
3.1 Inhalt
3.2 Die Figur Portia
4. Die Inszenierung in Köln 2005
4.1 Die Darstellung der Portia bei Talke
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1) Monographien
2) Sammelbände
3) Internetseiten
4) Theaterstücke
1. Einleitung
Wenn heute Shakespeare’s „Kaufmann von Venedig“ aufgeführt wird, erregt die Figur des Juden Shylock in der Regel die größte Aufmerksamkeit und spaltet sowohl die Meinungen der Zuschauer, als auch die der Regisseure und Schauspieler. Viele haben gerade in Deutschland immer noch Schwierigkeiten im Umgang mit der Tatsache, dass in diesem Stück ein Jude von seinen christlichen Mitbürgern auf Grund seiner Religion verachtet und gedemütigt wird, und zusätzlich auch noch als unsympathisch dargestellt wird.
Die Schwierigkeit der Interpretation der Figur Shylock ist zwar interessant, doch ist eine andere Figur in William Shakespeare’s Stück noch viel spannender zu betrachten: Die reiche Erbin Portia.
Shakespeare lässt diese Frau intelligenter auftreten als seine männlichen Charaktere, und bewahrt durch sie und ihre Klugheit den Kaufmann Antonio in letzter Sekunde davor, dass Shylock ihm ein Stück Fleisch aus dem Körper schneidet. Ohne Portia wäre die Komödie zur Tragödie geworden.
Aus diesem Grund soll die Rolle der Portia in dieser Arbeit genauer betrachtet und analysiert werden. Was zeichnet sie aus? Wie wird sie dargestellt? Wie ist ihr Charakter?
Auch soll ihr Umfeld und ihr Stand in der Gesellschaft beleuchtet werden.
Dazu wird hauptsächlich die Inszenierung des Kaufmanns von Venedig im Kölner Schauspielhaus des Regisseurs Michael Talke[1] herangezogen und mit anderen Inszenierungen - wie zum Beispiel der von Peter Zadek aus dem Jahr 1988 am Wiener Burgtheater[2] – verglichen.
Des Weiteren lohnt sich in diesem Zusammenhang eine nähere Betrachtung der gesellschaftlichen Position der Frau zu Shakespeare’s Lebzeiten. Portia wird als moderne, unabhängige Frau gezeigt, die sich nicht still ihrem Schicksal fügt, sondern eine eigene Meinung hat und diese auch kundtut. Doch im Elisabethanischen Zeitalter war die Rolle der Frau genau gegenteilig definiert. Warum gab Shakespeare also einer Frau eine so bedeutende Rolle?
Diese und weitere Aspekte werden im Folgenden beschrieben, analysiert und interpretiert.
2. Die Frauenwelt im Elisabethanischen Zeitalter
Bei der Analyse der Welt der Frauen in der englischen Renaissance sind zwei Gesichtspunkte besonders zu beachten: Zum einen die Rolle der Frau in der Gesellschaft und zum anderen die Position der Frau im Theater. Darauf wird im Folgenden genauer eingegangen.
2.1 Die gesellschaftliche Position der Frau
Im Elisabethanischen Zeitalter 1558-1603 wurden im Hinblick auf das Bild der unterschiedlichen Geschlechter Theorien aus der Antike wieder aufgenommen. Diese besagten, dass jeder Mensch als weibliches Wesen auf die Welt kommt und erst im Laufe der Entwicklung in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Entweder verläuft die Entwicklung richtig, und der Mensch wird zum Mann, oder er entwickelt sich nicht weiter und bleibt eine Frau.
Männlichkeit wurde als gottgegebenes Glück angesehen, Weiblichkeit hingegen als geschlechtlicher Mangel. Auch war die Meinung verbreitet, dass die weiblichen Geschlechtsorgane nicht etwas Spezifisches, sondern nicht richtig entwickelte, nach innern gekehrte männliche Organe seien. Die Männer galten nach dieser Vorstellung als vollständig entwickelter Mensch, die Frauen jedoch als Mängelwesen.[3]
2.2 Männertheater
Die gesellschaftlichen Vorstellungen über Männer und Frauen beherrschten auch die Theater des Elisabethanischen Zeitalters. Es gab nur männliche Theaterbesitzer und Stückeschreiber, Frauen hatten in dieser Welt keinen Platz. In den Theaterstücken gab es zwar weibliche Rollen, doch wurden diese ausschließlich von Männern gespielt, da auf der Bühne ebenfalls keine Frauen erwünscht waren. Die männlichen Autoren der Theaterstücke schrieben demzufolge fast ausschließlich Theaterstücke mit Männern in den Hauptrollen.[4]
Dies ist auch bei William Shakespeare zu beobachten. Es geht fast immer nur um Männer, Frauen sind entweder gar nicht, oder nur als Nebenfiguren vorgesehen. Allein die Titelauswahl der Shakespeare-Werke verdeutlicht dies.[5]
„Frauen erscheinen nur dann als Mitglieder der Bühnengesellschaft, wenn sie – wie Lady Macbeth und Lady Macduff – für die Durchführung der Handlung benötigt werden. Während die Söhne (und potentielle Nachfolger) meist mit im Spiel sind, bleibt die Position der Ehefrau meist unrealisiert.“[6]
[...]
[1] Der Kaufmann von Venedig, Michael Talke, Schauspielhaus Köln/Deutschland 2005.
[2] Der Kaufmann von Venedig, Peter Zadek, Burgtheater Wien/Österreich 1988.
[3] Vgl. Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Renaissance. Frankfurt/Main 1993, S.112ff.
[4] Vgl. Ina Schabert: Shakespeare-Jahrbuch. Stuttgart 1992, S.466ff.
[5] Vergleiche hierzu eine Auswahl von Shakespeares Werken wie beispielsweise „Hamlet“, „Othello“, „König Lear“ oder „Julius Caesar“.
[6] Ulrich Suerbaum: Shakespeares Dramen. Tübingen 2001. S. 114.
- Citar trabajo
- Annika Hoffmann (Autor), 2007, Der Kaufmann von Venedig, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137217