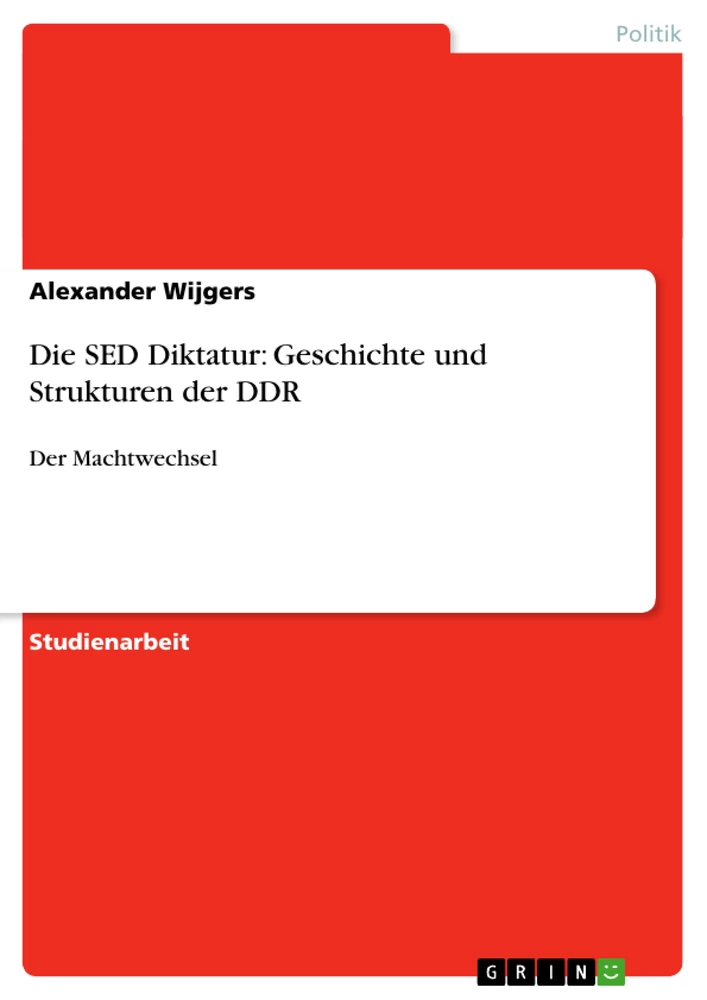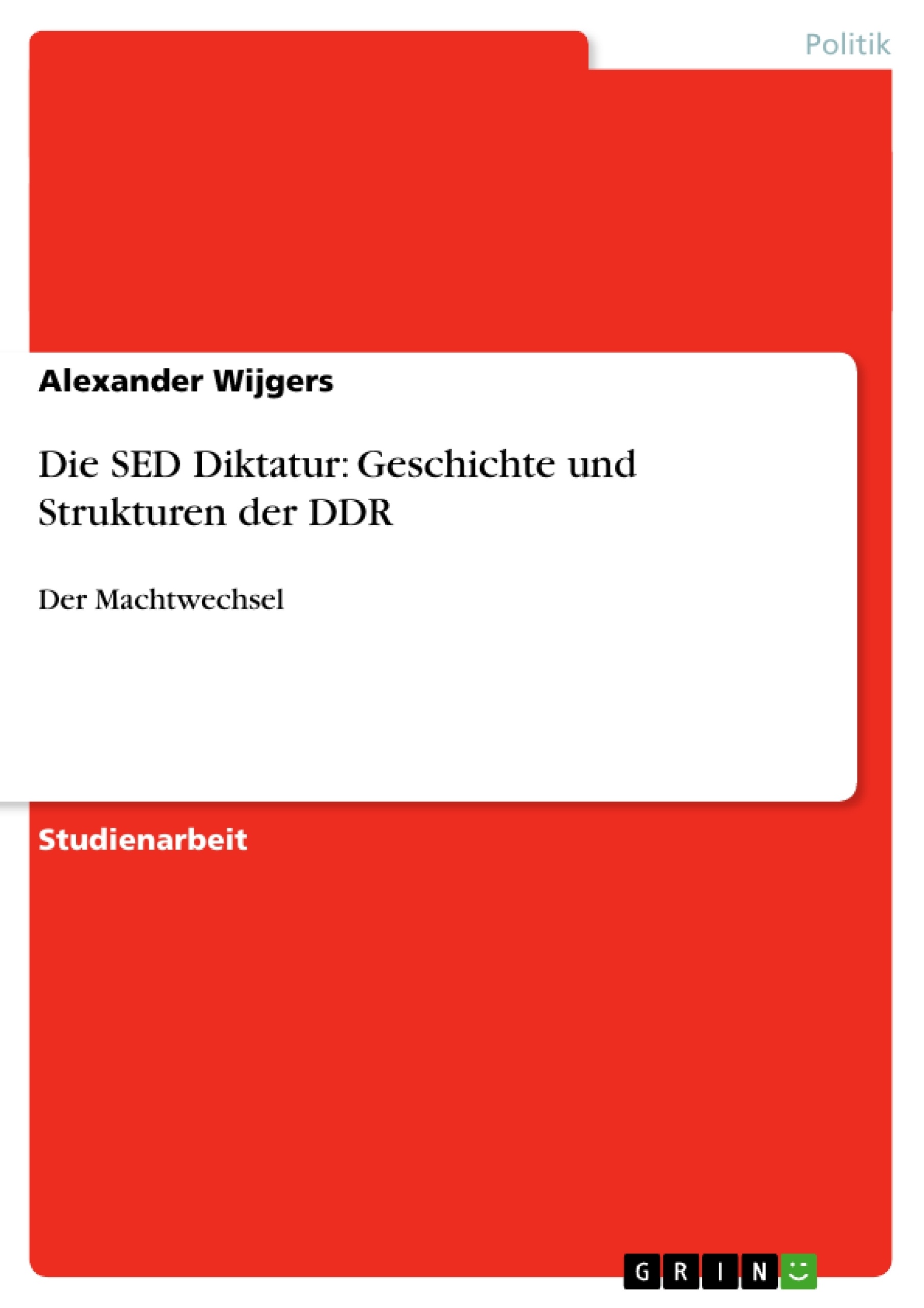„Das Zentralkomitee der SED beschloss einstimmig, der Bitte des Genossen Walter Ulbricht zu entsprechen und ihn aus Altergründen von der Funktion des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees zu entbinden, um diese Funktion in jüngere Hände zu geben. Es beschloss, Genosse Walter Ulbricht in Ehrung seiner Verdienste zum Vorsitzenden der SED zu wählen. Genosse Walter Ulbricht ist weiter als Vorsitzender des Staatrates tätig. Das Zentralkomitee wählte einstimmig Genossen Erich Honecker zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED“
Mit dieser offiziellen Verlautbarung am 3.5.1971 wurde der Wechsel von Ulbricht zu Honecker an der wichtigsten Position des Staates besiegelt. Damit sollte der Anschein kontinuierlicher Kaderpolitik aufrecht gehalten werden, die einen konfliktfreien Übergang suggerierten. Ulbricht war zu diesem Zeitpunkt zwar alt und immer wieder durch seine Gesundheit beeinträchtigt worden, jedoch hatte er vorher nie den Eindruck gemacht, dass er aufhören möchte.
...
Die Akteure schienen schon damals klar. Die Beweggründe zum Wechsel jedoch sind erst in den letzten Jahren mit der Öffnung der Archive in der DDR und teilweise in Russland offenkundig geworden. Die nun vorliegenden Primärquellen geben ein völlig neues Licht auf diese Zeit und vor allem auf die Person Ulbricht, die wenig mit einen Stalinisten gemein hatte, sondern einen Mann zeigt, der sich durchaus reformwillig zeigte und einen großen Teil der Reformen angeschoben hatte. Begründen lässt sich der bisherige schlechte Forschungsstand mit der Ungeliebtheit der 1960er Jahre bei den Historikern in der DDR, wodurch eine Phase vernachlässigt wurde, die für spätere Entwicklung notwendig ist.
Um den Wechsel von Ulbricht zu Honecker zu verstehen, ist es dementsprechend notwendig alle Streitpunkte und ihre Entwicklung aufzuzeigen. Diese Entwicklung setzt bereits Anfang der 1960er Jahre an mit dem von Ulbricht voran getriebenen Wirtschaftswandel und einer allgemeinen Liberalisierung. Zweiter Hauptstreitpunkt war die Deutschlandpolitik. In beiden Punkten herrschte auch mit der Sowjetrepublik öfters Uneinigkeit.
Ziel dieser Arbeit ist es nun die Entwicklung der Streitpunkte, die Beziehung zwischen Ulbricht, Honecker und der Sowjetrepublik, die Darstellung der relevanten Entscheidungsprozesse, sowie den Ablauf der Ereignisse dar zustellen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Machtstrukturen
3. Wirtschaftspolitik
4. Außenpolitik
5. Ulbrichts Ende
6. Fazit
Literatur:
1. Einleitung
„Das Zentralkomitee der SED beschloss einstimmig, der Bitte des Genossen Walter Ulbricht zu entsprechen und ihn aus Altergründen von der Funktion des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees zu entbinden, um diese Funktion in jüngere Hände zu geben. Es beschloss, Genosse Walter Ulbricht in Ehrung seiner Verdienste zum Vorsitzenden der SED zu wählen. Genosse Walter Ulbricht ist weiter als Vorsitzender des Staatrates tätig. Das Zentralkomitee wählte einstimmig Genossen Erich Honecker zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED“
Mit dieser offiziellen Verlautbarung am 3.5.1971 wurde der Wechsel von Ulbricht zu Honecker an der wichtigsten Position des Staates besiegelt. Damit sollte der Anschein kontinuierlicher Kaderpolitik aufrecht gehalten werden, die einen konfliktfreien Übergang suggerierten. Ulbricht war zu diesem Zeitpunkt zwar alt und immer wieder durch seine Gesundheit beeinträchtigt worden, jedoch hatte er vorher nie den Eindruck gemacht, dass er aufhören möchte.
Zur gleichen Zeit herrschte in der DDR ein schlimme Wirtschaftskrise, die Ulbricht stark in Bedrängnis gerieten ließ. Entsprechend wurde vor allem im Westen gemunkelt, dass der scheinbare Stalinist Ulbricht, dessen Bild vor allem in den 1940er und 1950er Jahren das eines engstirnigen Dogmatikers und kalten Kriegers ergab, von den Reformern um Honecker gestürzt wurde. Das fortgeschrittene Alter sowie die Wirtschaftskrise ergaben damit auf den ersten Blick die Gründe für den Wechsel. Wie jedoch KAISER (1997) darstellt, vereinfacht diese Erklärung die Sicht und erfordert entsprechend eine viel frühere Analyse der Umstände. Letztlich zeigt KAISER, dass rein machtpolitische Interessen im Mittelpunkt des Wechsel standen.
Die Akteure schienen schon damals klar. Die Beweggründe zum Wechsel jedoch sind erst in den letzten Jahren mit der Öffnung der Archive in der DDR und teilweise in Russland offenkundig geworden. Die nun vorliegenden Primärquellen geben ein völlig neues Licht auf diese Zeit und vor allem auf die Person Ulbricht, die wenig mit einen Stalinisten gemein hatte, sondern einen Mann zeigt, der sich durchaus reformwillig zeigte und einen großen Teil der Reformen angeschoben hatte. Begründen lässt sich der bisherige schlechte Forschungsstand mit der Ungeliebtheit der 1960er Jahre bei den Historikern in der DDR, wodurch eine Phase vernachlässigt wurde, die für spätere Entwicklung notwendig ist.
Um den Wechsel von Ulbricht zu Honecker zu verstehen, ist es dementsprechend notwendig alle Streitpunkte und ihre Entwicklung aufzuzeigen. Diese Entwicklung setzt bereits Anfang der 1960er Jahre an mit dem von Ulbricht voran getriebenen Wirtschaftswandel und einer allgemeinen Liberalisierung. Zweiter Hauptstreitpunkt war die Deutschlandpolitik. In beiden Punkten herrschte auch mit der Sowjetrepublik öfters Uneinigkeit.
Ziel dieser Arbeit ist es nun die Entwicklung der Streitpunkte, die Beziehung zwischen Ulbricht, Honecker und der Sowjetrepublik, die Darstellung der relevanten Entscheidungsprozesse, sowie den Ablauf der Ereignisse dar zustellen. Da dies in chronologischer Form eher zu Verwirrungen führt, sollen die einzelnen Punkte thematisch aufgearbeitet werden. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Veränderungen der Machtstrukturen durch die Reformen. Kapitel 3 handelt die Wirtschaftspolitik ab und Kapitel 4 die Deutschlandpolitik. Kapitel 5 stellt die letzten Jahre dar. Die Arbeit folgt in großen Teilen der Arbeit von KAISER (1997). Arbeiten mit anderen Schwerpunkte sollen, soweit möglich KAISERs Arbeit belegen, wo bei verwunderlich ist, dass zum Beispiel die Arbeit von HOFFMANN (2003) ein immer noch falsches Bild Ulbricht aufzeigt. Hier wird immer noch das Bild eines Stalinisten geprägt.
2. Machtstrukturen
Jeder Veränderung des Staates bedeutete eine Veränderung in der Partei (KAISER 1997, S.27). Da Ulbricht in vielen Punkten das System der DDR veränderte, machte er sich entsprechend viele Feinde innerhalb der SED die seinem Kurs nicht folgen wollten bzw. Teile ihrer Macht durch Reformen verloren.
Die von Ulbricht eingeführten Machtstrukturen der Sowjetunion führten nicht nur zur Diktatur übers Volk, sondern auch innerhalb der Partei. Ulbricht wusste vor allem Anfang der 1950er Jahre seine Macht auszubauen. So verlagerte er immer mehr Entscheidungen in die Entscheidungsgewalt des Ersten Sekretärs, der er selbst war. Rückendeckung erhielt er dabei von der Militäradministration und der KPdSU. Dieser Kurs war jedoch innerhalb des Politbüros umstritten, weshalb es 1953 bereits Rücktritts Forderungen gab, da sie die Machtfülle Ulbrichts eindämmen wollten. Als einiger der wenigen hielt Honecker vorbehaltlos zu Ulbricht. Einzig weil die Führung des KPdSU eine Stabilisierung der DDR wünschte (Juni Aufstand), konnte sich Ulbricht an der Macht halten (KAISER 1997, S.30f.).
Honecker Loyalität wurde von Ulbricht mit tiefsten Vertrauen belohnt und mit der faktischen Ausübung der Funktion des Ersten Sekretärs. Auch Honecker war Ulbricht zu dank verpflichtet, da dieser ihm bei einigen Verfehlungen beschützte (POETZL 2002, S.65 ff.). In der Abwesenheit Ulbrichts leitet Honecker sogar das Politbüro. Honecker war jedoch jemand der nie durch große eigene Überlegungen auffiel und für seinen „Mentor“ nur ausführte. Dadurch erweckte Honecker den Eindruck eines absoluten loyalen Weggefährten (KAISER 1997, S. 32 f.).
Nach seiner politischen Festigung und dem Mauerbau ging Ulbricht Reformen des Systems an. Er glaubte nach dem Mauerbau könne niemand mehr die SED-Herrschaft stürzen, außer den eigenen Fehlern. Deshalb sollte das Herrschaftssystem zukunftsfest gemacht werden. Alle Hemmnisse die dem Fortschritt entgegenstanden sollte beseitigt werden. Die Veränderungen innerhalb der SED waren für die Wirtschaftsreformen und der begrenzten Liberalisierung notwendig.
Zum einen wurden die parteilichen Führungsgremien geöffnet. Nicht nur Parteimitglieder der SED konnten somit z.B. an der ZK - Tagung teilnehmen. Diese wandelten sich vielmehr in Thementagungen, bei der eine möglichst offene Diskussionsatmosphäre angeregt wurde. Vorbereitet wurden die ZK - Tagungen von Arbeitsgruppen, in denen Spezialisten aus verschiedenen Bereichen sich befanden. Propagandiert wurde dieses System als „Entfaltung der sozialistischen Demokratie“. Ein weiterer Reformpunkt war der Elitenwechsel. War es bisher so, dass vor allem verdiente Kaderleute, die über kein spezifisches Wissen verfügten, beste Chancen auf Arbeitsplätze in Leitungsfunktion hatten, kamen von nun an vermehrt Fachleute und Wissenschaftler zum Zuge. Ulbricht selbst zog ebenfalls den Rat von Wissenschaftler vor und hatte für die Parteiarbeiter meistens nur Verachtung übrig, die er teilweise auch öffentlich tat. Der dritte gravierende Punkt war die Verringerung von Entscheidungen an zentralen Punkten. Das Politbüro sollte nicht mehr alle Einzelentscheidungen vornehmen, sondern nur noch die „Grundfragen der Politik der Partei, Staatsführung und der Volkswirtschaft“ klären. Die Verantwortung wurde verstärkt in spezielle Büros verteilt z.B. dem Büro für Industrie und Bauwesen. KAISER spricht hier bei von einer Dezentralisierung der Macht. Neben der Versachlichung, musste vor allem das Sekretariat der ZK, und damit Honecker, und die Sekretäre der Bezirks- und Kreisleitungen Machteinbußen hinnehmen und bekamen deshalb Angst gänzlich überflüssig zu werden.
Neben den Dezentralisierungstendenzen gab es jedoch auch gleichzeitig eine Stärkung der Macht Ulbrichts. Zum einen nahm er die Rolle des Übervaters ein zum anderen erhöhten sich seine Machtbefugnisse. Die Reformgegner um Honecker sahen die Einheit der Partei in Gefahr und hatten vor allem Angst um ihre eigene Macht. So mit kam es, dass die Reformen in großen Teilen unterlaufen wurden. Dies geschah nicht offen, sondern offiziell zum Nutzen der Reform. Da die ganze Reform ein Experiment war, brauchten die Gegner Ulbricht nur zeigen wie wenig praktisch die Reform war, um einen entgegen gesetzten Kurs einzuschlagen (KAISER 1997, S.46).
Die Rückstände der DDR gegenüber dem Weltniveau wurden auch deshalb an „ideologischen Hemmnissen“ festgemacht. Die bisher verdeckt handelnden Gegner äußerten immer lauter Kritik. Sie warnten vor dem Wandel der SED zu einer reinen Wirtschaftspartei, wobei sie Angst hatten, ihre Macht nicht ohne ideologische Legitimation erhalten zu können. Vermeintliche Mängel in der politisch-ideologischen Arbeit wurden aufgebauscht und als Druckmittel zur Aufwertung der Sekretariate genutzt. Letztendlich wurde der 1959 angefangene Prozess der Reform innerhalb der Administration bis 1965 wieder zum alten hergestellt. Die Politik stand wieder im Mittelpunkt und nicht mehr die Ökonomie. Gleichzeitig schaffte es Honecker sich selbst eine Machtbasis zu schaffen. Ihm hatten es die Regionalen Sekretariate zu verdanken, dass sie ihre Macht wiedererlangten mit dem Argument der Vorteilhaftigkeit von straffer Organisation.
Dieser Prozess hatte zur Folge, dass sich eine Art Doppelherrschaft zwischen Ulbricht und Honecker in der DDR etablierte. Auf der einen Seite war Ulbricht, der sich als Übervater und Bauherr der DDR verstand. Er unterhielt ein eigenes Beraterteam aus Wissenschaftlern und Fachleuten mit denen er die wissenschaftlich-technische Revolution voranbringen wollte und letztendlich die Überlegenheit der DDR gegenüber der Bundesrepublik beweisen wollte. Auf der anderen Seite Honecker, der von Ökonomie zwar wenig Ahnung hatte, dem Ulbricht jedoch die gesamte organisatorische Kleinarbeit überließ, der es jedoch verstand auch aus diesen Nebensächlichkeiten eigene Machtvorteile zu erringen. Zwar musste Ulbricht alle Beschlüsse abzeichnen, doch scheinbar entgingen ihm dort viele Spitzwindigkeiten die Honecker einbaute (KAISER 1997, S.54 ff.).
[...]
- Quote paper
- Alexander Wijgers (Author), 2005, Die SED Diktatur: Geschichte und Strukturen der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137167