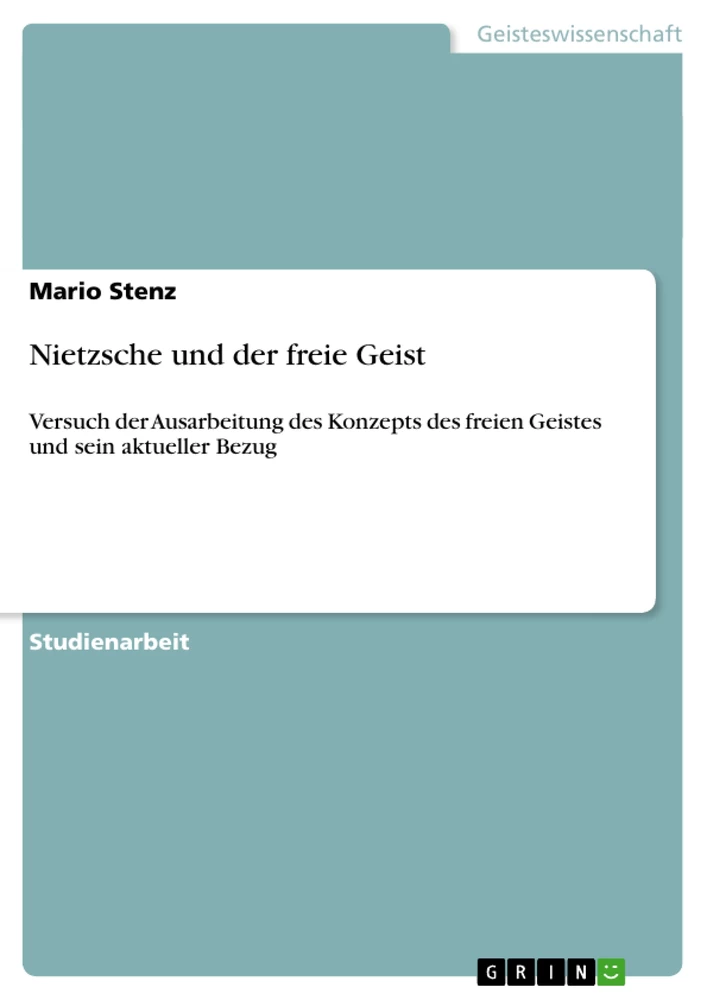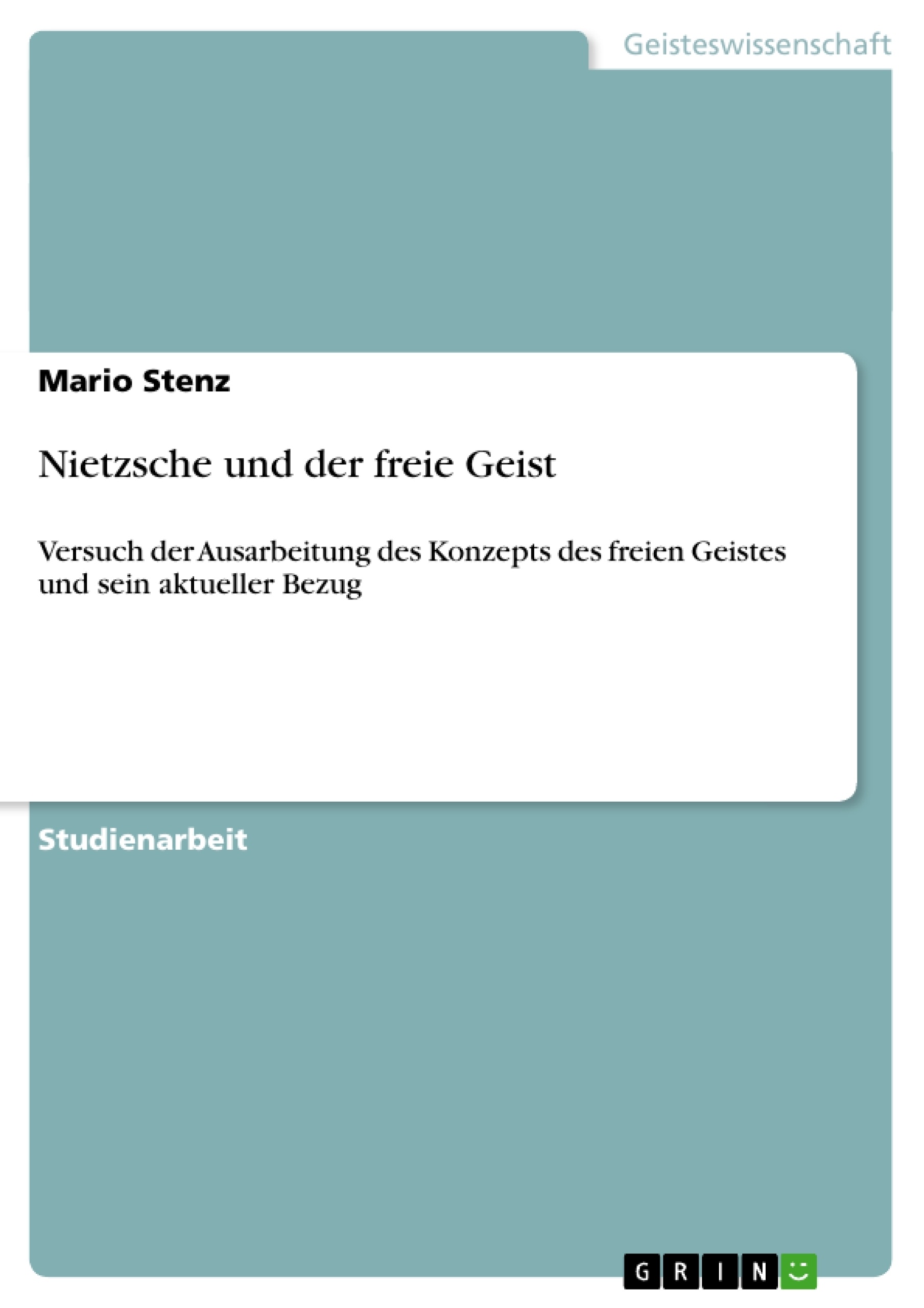Volker Gerhardt, Professor für Philosophie an der Humboldt Universität in Berlin, behauptet, dass das Konzept des "Freien Geistes" das „theoretisches wie praktisches Lebensideal“ (Gebhardt 2000, S. 207) Friedrich Nietzsches darstellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich historisch-systematisch mit dem Zentralbegriff des "Freien Geistes" in Nietzsches Gesamtwerk. Ausgehend von sozialisationstheoretischen Überlegungen des so genannten "gebundenen Geistes" werden Genese und wesentliche Konstitutionsmerkmale des "Freien Geistes" interpretiert, analysiert und auf den Begriff gebracht. Grundlage dafür geben ausgewählte Passagen ab, die sich verstreut im gesamten Textkorpus von Nietzsches Werk, einschließlich Nachlass, finden lassen. Ferner wird versucht einen aktuellen Bezug dieser Konzeption herzustellen. Dabei wird u.a. die theoretische Nähe zum Denken von Michel Foucault herausgearbeitet und das Konzept des Freien Geistes in den Zusammenhang der heutigen Individualisierungsdebatte gestellt.
Abschließende, kritische Reflexionen weisen "Nietzsche als Erzieher" aus und beschäftigen sich mit den pädagogischen Intention von Nietzsches Werk im Hinblick auf den "Freien Geist". Allgemeines Ergebnis ist, dass der Freie Geist heute wie zu Zeiten Nietzsches nichts an Aktualität eingebüßt hat, auch wenn dessen Verwirklichung wohl nur Wenigen gelingen wird.
Gliederung
Prolog:
1. Einleitung: Kernfrage und Vorgehensweise
Hauptteil
2. Merkmale der gebundenen Geister
2.1 Loyalität: Pflichtgefühl und Herkunftstreue
2.2 Dogmatik: Habitualisierung und unbefragtes Für - wahr - halten
2.3 Heteronomie: Subjektivierung unter fremden Maßgaben
3. Genese und Konstitution des Freien Geistes
3.1 Erste Annäherung: der freie Geist - „ein relativer Begriff“
3.2 Zäsur und Emanzipationsphase: Freiheit von...
3.3 Essayistische Phase: Infragestellung und Neuinterpretation
3.4 Phase der Freiheit des Geistes: die Freiheit zu
3.4.1 Die Reokkupation des Geistes
3.4.2 Autonomie, Souveränität und Interpretationspluralität
3.4.3 Intellektuelle Prosperität, Courage, Kreativität und Affirmation
3.4.4 Reflektierte Distanz und Gelassenheit
3.4.5 „In media vita“ , Redlichkeit und die Kunst der Differenzierung
3.4.6. Problembewusstsein und neue Aufgaben
3.4.7 Der freie Geist und sein offenes Verhältnis zur Wahrheit
3.4.8 Der freie Geist: Philosophische Lebensform - und Form der neuen Philosophen?
4. Aktueller Bezug: Von Nietzsche zu Foucault und zurück
5. Fazit: Nietzsches als Erzieher und die Normativität des freien Geistes
6. Quellenangaben:
7. Abkürzungen der Primärliteratur
Prolog:
„Wir aber wollen Die werden, die wir sind, - die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden!“
F. Nietzsche, FW S. 563, 335
1. Einleitung: Kernfrage und Vorgehensweise
„Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes: wie der Geist zum Kameele wird, und zum Löwen das Kameel und zum Kinde zuletzt der Löwe“ (Z S.29).[1] So beginnt die erste Rede, die Friedrich Nietzsche (1844-1900) seinem Propheten Zarathustra in den Mund legt. Damit ist aber nicht nur die geistige Metamorphose Zarathustras artikuliert, sondern auch metaphorisch eine innere Entwicklungsbewegung in Nietzsches eigenem Denken angesprochen, die auch in seinen drei Schaffensperioden festgestellt werden kann.[2] Diese stellt aber nur indirekt den Schwerpunkt der Arbeit dar. Vielmehr wird die innere Entwicklungsdynamik der Geisteshaltung und das aus dem eigenen Leben und Denken geronnene Programm des freien Geistes, welches Nietzsches „theoretisches wie praktisches Lebensideal“ (Gebhardt 2000, S. 207) darstellt, als Problemkern dieser Arbeit behandelt. Nietzsches Denken und Leben kann zwar als lebendiges Exempel eines freien Geistes gelesen und verstanden werden, dennoch liegt der sachliche Fokus in der systematischen Frage nach dem Konzept des freien Geistes in Nietzsches Werk, welches bereits in der Metaphorik der drei Verwandlungen angedeutet ist. Es wird versucht, Genese und Konstitution, die jenen „Typus“ (MA S. 15, Vorr.) idealtypisch auszeichnen, herauszuarbeiten. Was aber genau die formalen Eigenschaften dieser „tapferen Gesellen“ (ebd. S. 15, Vorr.) und „geborenen Räthselrather (...) des kommenden Jahrhunderts“ (FW S.574, 343) betrifft, wie Nietzsche sie begriffen und bestimmt hat, und was sie wesentlich ausmacht, gilt es im Folgenden auf den Begriff zu bringen.
Des Weitern soll gefragt werden, ob diese Konzeption des freien Geistes und den mit ihm verbundenen Attributen für uns Heutige noch Aktualität und Relevanz besitzt, oder ob dieses Konzept bloß eine zeitlich begrenzte Antwort auf die Diagnose des europäischen Nihilismus darstellte, welches zwar eine Bedeutung für die damaligen Fragen und Lebensprobleme besaß, aber für uns Heutigen obsolet und wertlos geworden ist. Diese Frage wird gegen Ende der Arbeit explizit gestellt. Jedoch kann, die im Folgenden im Hauptteil geleistete Ausarbeitung bereits als eine erste Aktualisierung gelesen werden, da versucht wird, die oft bildliche Sprache Nietzsches in eine sachlich und „zeitgemäß“, d.h. uns Heutigen geläufigere Sprache zu übersetzen.
Jedoch muss aufgrund des begrenzten, formalen Rahmens dieser Hausarbeit die Biographie Nietzsches ausgespart werden.[3] Des Weitern wird, wenn nicht als anders nötig erachtet, der soziokulturelle und philosophiegeschichtliche Hintergrund, vor welchem Nietzsches Leben bzw. Denken sich abspielt, ausgelassen,[4] obgleich beides in diesem geschichtlichen Prokrustesbett angelegt und dadurch unweigerlich bedingt ist. Vornehmlich soll die systematische Frage nach dem Konzept des freien Geistes in Nietzsches Werk im Vordergrund der Erörterung stehen. Die Methode dazu ist die textnahe, von Sekundärliteratur gestützte, Interpretation ausgewählter und vom Verfasser als bedeutend erachtete Stellen, die sich verstreut im gesamten Textkorpus von Nietzsches Schriften finden lassen.[5]
So denn zur Sache und zur Frage, was es mit der Metapher des Kamels auf sich hat, oder wie Nietzsche es weniger bildlich ausdrückt, was es bedeutet „ein gebundener Geist“ (MA S. 16, Vorr.) zu sein.
Hauptteil
2. Merkmale der gebundenen Geister
„Was ist schwer? So fragt der tragsame Geist, so kniet er nieder, dem Kameele gleich, und will gut beladen sein. Was ist schwer, ihr Helden? So fragt der tragsame Geist, dass ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde.“
Also sprach Zarathustra, S. 29
2.1 Loyalität: Pflichtgefühl und Herkunftstreue
Bevor die Entstehung und die wesentlichen Aspekte des freien Geistes eruiert werden, muss zum besseren Verständnis sein Entstehungsgrund und der „Wesensgegensatz“[6] erläutert werden, denn man „darf vermuten, dass ein Geist, in dem der (...) freie Geist einmal bist zur Vollkommenheit reif und süß werden soll, (...) umso mehr ein gebundener Geist war und (...) gefesselt schien“ (MA S. 16, Vorr.).[7] Der gebundene Geist ist also vermutlich die notwendige Voraussetzung einer Genese zum freien Geist. Was aber, so stellt sich die Frage, bindet einen Menschen am festesten? Nietzsche dazu: „Bei einem Menschen von hoher und ausgesuchter Art werden es die Pflichten sein: jene Ehrfurcht, wie sie der Jugend eignet, jene Scheu und Zartheit vor allem Altverehrten und Würdigen, für die Hand, die sie führte, für das Heiligtum, wo sie anbeten lernte“ (ebd. S.16, Vorr.).
Es ist, laut Nietzsche, das Pflichtgefühl, die Ehrerbietung, Achtung und Verehrung, die den gebundenen Geist auszeichnet und ihn an seine partizipierte Herkunft, d.h. Tradition, Konvention und Autorität bindet. Der gebundene Geist kann also als eine religiöse Haltung im weitesten Begriffssinn verstanden werden: als eine an das Herkommen rückgebundene und dieser in Loyalität verbundene Mentalität, der ein autoritäres Sollen als innere Handlungsaufforderung und -anleitung zu Gebote steht.
2.2 Dogmatik: Habitualisierung und unbefragtes Für - wahr - halten
Der gebundene Geist unterscheidet sich aber noch in einem weiteren Aspekt vom freien Geist. Nicht nur das ehrerbietende und achtungsschenkende Pflichtbewusstsein zeichnet jenen aus, sondern auch eine internalisierte Habitualisierung, welche dieses moralische Pflicht-bewusstsein gleichsam bedingt, denn der „gebundene Geist nimmt seine Stellung nicht aus Gründen ein, sondern aus Gewöhnung“ (MA S. 190, 226).
Dies bedeutet, die Habitualisierung einer Einstellung erfolgt unbefragt aufgrund der rekapitulierten Gebräuchlichkeit, Bewährtheit und „aus Furcht“ (MR S.92, 104) innerhalb eines bestimmten Milieus. Die Mentalität und Wertschätzung eines Milieus, d.h. in Nietzsches Worten, die Sitte, welche „die herkömmliche Art zu handeln und abzuschätzen“ (M S.22, 9) ist, wird inkorporiert, und es wird nicht nach Rechtfertigungen oder Ursachen für diese Einstellung gefragt. Sie wird unreflektiert durch Erziehung und eine milieuspezifische Sozialisation verinnerlicht. Das heißt aber auch, der gebundenen Geist zeichnet sich durch Autoritäts- und Herkunftsgläubigkeit aus, da, laut Nietzsche, „Angewöhnung geistiger Grundsätze ohne Gründe (...) Glaube“ (MA S. 190, 226) genannt werden kann. Der Typus des gebundenen Geistes kann folglich als ein „Dogmatiker der Herkunft“ bezeichnet werden, der die Wahrheits- und Richtigkeitsansprüche derselben unkritisch und unbefragt übernimmt. Der gebundene Geist ist demnach gehorchendes Denken. Er zeichnet sich durch den Gehorsam gegenüber der Herkunft aus und wird durch die „Sittlichkeit der Sitte und die sociale Zwangsjacke wirklich berechenbar gemacht“ (GM S. 293, 2).[8]
2.3 Heteronomie: Subjektivierung unter fremden Maßgaben
Diese beiden zusammenhängenden Aspekte[9], also dass aus der unreflektierten Übernahme entsprungene Pflichtgefühl, welches gleichsam bedingt aus Habitualisierung und Gläubigkeit (und nicht aus intellektueller Begründetheit) resultiert, münden in ein Gehorsamsverhältnis[10] gegenüber fremden Ansprüchen und als dogmatisch geachteten Grundsätzen. Kurzum: der gebundene Geist zeichnet sich, moderner gesprochen, durch seine milieubedingte Attitüde und Heteronomie aus,[11] d.h. er ist einer Subjektivierung durch fremden Grundsätzen, Maßstäben und Interpretationsmustern unterworfen, denen man guten Gewissens Folge leistet und somit „auf der Grundlage dieses Gemeinsinns (...) Staate und Stande nützlich wird“ (ebd. S. 192, 228).[12] Der gebundene Geist ist somit die theoretische und praktische Rekapitulationseinheit fremder Ansprüche, welche die Funktionalität des Status quo durch einen internalisierten Moralkodex und eine übernommene Mentalität konserviert.
3. Genese und Konstitution des Freien Geistes
Im Folgenden wird die Entwicklungsperiodik des freien Geistes dargestellt.[13] Zuerst wird dessen Genese erörtert und dann anhand einiger einschlägiger Textstellen versucht, in denen Nietzsche explizit über den freien Geist spricht, dessen Konstitution zu erläutern. Ziel ist es also formale Eigenschaften und den „freien Geist“ auszeichnende Merkmale herauszustellen, die unter dieser Thematik subsumiert werden können.
3.1 Erste Annäherung: der freie Geist - „ein relativer Begriff“
Da im Vorangegangenen die konstitutiven Momente des gebundenen Geistes dargestellt wurden ist die Frage erlaubt, auf welchem Wege der freie Geist zu seiner Befreiung gelangt, wie er sich also vom Gängelband der Herkunft befreit.
Nietzsche meint, ein Freigeist bzw. freier Geist sei ein „relativer Begriff“(MA S. 189, 225)[14] und man nenne somit, bezogen auf den jeweiligen Ursprung, den „einen Freigeist, welcher anders denkt, als man von ihm auf Grund seiner Herkunft, Umgebung, seines Standes und Amtes oder auf Grund der herrschenden Zeitansichten erwartet. Er ist die Ausnahme, die gebundenen Geister die Regel“ (ebd. S. 189, 225).[15] Wie aber wird man zu einem solchen Ausnahme-Menschen und Anders-Denkenden, der sich nicht den gängigen Erwartungsschemata fügt, nicht „berechenbar, regelmässig, nothwendig“ (GM S.292, 1) ist und nur „einzeln und hier und dort auf Erden“ (N 11, S. 658) lebt?
3.2 Zäsur und Emanzipationsphase: Freiheit von...
„Neue Werthe schaffen – das vermag auch der Löwe noch nicht:
aber Freiheit sich zu schaffen zu neuem Schaffen – das vermag die Macht des Löwen. Freiheit sich schaffen und ein heiliges Nein auch vor der Pflicht: dazu, meine Brüder, bedarf es des Löwen.“
Also sprach Zarathustra, S. 30
Nietzsches resümierende Antwort lautet[16], dass ein solches außergewöhnliches Individuum vermutlich „sein entscheidendes Ereignis in einer grossen Loslösung gehabt hat“, (...) (ebd. S. 16, Vorr.) und diese „die junge Seele (...) mit Einem Male erschüttert (...) - sie selbst versteht nicht was sich begibt. Ein Antrieb und Drang waltet und wird über sie Herr wie ein Befehl“ (ebd. S. 16, Vorr.). Nietzsche umschreibt prosaisch diese Emanzipation und Periagogik als eine Art spontaner „Entbindung“ vom Gewohnten, deren Beweggründe sie sich aber noch nicht in vollem Maße bewusst ist. Es macht sich eher ein Art innere Revolte und ein starkes Aufbegehren bemerkbar, das sich als „heftige, gefährliche Neugierde nach einer unentdeckten Welt, (...) ein plötzlicher Schrecken und Argwohn (...), ein Blitz der Verachtung gegen Das, was ihr Pflicht hiess, ein (...) Verlangen nach Wanderschaft, Fremde, Entfremdung“ (ebd. S.16, Vorr.) äußert. Dieses emotional erregende und krisenhafte Ereignis, das eine Entwertung des Bekannten und eine aktive Öffnung Neuem und Unbekanntem gegenüber zur Folge hat, wird auch als erster „Ausbruch von Kraft und Wille zur Selbstbestimmung, Selbst-Wertsetzung, (...) Wille zum freien Willen“ (ebd. S 17, Vorr.) charakterisiert. Der sich entbindende Geist „fühlt sich zur Wanderschaft aufgerufen (...), zu aller Gegenwehr, zur radikalen Abkehr“ (Löwisch 1998, S. 223). Mit dem Emanzipationsereignis der „großen Loslösung“ tritt also ein Bildungs- und Individuationsprozess in Gang.[17]
3.3 Essayistische Phase: Infragestellung und Neuinterpretation
Was aber folgt auf diese Zäsur mit dem Traditionellen und Konventionellen? Es sind, so Nietzsche, die „Wüste solcher Versuchs-Jahre“ (MA S. 17, Vorr.), in denen der „Losgelöste sich nunmehr seine Herrschaft über die Dinge zu beweisen sucht! (...) Im Hintergrunde seines Treibens und Schweifens (...) steht das Fragezeichen einer immer gefährlicheren Neugierde“ (ebd. S. 17, Vorr.), die zum Beispiel fragt, ob „man nicht alle Werthe umdrehen“ (ebd. S. 17, Vorr.) kann. Gleichsam ein intellektuelles „Gewissen hinter“ (FW S. 561, 335) dem gewöhnlichen und moralischen Gewissen, das vom „Verlangen nach Gewissheit“ (ebd. S. 373, 2) geleitet wird, fordert Gründe für das, was der Fall ist und warum es der Fall ist bzw. ob es vielleicht nicht alles ganz anders sein und gesehen werden könnte.
[...]
[1] Die Zitation von Nietzschestellen wird im Kommenden wie folgt gehandhabt: in Klammern steht zuerst die Abkürzung des Werkes. Diese entsprechen allesamt der Kritischen Studienausgabe von Colli/Montinari. Der Abkürzung des Werkes (die am Ende der Hausarbeit erläutert sind) folgt die Seitenzahl, an welcher die angegeben Stelle zu finden ist sowie die Nummer des Aphorismus. Stellen aus dem Nachlass werden mit Seitenzahl und Nummer des Bandes zitiert.
[2] Vgl. dazu Ries 1990, S. 26; auch Andreas Salome 2000, S. 162, Gerhardt 2006, S. 207 f.
[3] Biographische Details und die Verknüpfung von Leben und Denken Nietzsches finden sich zum Beispiel bei: Gebhardt 2006, S. 31 ff.; Andreas Salome 2000, S. 73 ff.; Krell/Bates 2000, S. 9ff.
[4] Einen Überblick der wichtigsten Vertreter verschiedenster Denkrichtungen des 19. Jahrhundert gibt: Fellmann (Hrsg.), 1996, S. 15ff. Zudem wird deutlich das Nietzsche trotzt aller halb ironisierend, halb ernst gemeinten Originalitätsbekundungen (Vgl. dazu das Werk EH) kein Einzelfall im philosophischen Diskurs war was etwa Religionskritik (Marx und Feuerbach), Hinwendung zur Diesseitigkeit und der Existenz (Kierkegaard), radikaler Individualismus (Stirner) und Hervorhebung der Irrationalität menschlicher Belange und der Subjektivität des Erkennens (Schopenhauer) betrifft.
[5] „Ein Fälscher ist, wer Nietzsche interpretiert, indem er Zitate aus ihm benutzt.“ (Colli, Giorgio; in: Gebhardt 2005; S. 64) Der Verfasser ist sich bewusst „ein Fälscher“ zu sein, dies aber aus Notwendigkeit, denn welche andere Möglichkeit bestünde, wenn man ein systematischen Frage an Nietzsches Werk stellt, als Textstellen zu interpretieren und diesen einen Sinn zu entnehmen? Vielleicht sollte man keine systematische Rückfrage an sein Werk stellen? Und vielleicht legt jeder Nietzsche nur so aus, „so gut er es eben versteht“ (Gebhardt 2005, S. 64)- dann bedeutet dies: die folgende Arbeit ist der Versuch einer sachlich begründeten Auslegung, aber nur eben so gut wie der Verfasser es versteht Nietzsche zu interpretieren. Darum finden sich auch häufig andere Auslegungsmöglichkeiten befürwortende Adjektive wie etwa „vielleicht, vermutlich“ usw. in dieser Arbeit.
[6] Es lässt sich in Nietzsches Werk ein immer wiederkehrendes und in den Inhalten variiertes Denkschema erkennen, das sich durch seine dichotome Struktur auszeichnet: stark - schwach, aktiv - passiv, frei - gebunden, Herrenmoral - Sklavenmoral; die Wenigen - die Vielen, gut - schlecht, d.h. Nietzsche denkt zwar Jenseits von Gut und Böse, aber nicht gänzlich jenseits von einem dualen Schema. Zudem sind alle erst genannten Adjektive und Nomen das, was Nietzsche nach seiner Wertung als „gut“ bezeichnet. Es ist somit sein normatives Denkgerüst, quasi seine moralische Gütertafel. Sehr wahrscheinlich hat dieser dichotome Aufbau pädagogische Gründe, um den Leser an „den Kreuzweg“ (ZB 1, S. 729) zu stellen und die Frage zu provozieren, zu welcher Seite man sich selbst als zugehörig zählt, bzw. welchen Weg man nach der Lektüre Nietzsches einzuschlagen wünscht.
[7] Alle in Zitaten kursiv geschriebenen Stellen sind im Original apostrophierte Satzglieder (A.d.V.).
[8] Vgl. zum Thema „Sittlichkeit der Sitte“ auch M S. 22; 9. Dort findet sich auch eine interessante Passage, die bereits auf Gedanken hindeutet, die erst in der GM genauer ausgeführt werden.
[9] An dieser Stelle seien zusätzlich die vier Maßstäbe genannt, die bei den gebundenen Geistern Geltung beanspruchen und das „Maas der Dinge“ (MA S. 192, 229) sind: Beharrlichkeit, Annehmlichkeit, Vorteilhaftigkeit und Selbstaufopferung. Vgl. dazu ebd. S. 192, 229.
[10] Bezüglich des Zusammenhangs von Gehorsam und Gläubigkeit vgl. auch FW S. 581, 347; auch MA S.92, 96.
[11] Diese Fremdbestimmung und der Glaube der gebundenen Geister an fremde und etablierte Grundsätze ist auch, laut Nietzsche, die treibende Kraft, welche die Institution einer Gesellschaft zusammen und ihr Bestehen aufrecht erhalten. Vgl. dazu: MA S. 191, 227. Wohingegen der geistige Fortschritt in Zusammenschlüssen gerade von den Menschen vorangetrieben wird, „welche Neues und überhaupt Vielerlei versuchen“ (ebd. S.187), falls es in ein Kollektiv assimiliert werden kann. Darin klingt ein „Nützlichkeitsaspekt“ des freien Geistes für das Kollektiv an: Er ist durch seine Unkonventionalität innovativ, indem er eine Transformation des Kollektivs bewirken kann.
[12] An dieser Stelle wird deutlich, dass auch der „courante Mensch (ZB 1, S. 667)“, d.h. die Bildungsphilister, die Nietzsche von den Bildungsanstalten in seiner Zeit produziert sieht, ebenso wie der moralisch und intellektuell gebundene Geist im Dienste des Staates und der Volkswirtschaft stehen. D. h. Ausbildungssystem und Moral sind in diesem Sinne ideologisch, da sie Individuen dem interessengeleiteten Nutzen und Mittel -Zweck Kalkül der Gesellschaft unterstellen. Vgl. dazu ZB 1, S. 665ff.
[13] Diese strenge Periodik ist nicht von Nietzsche selbst so strukturiert worden, aber die Auslegung der zweiten Vorrede von MA lässt diese systematische und strukturierte Einteilung sehr wohl zu.
[14] Nietzsche schreibt dort explizit „Freigeist“, an anderer Stelle desselben Kapitels in einer Überschrift aber „Vorsicht der freien Geister“ (MA S.234, 291). D.h. Nietzsche gebraucht diese Begriffe synonym. Im Unterschied dazu hebt sich der Freigeist/freie Geist vom Freidenker ab. Vgl. dazu JGB S.62, 44.
[15] Im Buch MA ist noch eine „milde Form“ des freien Geistes gezeichnet. Dort ist der freie Geist eher ein intellektualistisches Ideal und der Hang zur Erkenntnis der vorrangige Antrieb dieses Typus. Nietzsche geht sogar soweit, die äußeren Rahmenbedingungen des freien Geistes zu skizzieren, damit er ganz ins „Element des Erkennens hinabtauchen“ kann. Vgl. dazu MA S. 234; 291 und 292.
[16] Die Vorrede der zweiten Auflage von MA wurde 1886 geschrieben, also acht Jahre nach der ersten Veröffentlichung, zu Zeiten also, in denen er bereits JGB publiziert hatte. In dieser Vorrede reflektiert Nietzsche seinen bisherigen und den verallgemeinerten, wünschbaren Werdegang des freien Geistes, der für ihn seit der Erstveröffentlichung von MA immer mehr zum heroischen Ideal herangereift ist. Vgl. dazu auch N11, S. 657 ff und N 11, S. 663 ff.
[17] Es wären auch andere Gründe, als etwa Neugierde und Verachtung, die zur Loslösung führen, denkbar, wie z.B.: ein Schicksalsschlag oder Grenzsituationen, die bisher Gewohntes und Selbstverständliches fragwürdig erscheinen lassen; oder die Lektüre eines maßgebenden Buches; oder die „anders – denkend“ machenden Ideenimpulse eines Lehrers.
- Quote paper
- Mario Stenz (Author), 2008, Nietzsche und der freie Geist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137082