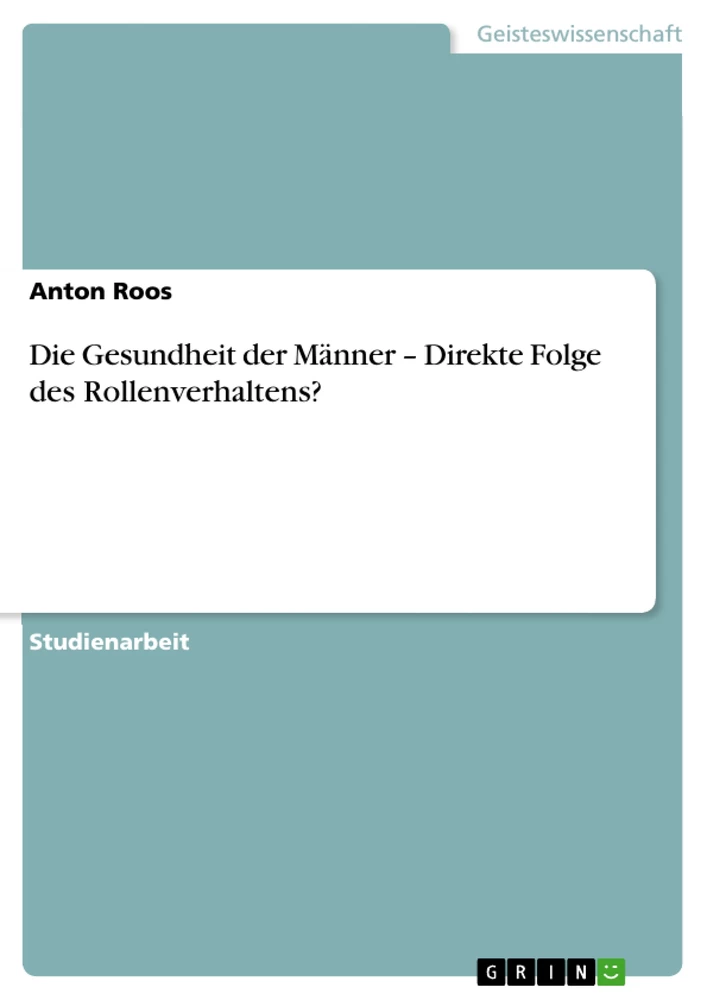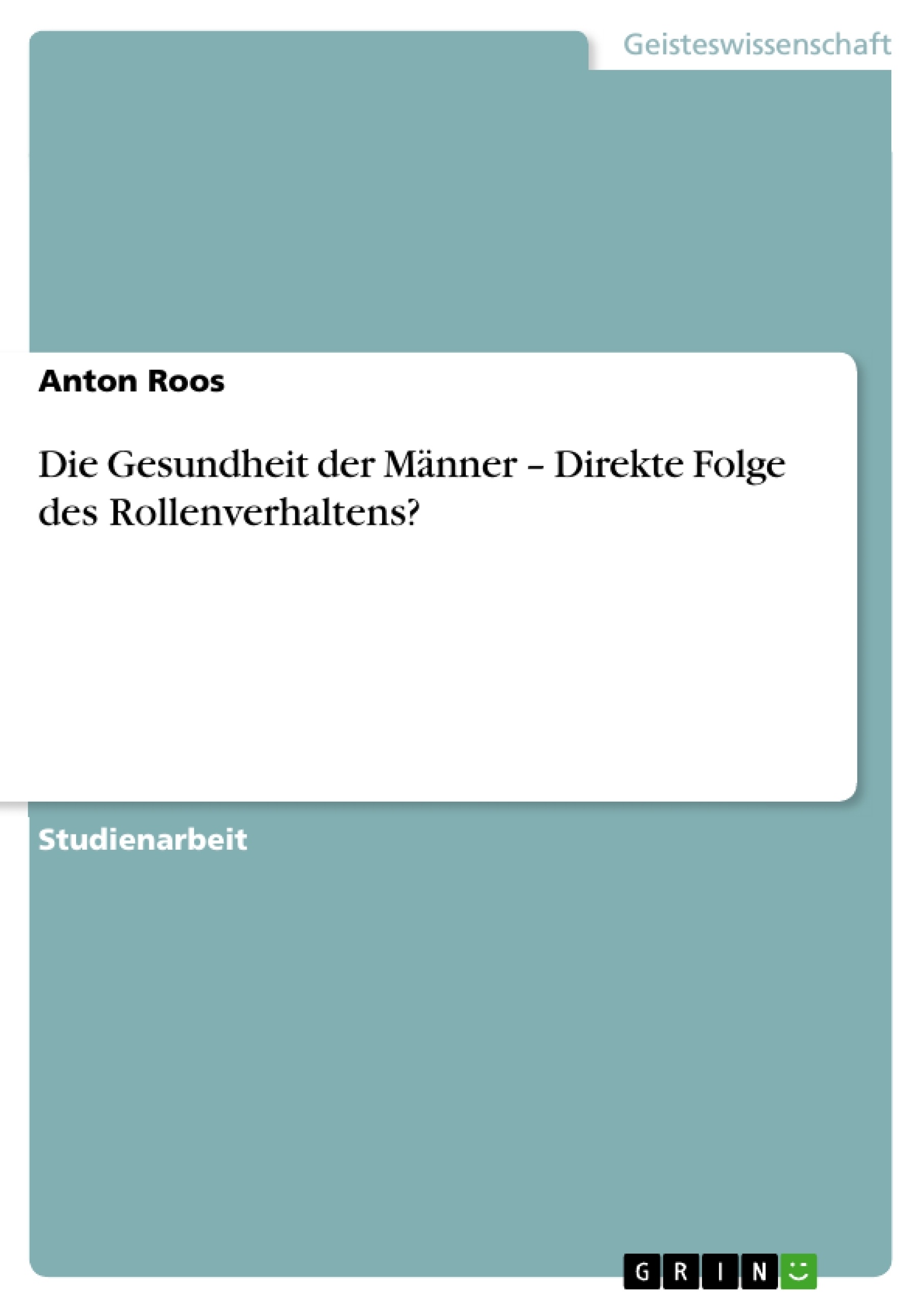Das Hauptthema der vorliegenden Arbeit soll Männlichkeit und deren gesundheitliche Auswirkungen sein – Männlichkeit als gesellschaftliches Konstrukt und als sozial realer Faktor mit seinen realen Folgen für den Mann und die Gesellschaft. Der Fokus soll auf dem Gebiet Deutschlands liegen, wobei amerikanische Studien kontrastierend zurate gezogen werden.
Im ersten Teil werden die in der Arbeit zu berücksichtigenden Begriffe definiert. Im Anschluss daran wird der Begriff Männlichkeit eingegrenzt. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus der ausschnittartigen Betrachtung einiger gesundheitlichen Folgen von Männlichkeit und männlichem Verhalten für den Mann. Hier soll die Frage geklärt werden, ob das männliche Geschlecht wirklich aufgrund des männlichen Rollenverhaltens zum schwächeren Geschlecht geworden ist.
Der abschließende Teil gibt einen kurzen Ausblick auf die Veränderungen im Verhalten der Geschlechter, wie sie sich in neuester Zeit herausbilden. Hier soll kurz auf bemerkenswerte Tendenzen hingewiesen werden.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Verwendete Begriffe
2. Rolle des Mannes gestern und heute
3. Konsequenzen für die Gesundheit
3.1. Psychische Erkrankungen
3.2. Physische Erkrankungen
4. Zusammenfassung
5. Quellenverzeichnis
0. Einleitung
Die Welt und die darauf lebende menschliche Gesellschaft verändern sich ständig, zwar nicht gravierend, jedoch ist in jeder Sekunde eine Veränderung passiert. Es verändern sich Bevölkerungsgröße, Bevölkerungsverteilung, Anzahl der unterschiedlichen Gesellschaften und deren Verhältnis zueinander. Innerhalb der verschiedenen Gesellschaften verändern sich ebenfalls nahezu sekündlich die unterschiedlichen Systeme, wie politisches System, religiöse Glaubenssysteme, wirtschaftliches System, kulturelle Systeme, Ausbildungssysteme und Lehranstalten und schließlich auch die kleinsten sozialen Einheiten – die persönlichen Beziehungssysteme. Hierunter sind die Beziehungen in der Familie (Eltern-Eltern, Kind-Kind, Eltern-Kind) aber auch die vorfamiliären zwischenmenschlichen Beziehungen (Arbeit, Freizeit, Freundschaft, intime Beziehung) zu zählen.
In den letztgenannten ist insbesondere in Bezug auf das Verhältnis der Geschlechter zueinander und untereinander eine Veränderung zu bemerken.
Das Hauptthema der vorliegenden Arbeit soll Männlichkeit und deren gesundheitliche Auswirkungen sein – Männlichkeit als gesellschaftliches Konstrukt und als sozial realer Faktor mit seinen realen Folgen für den Mann und die Gesellschaft. Der Fokus soll auf dem Gebiet Deutschlands liegen, wobei amerikanische Studien kontrastierend zurate gezogen werden.
Im ersten Teil werden die in der Arbeit zu berücksichtigenden Begriffe definiert. Im Anschluss daran wird der Begriff Männlichkeit eingegrenzt. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus der ausschnittartigen Betrachtung einiger gesundheitlichen Folgen von Männlichkeit und männlichem Verhalten für den Mann. Hier soll die Frage geklärt werden, ob das männliche Geschlecht wirklich aufgrund des männlichen Rollenverhaltens zum schwächeren Geschlecht geworden ist.
Der abschließende Teil gibt einen kurzen Ausblick auf die Veränderungen im Verhalten der Geschlechter, wie sie sich in neuester Zeit herausbilden. Hier soll kurz auf bemerkenswerte Tendenzen hingewiesen werden.
1. Verwendete Begriffe
Da der zentrale Begriff dieser Arbeit das geschlechtsspezifische Rollenverhalten ist, soll dieser auch zuerst geklärt werden.
Der Begriff der geschlechterspezifischen Rolle stammt aus der amerikanischen Psychologie und bildet ein Modell zur Erklärung von wiederholtem Verhalten beim Mann oder bei der Frau, wobei nicht das Individuum, sondern die geschlechtshomogene Gruppe Betrachtungsgegenstand ist. Dabei wird bestimmtes Verhalten direkt dem biologischen Geschlecht zugeordnet, es bestätigt sozusagen das Geschlecht. Die positive Erfahrung mit dem beobachteten und später wiederholtem Verhalten führt zum sozialen Erfolg und zusätzlich zur Identifizierung mit der Rolle. Das Individuum reiht sich durch das wiederholte positive Erlebnis in die Rolle ein, erwirbt und manifestiert immer mehr bestimmte Verhaltensweisen, Attitüden, Eigenschaften Norm- und Wertvorstellungen[1].
Die Identifikation mit der Rolle und deren Manifestierung werden sowohl gruppenintern (alle, die in dieselbe Rolle fallen), als auch extern von der Umwelt (gesellschaftliche Erwartungen) gestützt und vorangetrieben, sodass ein Zuwiderhandeln zum Rollenverhalten zum Ausschluss und gesellschaftlichen Sanktionen führen kann[2] („Weichei!“, „Ich brauch´nen richtigen Mann!“). Kurz: Wer männlich sein will, muss sich männlich verhalten.
Jedoch ist der Erwerb des geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens nach Talcott Parsons primär an die familiäre Sozialisation vom Kindesalter an geknüpft. Die hier eingeübten Verhaltensmuster lassen sich in die einander gegenüberstehenden Skalen der Maskulinität und Feminität einordnen, welche anzeigen wie männlich/weiblich etwas ist. So sind übersteigerte Aggressivität, Homosexualität und Konfliktvermeidung beispielsweise die extremsten Abweichungen von der Maskulinitätsskala. Die Sozialisation in die Geschlechterrollen ist somit ein Produkt gesellschaftlicher Praxis mit lediglich einem biologischen Bezugspunkt[3]. Mit anderen Worten: „Natürlich ist die Frau und künstlich der Mann“[4].
Fasst man Parsons Sozialisationstheorem, welches sowohl in der modernen Psychologie, als auch in der Soziologie natürlich nicht unumstritten ist, könnte es folgendermaßen schematisiert werden[5]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses Verständnis von Sozialisation in die verschiedenen Geschlechterrollen ist vor allem auf funktional differenzierte Gesellschaften[6] anwendbar, denn in Gesellschaften, in denen nicht nur nach Struktur (Alter, Abstammung, Aussehen), sondern vor allen nach Funktion des Einzelgliedes im Gesamtgefüge unterschieden wird, ist das Geschlecht immer mehr als soziales Geschlecht (mit damit fest verbundenen Funktionen) zu verstehen[7]. Der Sohn durchläuft anfangs das gleiche Erziehungsmuster wie die (eventuell vorhandene) Schwester/Tochter, jedoch mit dem Unterschied, dass er das Verhalten des Vaters anders interpretiert, oder dieser bewusst ihm andere Werte und Verhaltensmuster „vorlebt“.
Die Erziehung zur männlichen Rolle hin passiert jedoch nicht nur innerfamiliär, obwohl diese Phase wohl die am meisten prägende ist. Unter Erziehung zur Geschlechterrolle soll hier all das gezählt werden, was außerhalb der Familie in der späteren Kindheit, Jugend und im Erwachsenendasein auf den Menschen einwirkt. Trotzdem der Mensch ein Individuum mit eigenen Entscheidungen ist, lernt er auch von seiner Umwelt und den Mitmenschen, insofern erzieht ihn seine Umwelt zu einem großen Teil. In der anthropologischen Literatur wird an dieser Stelle von verschiedenen Initiationsriten gesprochen[8], und genau das ist es, nur in modernerer Form.
[...]
[1] Conell, R. W., Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten, Opladen 1999, S. 41
[2] Meuser, M., Männlichkeit und Geschlecht: Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster, Opladen 1998, 51
[3] Vgl. Ebenda, S. 52 ff
[4] Schwanitz, D., Männer: Eine Spezies wird besichtigt, München 2003, S. 75
[5] Meuser, M., Männlichkeit und Geschlecht: Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster, Opladen 1998, S. 54 ff
[6] Kneer, G./Nollmann, G., Funktional differenziert Gesellschaft, In: Kneer, G. (Hrsg.), Soziologische Gesellschaftstheorie: Konzepte moderner Zeitdiagnosen, München 1997, S. 81 ff
[7] Meuser, M., Männlichkeit und Geschlecht: Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster, Opladen 1998, S. 54
[8] Schwanitz, D., Männer: Eine Spezies wird besichtigt, München 2003, S. 78
- Quote paper
- Anton Roos (Author), 2005, Die Gesundheit der Männer – Direkte Folge des Rollenverhaltens?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137063