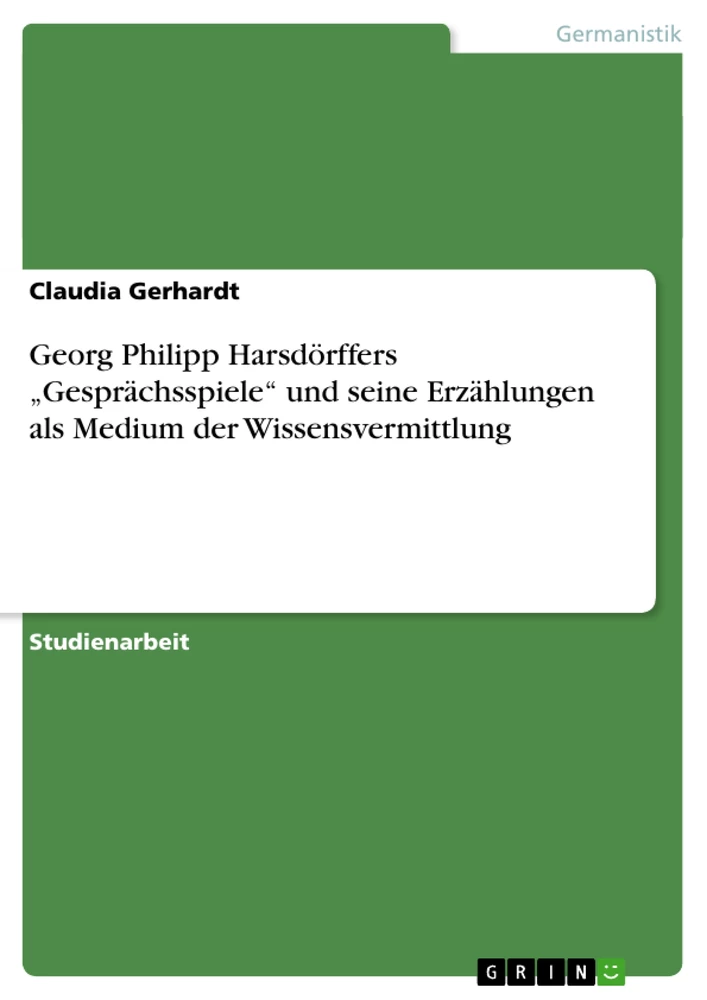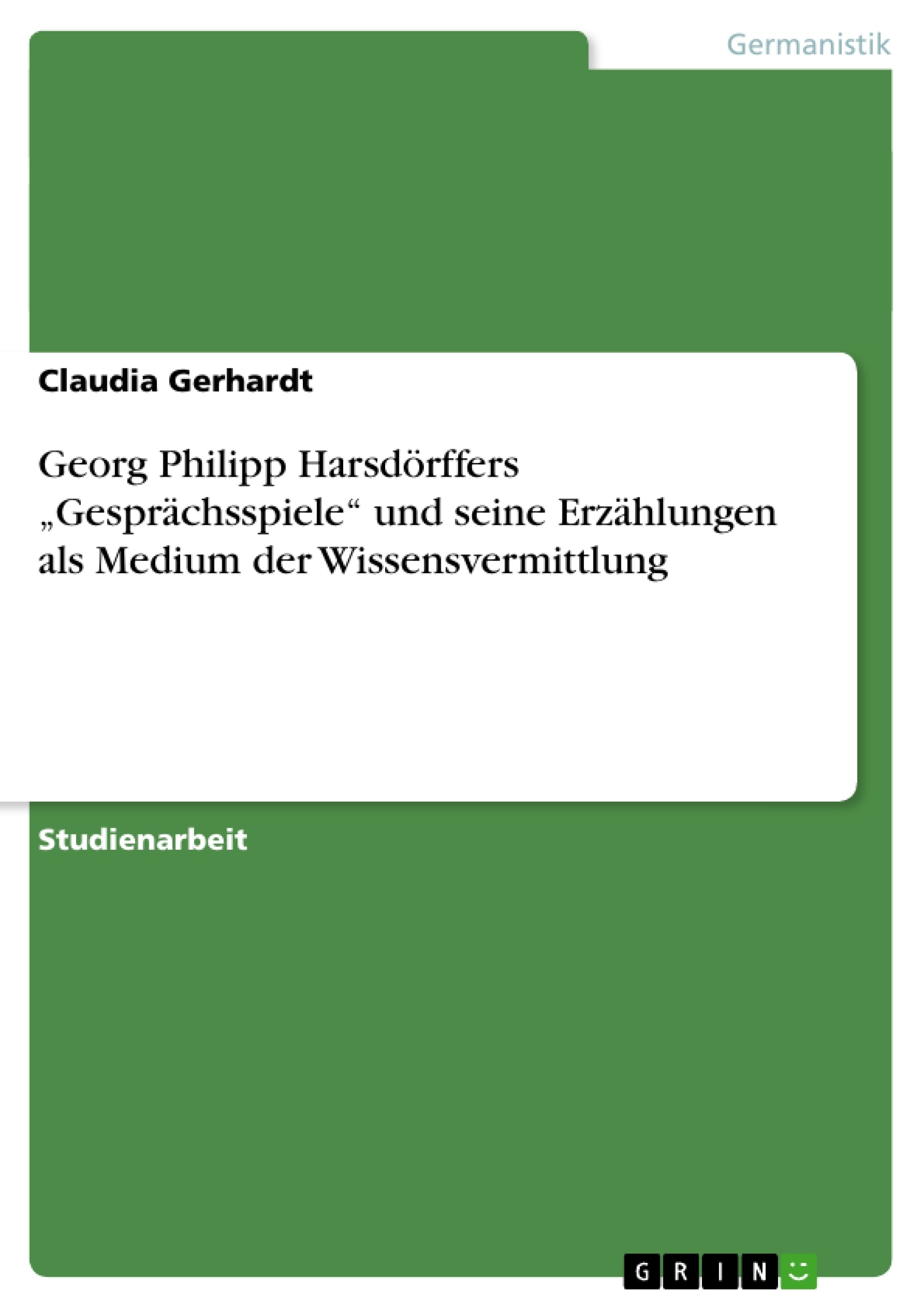Das Werk Georg Philipp Hardörffers, des am 1. November 1607 in Nürnberg geborenen Dichters, in seiner Gesamtheit und literarischen Bedeutung zu würdigen, war und ist für deutsche Germanisten nicht selbstverständlich. Ähnlich wie Hans Sachs (1491-1576) in der Forschung entweder als „Chronist und Kritiker seiner Zeit“ gelobt, oder als Vielschreiber ohne herausragenden literarischen Wert kritisiert wird, wurden Harsdörffers Hauptwerke lange Zeit in erster Linie als „kulturwissenschaftlicher Steinbruch“ genutzt, ohne den Eigenwert des umfangreichen Gesamtwerkes ausreichend zu betonen. Erst im Zuge des literaturgeschichtlichen Umdenkens, das „ein paar Jahre vor dem 2. Weltkrieg begann“, wird das „Sammeln“, im Gegensatz zum (metaphysischen) „Schöpfen“, als ‚Technik’ des Literaturschaffenden nicht mehr oder wenigstens seltener mit einer Art Herablassung bedacht. In diesem Kontext bestimmt nun weniger die Art der Inhaltsgewinnung die Bewertung, sondern die Art und Weise der Verwendung von wie auch immer gewonnenen Inhalten.
Um das Wirken Harsdörffers in angemessenem Zusammenhang darstellen zu können, sei zunächst die allgemeine Rolle der Dichtung im deutschen Barock grob skizziert. Anschließend wird von einer Auswahl italienischer und deutscher Sprachgesellschaften zu sprechen sein, um den Einfluss derselben auf die Absichten und Methodik der Werke Harsdörffers aufzuzeigen. Gemäß der Schwerpunktsetzung widmen sich die darauffolgenden Abschnitte den „Frauenzimmer Gesprächsspielen“, dem umfangreichsten Teil des literarischen Schaffens Harsdörffers. Nach einer kurzen Hinführung sollen Personen, Schauplätze und Spielarten der Gesprächsspiele genauer betrachtet werden. Die Frage, welche Rolle der Frau als Adressat und Mitspieler in Harsdörffers Werk zukommt, wird ebenso zu klären sein wie das Verhältnis von Spiel und Wissen innerhalb der Gesprächsspiele. Der damit abgeschlossenen Behandlung der Gesprächsspiele folgt eine Betrachtung des „Poetischen Trichter“, des dem Namen nach bekanntesten Werk Harsdörffers. Dabei sollen in verhältnismäßig knapper Darstellung sowohl die Absicht des Verfassers als auch die Bedeutung des ingenium in dessen Dichtungsverständnis herausgestellt werden. Der Blick auf den Erzählband „Der grosse Schau-platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“, dessen Moraldidaktik und deren Zweck zu betonen sind, beendet die werkspezifischen Betrachtungen, deren jeweilige Ergebnisse in der abschließenden Zusammenfassung nochmals Erwähnung finden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund und Einflüsse
- Rolle der Dichtung im deutschen Barock
- Sprachgesellschaften
- Die Gesprächsspiele
- Hinführung
- Personen, Schauplätze, Spielarten
- Die Frau als Adressat und Mitspieler
- Spiel und Wissen
- Der Poetische Trichter
- Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Georg Philipp Harsdörffers Werk, insbesondere seine „Gesprächsspiele“ und Erzählungen, im Hinblick auf seine Rolle als Medium der Wissensvermittlung im deutschen Barock. Sie beleuchtet den Einfluss von Sprachgesellschaften und dem barocken Weltbild auf Harsdörffers Schaffen und analysiert die Funktion der Frau als Adressatin und Mitspielerin in seinen Werken.
- Die Rolle der Dichtung als Wissensvermittlungsmedium im deutschen Barock
- Der Einfluss von Sprachgesellschaften auf Harsdörffers Werk
- Analyse der „Gesprächsspiele“ als didaktisches und interaktives Format
- Die Bedeutung der Frau in Harsdörffers literarischem Schaffen
- Das Verhältnis von Spiel und Wissen in Harsdörffers Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die bisherige Forschungslandschaft zu Georg Philipp Harsdörffer, die seine Werke lange Zeit primär als kulturwissenschaftliche Quelle betrachtete, ohne deren literarischen Eigenwert ausreichend zu würdigen. Sie skizziert die Ziele der vorliegenden Arbeit: die Darstellung von Harsdörffers Wirken im Kontext des deutschen Barocks, die Untersuchung seiner „Gesprächsspiele“ und die Analyse weiterer ausgewählter Werke, wie „Der Poetische Trichter“ und „Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“.
Hintergrund und Einflüsse: Dieses Kapitel beschreibt das religiös geprägte Systemdenken des deutschen Barocks und seine Auswirkung auf die Literatur. Es betont das Bestreben nach „Vielwisserei“ als Ganzheitsstreben, nicht als bloße Sammlung von Einzelheiten. Die Sprache und ihr Gebrauch werden als Mittel zur Klassifizierung innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung dargestellt, wobei der Stil die soziale Stellung des Sprechers widerspiegelte. Die beschränkten formalen Möglichkeiten der Dichtung im Barock werden mit dem antiken Verständnis von Rhetorik in Verbindung gebracht.
Die Gesprächsspiele: Dieser Abschnitt widmet sich eingehend den „Frauenzimmer Gesprächsspielen“, dem umfangreichsten Teil von Harsdörffers Werk. Er analysiert die Personen, Schauplätze und Spielarten der Gespräche, untersucht die Rolle der Frau als Adressatin und Mitspielerin, und beleuchtet das komplexe Verhältnis von Spiel und Wissen innerhalb dieses interaktiven Formats. Die detaillierte Betrachtung der Gesprächsspiele im Kontext des barocken Weltbildes und der zeitgenössischen Rhetorik ist zentral für das Verständnis von Harsdörffers literarischem Schaffen.
Der Poetische Trichter: Die Zusammenfassung dieses Kapitels beschreibt Harsdörffers bekannstestes Werk, „Der Poetische Trichter“, und untersucht die Absicht des Autors und die Bedeutung des „ingenium“ in seinem Dichtungsverständnis. Es wird ein knapper Überblick über Inhalt und Bedeutung des Werkes gegeben, wobei der Fokus auf der Absicht des Autors und seiner poetologischen Ansichten liegt.
Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte: Die Zusammenfassung dieses Kapitels konzentriert sich auf den Erzählband „Der grosse Schau-platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“, der als Moraldidaktisches Werk interpretiert wird. Hier wird die didaktische Intention des Autors, die moralischen Botschaften und ihre Präsentation im Detail beleuchtet. Die moralische Zielsetzung und die Erzählweise des Werkes werden analysiert und in Beziehung zu den anderen Werken Harsdörffers gesetzt.
Schlüsselwörter
Georg Philipp Harsdörffer, Barockliteratur, Gesprächsspiele, Wissensvermittlung, Sprachgesellschaften, Frau im Barock, Rhetorik, Moraldidaktik, „Poetischer Trichter“, „Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“, Barockes Weltbild.
Häufig gestellte Fragen zu Georg Philipp Harsdörffers Werk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Werk von Georg Philipp Harsdörffer, insbesondere seine „Gesprächsspiele“ und Erzählungen, im Hinblick auf seine Rolle als Medium der Wissensvermittlung im deutschen Barock. Sie beleuchtet den Einfluss von Sprachgesellschaften und dem barocken Weltbild auf Harsdörffers Schaffen und analysiert die Funktion der Frau als Adressatin und Mitspielerin in seinen Werken.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der Dichtung als Wissensvermittlungsmedium im deutschen Barock, den Einfluss von Sprachgesellschaften auf Harsdörffers Werk, die Analyse der „Gesprächsspiele“ als didaktisches und interaktives Format, die Bedeutung der Frau in Harsdörffers literarischem Schaffen und das Verhältnis von Spiel und Wissen in seinen Werken.
Welche Werke von Harsdörffer werden untersucht?
Die Arbeit analysiert vor allem Harsdörffers „Gesprächsspiele“, „Der Poetische Trichter“ und „Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“.
Wie wird der Einfluss des barocken Weltbildes behandelt?
Die Arbeit beschreibt das religiös geprägte Systemdenken des deutschen Barocks und seine Auswirkungen auf die Literatur. Sie betont das Bestreben nach „Vielwisserei“ und die Rolle der Sprache als Mittel zur gesellschaftlichen Klassifizierung. Der Einfluss barocker Rhetorik und des antiken Verständnisses von Rhetorik auf Harsdörffers Werk wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Frau in Harsdörffers Werk?
Die Arbeit analysiert die Funktion der Frau als Adressatin und Mitspielerin in Harsdörffers „Gesprächsspielen“ und untersucht ihre Bedeutung in seinem literarischen Schaffen im Kontext des barocken Weltbildes.
Wie werden die „Gesprächsspiele“ analysiert?
Der Abschnitt zu den „Gesprächsspielen“ analysiert die Personen, Schauplätze und Spielarten der Gespräche und beleuchtet das komplexe Verhältnis von Spiel und Wissen in diesem interaktiven Format. Die detaillierte Betrachtung im Kontext des barocken Weltbildes und der zeitgenössischen Rhetorik ist zentral.
Was wird in der Zusammenfassung zu „Der Poetische Trichter“ behandelt?
Die Zusammenfassung zu „Der Poetische Trichter“ beschreibt das Werk, untersucht die Absicht des Autors und die Bedeutung des „ingenium“ in seinem Dichtungsverständnis. Der Fokus liegt auf der Absicht des Autors und seinen poetologischen Ansichten.
Was ist der Fokus der Zusammenfassung zu „Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“?
Die Zusammenfassung zu „Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“ konzentriert sich auf die moralische Zielsetzung des Werkes, die moralischen Botschaften und ihre Präsentation. Die moralische Zielsetzung und die Erzählweise werden analysiert und in Beziehung zu den anderen Werken Harsdörffers gesetzt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Georg Philipp Harsdörffer, Barockliteratur, Gesprächsspiele, Wissensvermittlung, Sprachgesellschaften, Frau im Barock, Rhetorik, Moraldidaktik, „Poetischer Trichter“, „Der Schau-Platz jaemmerlicher Mord-Geschichte“, Barockes Weltbild.
Wie wird die bisherige Forschung zu Harsdörffer berücksichtigt?
Die Einleitung beleuchtet die bisherige Forschungslandschaft zu Georg Philipp Harsdörffer, die seine Werke lange Zeit primär als kulturwissenschaftliche Quelle betrachtete, ohne deren literarischen Eigenwert ausreichend zu würdigen.
- Quote paper
- Claudia Gerhardt (Author), 2007, Georg Philipp Harsdörffers „Gesprächsspiele“ und seine Erzählungen als Medium der Wissensvermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137018