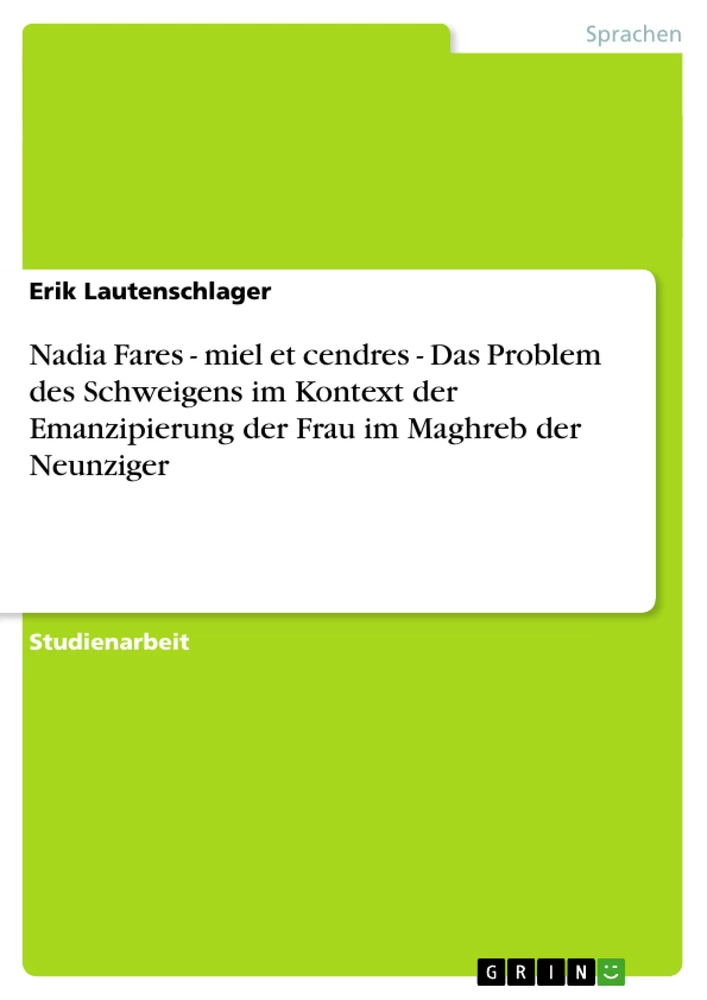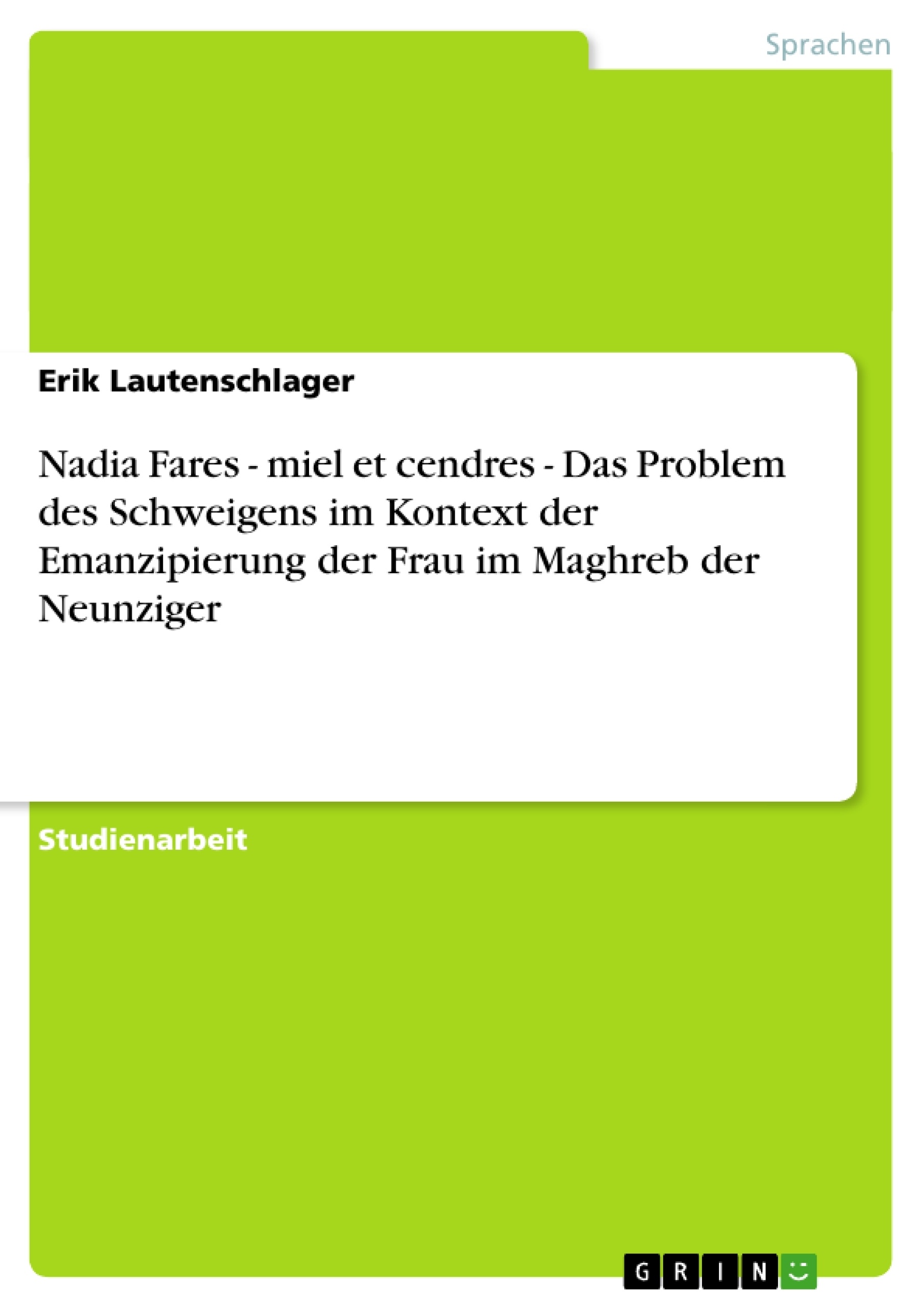Nadia Fares hat mit ihrem Film „Miel et Cendres“ eine gelungene Auseinandersetzung mit der
Thematik der Selbstverwirklichung der Frauen geschaffen. Er ist als Gemeinschaftsproduktion von
C.T.V. Services Tunesie und der Djoint Ventschr Suisse 1996 veröffentlicht worden. Nadja Fares
führte Regie und schrieb am Drehbuch mit. Die Ägypto-Schweizerin erhielt für diese Produktion
den Max-Ophüls-Preis 1996. Die Auszeichnung verdient sie sich durch gekonnte Szenerien und
teils ungewöhnliche Stillmittel, auf die im Kapitel IV.2.1 hingewiesen wird.
Doch vor der Analyse des Films soll ein Kapitel über die Entwicklung des arabischen Films vom
Anfang des Jahrhunderts bis in die frühen neunziger Jahre einen Einblick in die Entwicklung des
Filmschaffens in Nordafrika bieten. Natürlich mußten dafür gewisse Begrenzungen vorgenommen
werden, da der Rahmen der Arbeit sonst gesprengt worden wäre. So ist nur ein kurzer Überblick der
Filmproduktion und Themenwahl während der Kolonialzeit und ein auf tunesische Beispiele
beschränkter Abriß des postkolonialen Schaffens unter II.1 und II.2 zu finden.
Um die Komplexität des Themas aufzuschlüsseln und die „europäischen Scheuklappen“ ein wenig
zu nehmen, werden im dritten Kapitel versucht, die verschiedenen Einstellungen zur traditionellen
muslimischen Gesellschaft und Erklärungen für Regeln des sozialen Zusammenlebens und deren
Ursprung, die nach europäischer Ansicht eine Unterdrückung der Frau bedeuten, dargelegt. Dieses
Kapitel schließt mit der Behandlung der Frage, ob die Gleichberechtigung der Frau nur Illusion
oder tatsächlicher Bestandteil des Korans ist.
Auf die theoretische Behandlung der Thematik folgt die zusammenfassende Analyse des gesamten
Films, um ein besseres Verständnis der nachgestellten Analyse der ausgewählten Szene zu
ermöglichen und die filmische Umsetzung besser darzustellen. Es handelt sich bei der Szene um
eine der Schlüsselszenen, die die in Kapitel IV.1.2 formulierte These unterstützen soll.
Schließlich bildet das Fazit den kurzen Abschluß der Arbeit, an die im Kapitel VI das
Szenenprotokoll und im Kapitel VII die Literaturliste angehängt ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Entwicklung des arabischen Films
- II.1 Vom Stummfilm zum „Nouveau Cinéma Arabe“ – ein Alleingang Ägyptens
- II.2 Das „Nouveau Cinéma Arabe“ im Maghreb – unter besonderer Betrachtung von Beispielen aus Tunesien
- III. Frauen in der muslimischen Gesellschaft: frei oder unterdrückt?
- III.1 Einführung in die Problematik
- III.2 Die Rechte und Pflichten der muslimischen Männer und Frauen
- III.3 Der Schleier
- III.4 Die Gleichberechtigung der Frau: Illusion oder Bestandteil des Koran?
- IV. Analyse
- IV.1 Zusammenfassende Analyse des gesamten Films
- IV.1.1 Formale Analyse
- IV.1.2 Inhaltliche Analyse
- IV.2 Analyse der ausgewählten Sequenz
- V. Fazit
- VI. Anhang
- VII. Literaturliste
- VII.1 Gedruckte Veröffentlichungen
- VII.2 Veröffentlichungen aus dem Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Nadia Fares' Film "Miel et Cendres" im Kontext der Emanzipation der Frau im Maghreb der 1990er Jahre. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Problems des Schweigens und der Selbstverwirklichung der Frauen in dieser Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die filmische Umsetzung dieser Thematik und setzt sie in den größeren Kontext der Entwicklung des arabischen Films.
- Die Entwicklung des arabischen Films vom Stummfilm bis zum „Nouveau Cinéma Arabe“
- Die Darstellung der Frau in der muslimischen Gesellschaft und die Debatte um Unterdrückung und Emanzipation
- Analyse von "Miel et Cendres" hinsichtlich seiner formalen und inhaltlichen Aspekte
- Die Rolle des Schweigens als Ausdruck gesellschaftlicher Zwänge
- Die Frage nach der Gleichberechtigung der Frau im Islam
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Films "Miel et Cendres" von Nadia Fares ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Es wird auf die Bedeutung des Films für die Auseinandersetzung mit der Selbstverwirklichung der Frau im Maghreb hingewiesen und der methodische Ansatz der Analyse skizziert. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, den Film im Kontext der Entwicklung des arabischen Kinos und der soziokulturellen Situation im Maghreb zu betrachten. Die Arbeit verspricht eine umfassende Analyse des Films, einschließlich einer detaillierten Betrachtung einer ausgewählten Schlüsselszenen.
II. Die Entwicklung des arabischen Films: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung des arabischen Films vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1990er Jahre. Es wird der Einfluss der Kolonialzeit und die Dominanz Ägyptens in der frühen Phase der Filmproduktion hervorgehoben. Das Kapitel beschreibt die Herausforderungen und Besonderheiten der Filmproduktion in Nordafrika unter den Bedingungen der Kolonialherrschaft und die allmähliche Entwicklung eines eigenständigen „Nouveau Cinéma Arabe“, insbesondere in Tunesien, welches im Fokus des nachfolgenden Kapitels steht. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Entwicklung von einer frühen Phase mit starkem europäischem Einfluss hin zu einer eigenständigen filmischen Ausdrucksform.
Schlüsselwörter
Miel et Cendres, Nadia Fares, arabischer Film, Nouveau Cinéma Arabe, Maghreb, Emanzipation der Frau, Schweigen, muslimische Gesellschaft, Gleichberechtigung, Selbstverwirklichung, Kolonialismus, Postkolonialismus.
Häufig gestellte Fragen zu "Miel et Cendres" - Analyse des Films von Nadia Fares
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält eine umfassende Vorschau auf eine akademische Arbeit, die Nadia Fares' Film "Miel et Cendres" analysiert. Die Vorschau umfasst ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel, und Schlüsselwörter. Sie dient der strukturierten und professionellen Analyse der im Film behandelten Themen.
Worüber handelt der Film "Miel et Cendres"?
Der Film "Miel et Cendres" von Nadia Fares befasst sich mit der Emanzipation der Frau im Maghreb der 1990er Jahre. Ein zentrales Thema ist das Problem des Schweigens und die Selbstverwirklichung von Frauen in dieser Gesellschaft.
Was sind die Hauptthemen der akademischen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des arabischen Films, die Darstellung der Frau in der muslimischen Gesellschaft (einschließlich der Debatte um Unterdrückung und Emanzipation), eine formale und inhaltliche Analyse von "Miel et Cendres", die Rolle des Schweigens als Ausdruck gesellschaftlicher Zwänge und die Frage nach der Gleichberechtigung der Frau im Islam.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Entwicklung des arabischen Films, Frauen in der muslimischen Gesellschaft, Analyse (einschließlich einer formalen und inhaltlichen Analyse des Films und einer Analyse einer ausgewählten Sequenz), Fazit, Anhang und Literaturliste.
Wie wird der Film "Miel et Cendres" in der Arbeit analysiert?
Die Analyse von "Miel et Cendres" umfasst sowohl eine formale als auch eine inhaltliche Betrachtung. Es wird eine ausgewählte Schlüsselszenen detailliert untersucht. Die Analyse betrachtet den Film im Kontext der Entwicklung des arabischen Kinos und der soziokulturellen Situation im Maghreb.
Welche Rolle spielt das Schweigen im Film?
Das Schweigen wird als Ausdruck gesellschaftlicher Zwänge interpretiert und spielt eine zentrale Rolle in der Analyse des Films und seiner Darstellung der Situation von Frauen im Maghreb.
Wie wird die Entwicklung des arabischen Films dargestellt?
Das Kapitel zur Entwicklung des arabischen Films beschreibt den Weg vom Stummfilm bis zum „Nouveau Cinéma Arabe“, unter Berücksichtigung der Kolonialzeit, der Dominanz Ägyptens und der Herausforderungen der Filmproduktion in Nordafrika. Es wird besonders der Fokus auf die Entwicklung eines eigenständigen „Nouveau Cinéma Arabe“, insbesondere in Tunesien gelegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Miel et Cendres, Nadia Fares, arabischer Film, Nouveau Cinéma Arabe, Maghreb, Emanzipation der Frau, Schweigen, muslimische Gesellschaft, Gleichberechtigung, Selbstverwirklichung, Kolonialismus, Postkolonialismus.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen im arabischen Film und der Darstellung der Frau in der muslimischen Gesellschaft.
- Quote paper
- Erik Lautenschlager (Author), 2001, Nadia Fares - miel et cendres - Das Problem des Schweigens im Kontext der Emanzipierung der Frau im Maghreb der Neunziger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13696