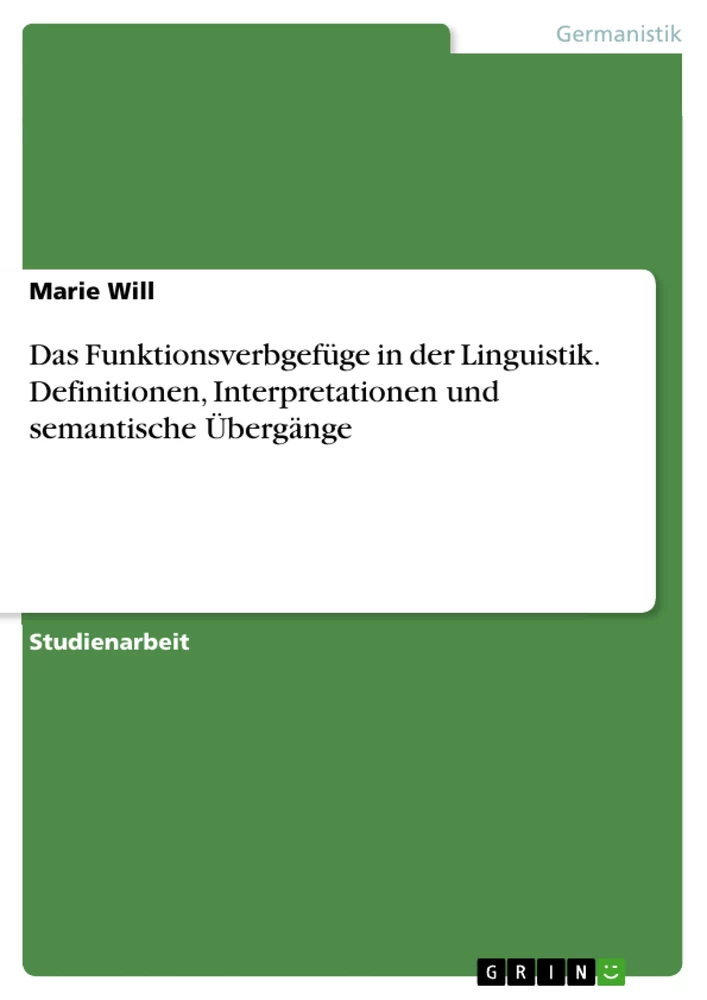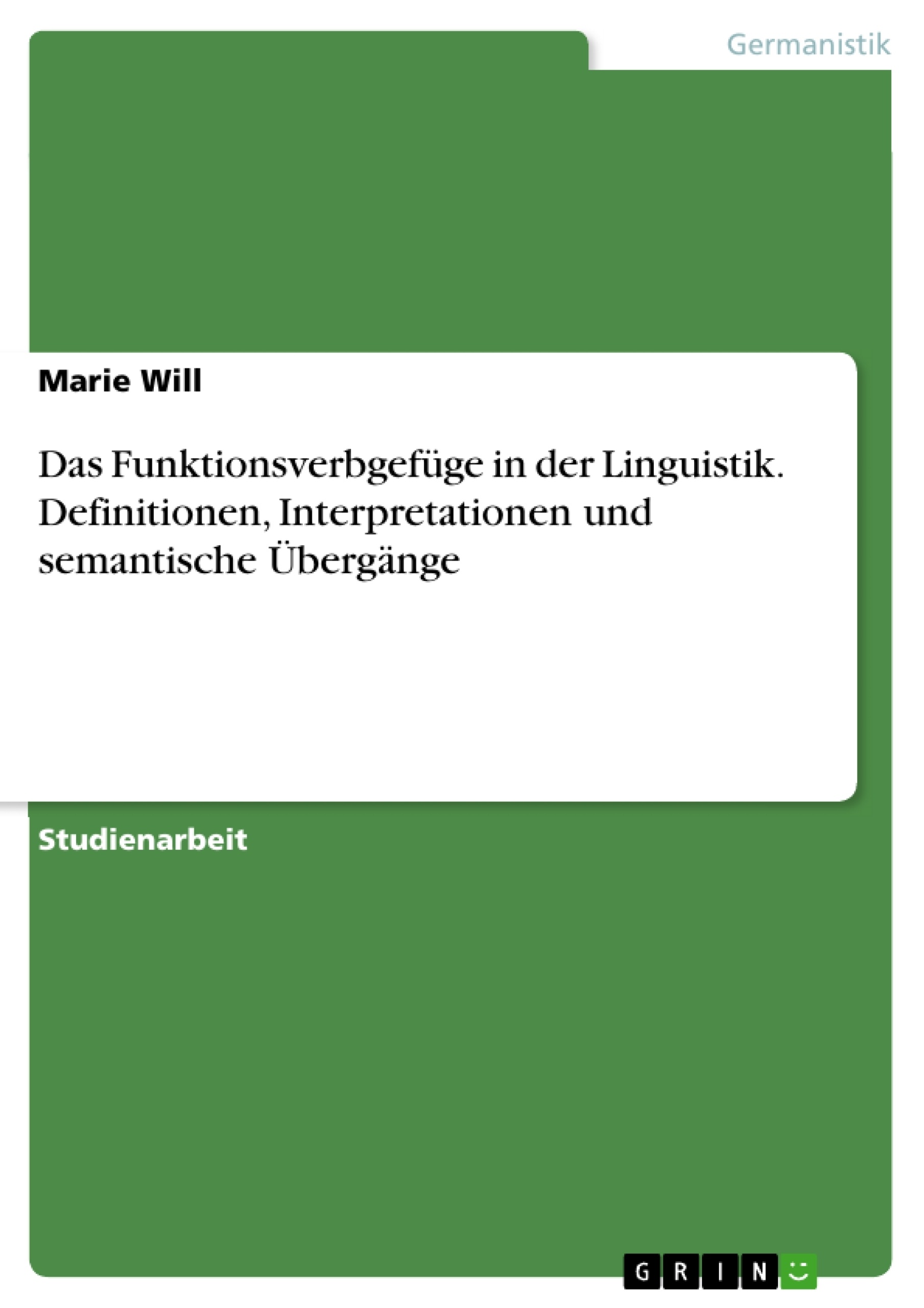Ziel dieser Hausarbeit ist es, das Konzept der Funktionsverbgefüge (FVG) in der Linguistik zu erforschen und zu klären.
FVG, bestehend aus einem Verb und einem Substantiv, sind komplexe sprachliche Konstruktionen, bei denen das Verb oft seine semantische Bedeutung verliert und das Substantiv die semantische Hauptlast trägt. Dieser Prozess wird durch verschiedene linguistische Ansichten dargestellt, wobei die Bedeutung des Verbes stark abgeschwächt wird, während die des Substantivs hervorgehoben wird. Die Arbeit untersucht die fließenden Übergänge und Unschärfen in der Definition von FVG, von der strengeren Interpretation von Peter Eisenberg, der FVG als Kombination eines Funktionsverbs und einer Präpositionalgruppe sieht, bis zur weit gefassten Definition von Helbig und Buscha, die FVG als Prädikat bilden, das aus einem Funktionsverb und einem beliebigen nominalen Bestandteil besteht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Funktionsverbgefüge als feste Idiomverbände
- 3. Merkmale und Klassifikation von Funktionsverbgefügen
- 4. Arten von Funktionsverbgefügen
- 5. Leistung von Funktionsverbgefügen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Funktionsverbgefüge (FVG) im Gegenwartsdeutschen. Ziel ist es, verschiedene Definitionen und Klassifikationen von FVG zu beleuchten und deren Merkmale zu analysieren. Die Arbeit hinterfragt die Abgrenzung von FVG zu anderen Konstruktionen und beleuchtet die semantischen und syntaktischen Eigenschaften dieser komplexen Prädikate.
- Definition und Abgrenzung von Funktionsverbgefügen
- Merkmale und Klassifizierung von Funktionsverbgefügen
- Semantische und syntaktische Eigenschaften von FVG
- Der idiomatische Charakter von FVG
- Analyse der Leistung von FVG in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Funktionsverbgefüge (FVG) ein und definiert den Begriff, wobei auf die Uneinheitlichkeit der Definitionen in der Linguistik hingewiesen wird. Sie hebt die Problematik der Abgrenzung zu Kopulakonstruktionen hervor und skizziert die zentralen Fragen, die in der Arbeit behandelt werden. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgenden Kapitel, indem sie die Forschungslücke und die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung von FVG aufzeigt.
2. Funktionsverbgefüge als feste Idiomverbände: Dieses Kapitel diskutiert die Frage, ob Funktionsverbgefüge als feste Idiomverbände betrachtet werden können. Es analysiert die Argumentation von Arne Zeschel, der für eine klare Trennung von FVG und Vollverb-Kopula plädiert und die idiomatische Natur von FVG betont. Zeschels Muster zur Bildung von FVG wird vorgestellt und kritisch hinterfragt, wobei die Grenzen und die Abstraktion des Modells deutlich gemacht werden. Das Kapitel schließt mit dem Fazit, dass FVG, trotz formaler und semantischer Ähnlichkeiten, keine absolut festen Idiome darstellen.
3. Merkmale und Klassifikation von Funktionsverbgefügen: Dieses Kapitel widmet sich der Identifikation und Klassifizierung von FVG anhand verschiedener Merkmale, die von Helbig (1984) formuliert wurden und von Winhart (2002) weiter ausgeführt wurden. Es werden zehn Kriterien vorgestellt, die helfen sollen, FVG von anderen Konstruktionen zu unterscheiden, wie z.B. die Substituierbarkeit durch Vollverben, Restriktionen im Artikelgebrauch, die Möglichkeit der Pluralisierung und die Negation. Jedes Merkmal wird anhand von Beispielen erläutert und seine Bedeutung für die Unterscheidung von FVG hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Funktionsverbgefüge, Idiomverbände, Linguistik, Syntax, Semantik, Klassifikation, Merkmale, Vollverb-Kopula, Prädikate, Gegenwartsdeutsch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Funktionsverbgefügen im Gegenwartsdeutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Funktionsverbgefüge (FVG) im Gegenwartsdeutschen. Der Fokus liegt auf der Definition, Klassifizierung, den Merkmalen und der Abgrenzung zu ähnlichen Konstruktionen. Es wird untersucht, ob FVG als feste Idiome betrachtet werden können und welche Rolle sie in der Kommunikation spielen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Funktionsverbgefüge als feste Idiomverbände, Merkmale und Klassifikation von Funktionsverbgefügen, Arten von Funktionsverbgefügen, Leistung von Funktionsverbgefügen und Fazit. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der FVG-Analyse.
Wie wird der Begriff "Funktionsverbgefüge" definiert?
Die Arbeit weist auf die Uneinheitlichkeit der Definitionen von FVG in der Linguistik hin. Die Einleitung legt den Grundstein, indem sie die Problematik der Abgrenzung zu Kopulakonstruktionen aufzeigt und die zentrale Forschungslücke benennt.
Welche Merkmale von Funktionsverbgefügen werden untersucht?
Es werden zehn Kriterien, die von Helbig (1984) und Winhart (2002) formuliert wurden, zur Identifizierung und Klassifizierung von FVG herangezogen. Diese Kriterien umfassen Aspekte wie die Substituierbarkeit durch Vollverben, Restriktionen im Artikelgebrauch, Pluralisierungsmöglichkeiten und Negation. Jedes Merkmal wird anhand von Beispielen erläutert.
Sind Funktionsverbgefüge feste Idiomverbände?
Das Kapitel 2 diskutiert die Frage, ob FVG als feste Idiomverbände betrachtet werden können. Die Arbeit analysiert die Argumentation von Arne Zeschel und kommt zu dem Schluss, dass FVG, trotz formaler und semantischer Ähnlichkeiten, keine absolut festen Idiome darstellen.
Welche Rolle spielen Funktionsverbgefüge in der Kommunikation?
Die Arbeit beleuchtet die semantischen und syntaktischen Eigenschaften von FVG und analysiert deren Leistung in der Kommunikation. Dies beinhaltet die Untersuchung der verschiedenen Funktionen und Bedeutungen von FVG in unterschiedlichen Kontexten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Funktionsverbgefüge, Idiomverbände, Linguistik, Syntax, Semantik, Klassifikation, Merkmale, Vollverb-Kopula, Prädikate, Gegenwartsdeutsch.
Welche Zielsetzung verfolgt diese Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit besteht darin, verschiedene Definitionen und Klassifikationen von FVG zu beleuchten und deren Merkmale zu analysieren. Die Arbeit hinterfragt die Abgrenzung von FVG zu anderen Konstruktionen und beleuchtet die semantischen und syntaktischen Eigenschaften dieser komplexen Prädikate.
- Quote paper
- Marie Will (Author), 2021, Das Funktionsverbgefüge in der Linguistik. Definitionen, Interpretationen und semantische Übergänge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1368691