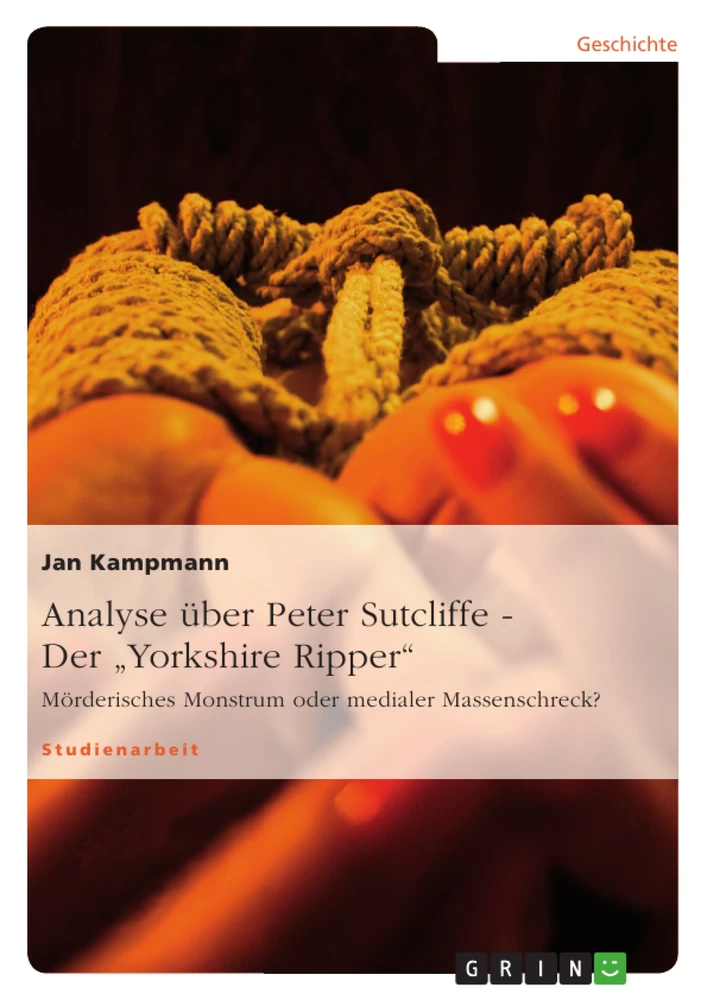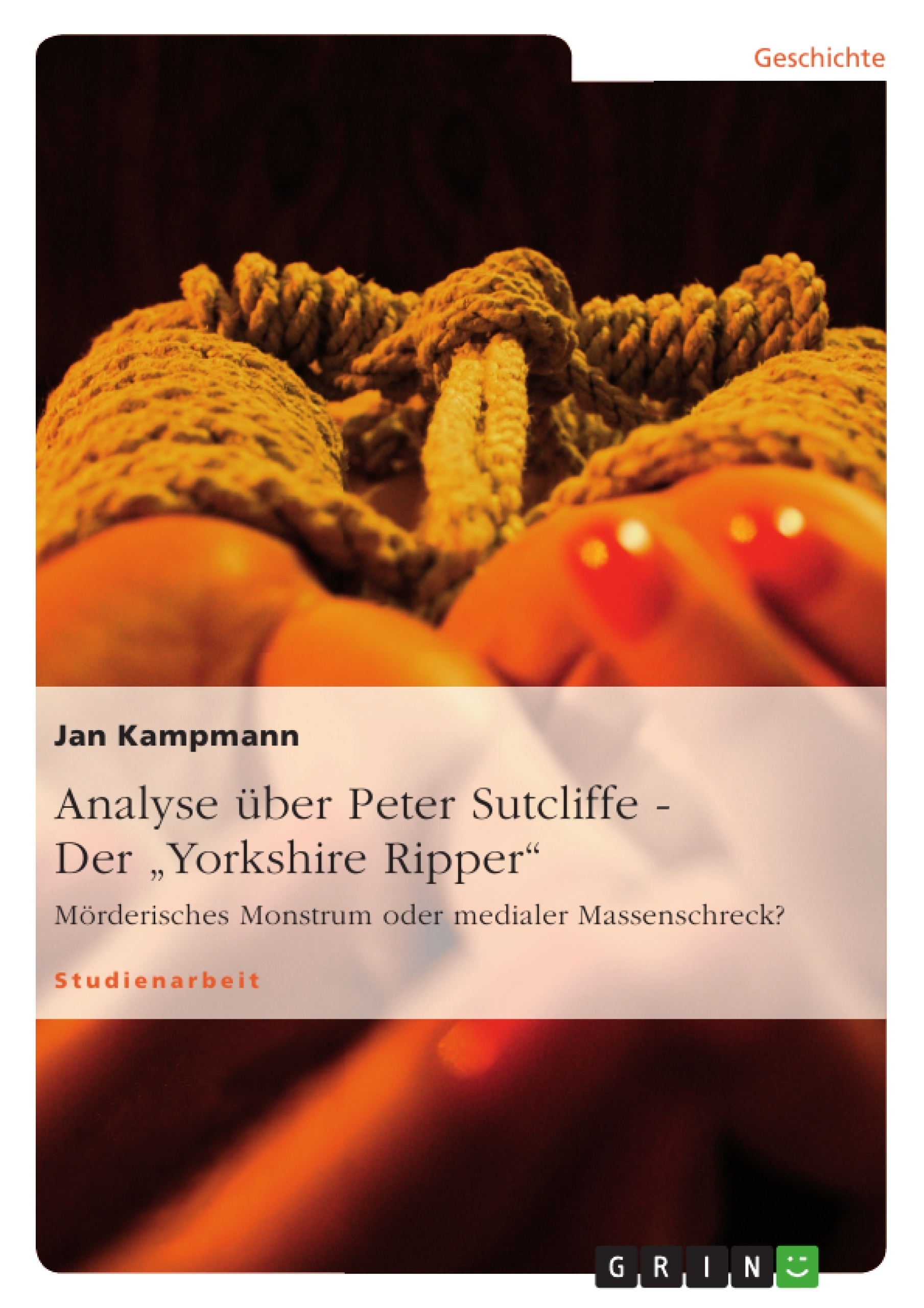“Medics are more concerned about the risk the public poses to him rather than the risk he poses to the public” – So lautet das Urteil über einen 13-fachen britischen Serienmörder, nachdem dieser 27 Jahre seiner Haftstrafe verbüßt hatte, berichtete der „Daily Telegraph“ im Februar diesen Jahres. Mit einer Prise Sarkasmus kann es aufnehmen, wer die Hintergründe kennt. Denn Peter Sutcliffe – in Anlehnung an die Legende des unbekannten britischen Serienmörders „Jack the Ripper“ der „Yorkshire Ripper“ genannt – erregte neben dem „ersten Serienmörder“ von 1888 wohl die größte mediale Aufmerksamkeit in England jeher, wurde so vielleicht berühmter als ihm lieb war und löste eine Musterdemonstration des Sensationsjournalismus, populistischer Polizeifahndung und gesellschaftlicher Polarisierung aus.
Ganz Großbritannien war in Ekstase - ob sie sich nun in Furcht, Empörung, Faszination oder sozialem Engagement äußerte. LKW-Fahrer Peter Sutcliffe hatte zwischen 1975 und 1981 dreizehn Frauen ermordet und es bei mehreren weiteren versucht. Wie bei „Jack the Ripper“ fiel die Wahl seiner Opfer – zumindest zunächst – auf Prostituierte, später jedoch waren auch Studentinnen darunter, was die mediale Welle der Empörung deutlich steigerte. Neunmal musste sich Sutcliffe währenddessen einer Befragung bei der Polizei unterziehen, immer kam er in Freiheit davon – letzten Endes wurde er wegen eines falschen Nummernschildes zufällig bei einer Routinekontrolle geschnappt. Fünfeinhalb Jahre dauerte die Schnitzeljagd nach dem „Yorkshire Ripper“ an, in denen gefälschte Kassetten und Briefe sowie eine in dieser Form nicht dagewesen Sensations-Berichterstattung das öffentliche Leben in Großbritannien teilweise auf den Kopf stellten.
Jane Caputi, Autorin des Buches „The age of sex crime“, fragt: „Why such colorful masks? Why such drama? And why the accelerating procession of such killers marked by territory and remembered by method?” Eine Frage, die sich unweigerlich an die Medien richtet. Seine Wirkung ist unbestritten: Bei einer Befragung der Besucher von “Madame Tussaud’s” in London landete Sutcliffe seinerzeit auf Platz drei der meist gehassten Männer – hinter Adolf Hitler und Richard Nixon. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten, die Wechselwirkung zwischen den Massenmedien, der Staatsgewalt und Öffentlichkeit aufzuschlüsseln und die Wirkung des Phänomens „Yorkshire Ripper“ greifbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Einführung
- Das Konzept der „Fear of Crime“
- „Moral Panic“ und soziale Hintergründe
- Medialisierung von Kriminalität
- Die Berichterstattung über den „Yorkshire Ripper“
- Die Qualitätspresse: „The Times“
- Die Boulevardpresse: „Daily Mirror“
- Soziale und politische Folgen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wechselwirkung zwischen Massenmedien, Staatsgewalt und Öffentlichkeit im Fall des „Yorkshire Ripper“, Peter Sutcliffe. Ziel ist es, die anhaltende mediale Aufmerksamkeit und die gesellschaftliche Panik zu erklären, die dieser Fall auslöste, obwohl es sich um eine Serie von Einzel-taten handelte. Die Arbeit analysiert die Rolle der Medien bei der Konstruktion und Aufrechterhaltung des „Yorkshire Ripper“-Phänomens.
- Die „Fear of Crime“-Theorie und ihre Relevanz im Kontext des Falls.
- Der „Moral Panic“-Konzept nach Cohen und seine Anwendung auf die gesellschaftliche Reaktion.
- Der Vergleich der Berichterstattung in Qualitäts- und Boulevardpresse.
- Die sozialen und politischen Folgen des Falls.
- Die Rolle der Medien bei der Konstruktion und Aufrechterhaltung der öffentlichen Panik.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Fall des „Yorkshire Ripper“, Peter Sutcliffe, und seine enorme mediale Aufmerksamkeit. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen: Warum hielt das Thema Großbritannien so lange in Atem? Wie konnte dieser Fall eine solche Panik auslösen? Wie beeinflussten die Medien die öffentliche Wahrnehmung und die Dauer des Falls? Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Theorien der „Fear of Crime“ und „Moral Panic“ sowie die Analyse der Berichterstattung in der „Times“ und dem „Daily Mirror“ umfasst, um die Wechselwirkung zwischen Medien, Staat und Öffentlichkeit aufzuzeigen.
Theoretische Einführung: Dieses Kapitel legt den theoretischen Rahmen für die Analyse fest. Es behandelt das Konzept der „Fear of Crime“, wobei die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Gefahr und der wahrgenommenen Angst im Mittelpunkt steht. Die Theorien von Hollway und Jefferson werden erläutert, die den Wunsch nach Ordnung und Kontrolle als Grundlage der Angst identifizieren. Weiterhin wird das Konzept des „Moral Panic“ nach Cohen vorgestellt, das die Rolle der Medien bei der Konstruktion und Verstärkung von gesellschaftlicher Panik beschreibt. Der Zusammenhang zwischen „Fear of Crime“, „Moral Panic“ und Medien wird herausgearbeitet, um das Verständnis der öffentlichen Reaktion auf den „Yorkshire Ripper“-Fall zu ermöglichen.
Die Berichterstattung über den „Yorkshire Ripper“: Dieses Kapitel analysiert die mediale Berichterstattung über den „Yorkshire Ripper“ in zwei ausgewählten Zeitungen: der Qualitätszeitung „The Times“ und dem Boulevardblatt „Daily Mirror“. Es untersucht, wie die beiden Zeitungen den Fall darstellten und welche Rolle sie bei der öffentlichen Wahrnehmung spielten. Der Vergleich soll Aufschluss darüber geben, wie unterschiedliche mediale Strategien die öffentliche Meinung und die gesellschaftliche Reaktion auf den Fall beeinflussten. Die Analyse betrachtet den Unterschied in der Berichterstattung, den die unterschiedlichen Medien an den Tag legten.
Soziale und politische Folgen: Dieses Kapitel untersucht die sozialen und politischen Folgen des „Yorkshire Ripper“-Falls. Es wird analysiert, wie der Fall die öffentliche Ordnung, das Vertrauen in die Polizei und die gesellschaftliche Sicherheit beeinflusste. Möglicherweise wird hier auch die Rolle der Politik und die Reaktion des Staates auf die Ereignisse untersucht. Es wird beispielsweise die Debatte im House of Lords als Beispiel herangezogen.
Schlüsselwörter
Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, Fear of Crime, Moral Panic, Massenmedien, Qualitätspresse, Boulevardpresse, Sensationsjournalismus, gesellschaftliche Panik, soziale Folgen, politische Folgen, Medienwirkung, England, 1970er/80er Jahre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des "Yorkshire Ripper"-Falls
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die mediale Berichterstattung über den "Yorkshire Ripper", Peter Sutcliffe, und untersucht die gesellschaftliche Panik und die sozialen und politischen Folgen des Falls. Der Fokus liegt auf der Wechselwirkung zwischen Massenmedien, Staatsgewalt und Öffentlichkeit.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Analyse basiert auf den Theorien der "Fear of Crime" (Angst vor Kriminalität) und des "Moral Panic" (moralische Panik). Es wird untersucht, wie die Diskrepanz zwischen tatsächlicher und wahrgenommener Kriminalität Angst schürt und wie die Medien diese Angst verstärken können.
Welche Medien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Berichterstattung der Qualitätszeitung "The Times" und des Boulevardblatts "Daily Mirror", um die unterschiedlichen Strategien und Auswirkungen der Medien auf die öffentliche Wahrnehmung zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine theoretische Einführung, ein Kapitel zur Berichterstattung über den "Yorkshire Ripper", ein Kapitel zu den sozialen und politischen Folgen und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfragen und den methodischen Ansatz vor. Die theoretische Einführung erläutert die verwendeten Theorien. Das Kapitel zur Berichterstattung analysiert die Artikel der "Times" und des "Daily Mirror". Das Kapitel zu den Folgen untersucht die Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung, das Vertrauen in die Polizei und die Politik.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Zentrale Forschungsfragen sind: Warum hielt das Thema Großbritannien so lange in Atem? Wie konnte dieser Fall eine solche Panik auslösen? Wie beeinflussten die Medien die öffentliche Wahrnehmung und die Dauer des Falls?
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, Fear of Crime, Moral Panic, Massenmedien, Qualitätspresse, Boulevardpresse, Sensationsjournalismus, gesellschaftliche Panik, soziale Folgen, politische Folgen, Medienwirkung, England, 1970er/80er Jahre.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die anhaltende mediale Aufmerksamkeit und die gesellschaftliche Panik zu erklären, die der "Yorkshire Ripper"-Fall auslöste, und die Rolle der Medien bei der Konstruktion und Aufrechterhaltung dieses Phänomens zu analysieren.
Wie wird der methodische Ansatz beschrieben?
Der methodische Ansatz umfasst die Anwendung der "Fear of Crime" und "Moral Panic"-Theorien sowie die Analyse der Berichterstattung in der "Times" und dem "Daily Mirror", um die Wechselwirkung zwischen Medien, Staat und Öffentlichkeit aufzuzeigen.
Welche konkreten sozialen und politischen Folgen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Falls auf die öffentliche Ordnung, das Vertrauen in die Polizei und die gesellschaftliche Sicherheit. Ein mögliches Beispiel ist die Debatte im House of Lords.
- Quote paper
- Jan Kampmann (Author), 2009, Analyse über Peter Sutcliffe - Der "Yorkshire Ripper", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136843