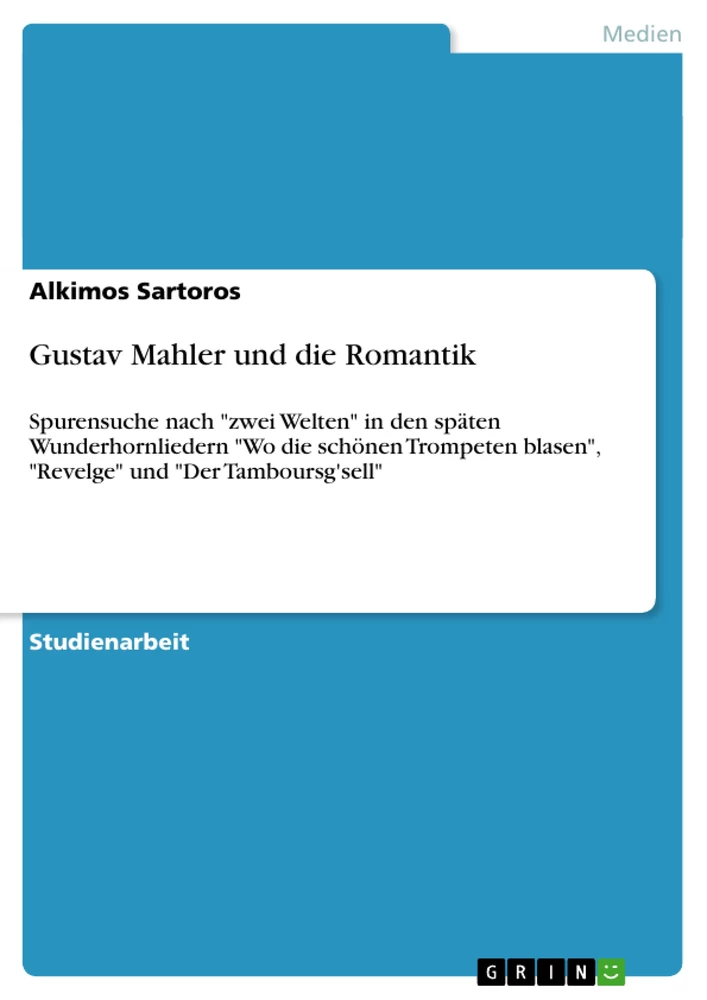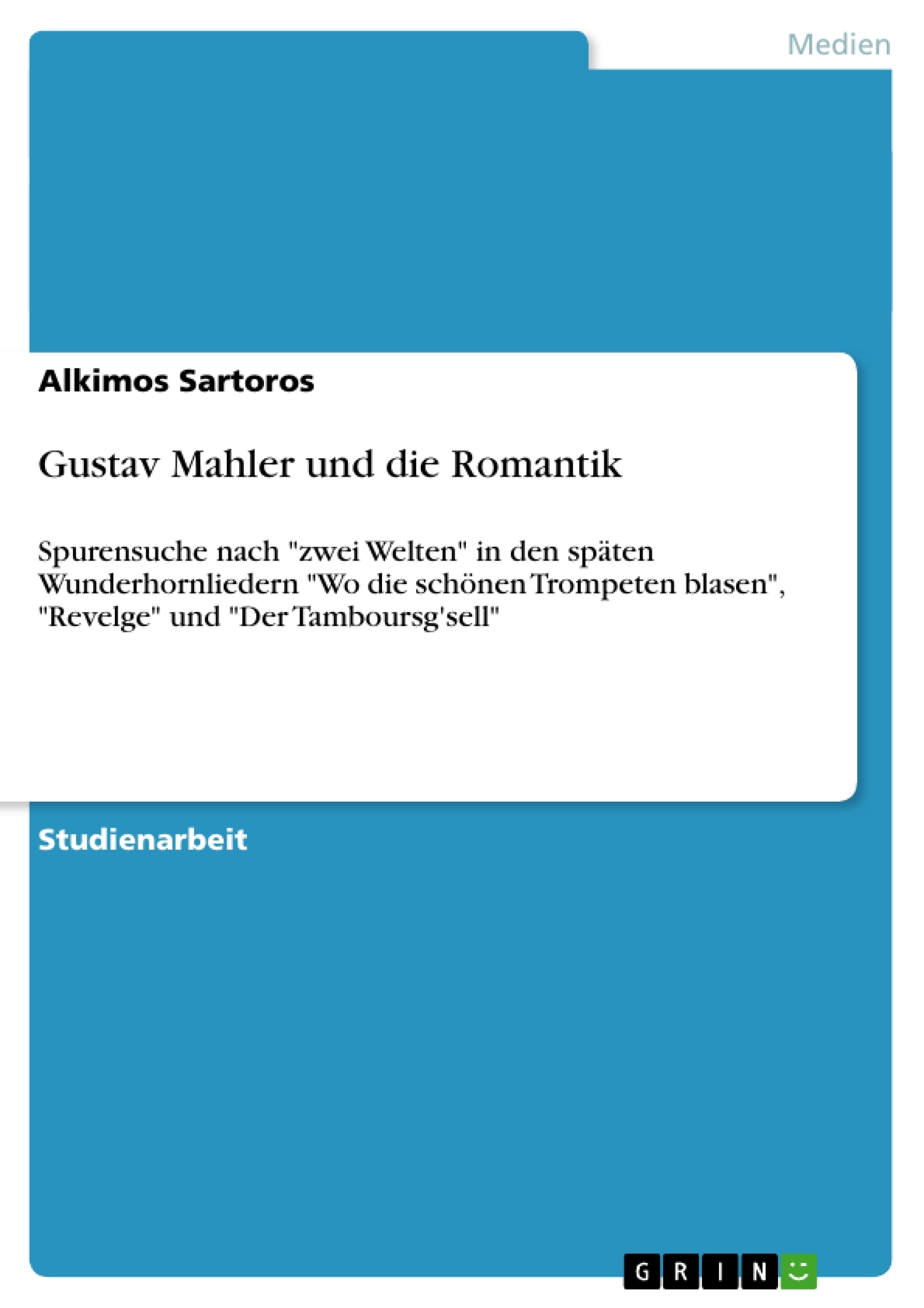In der vorliegenden Arbeit werden die romantischen Elemente im Liedwerk Gustav Mahlers herausgearbeitet, der Romantiker Mahler gefunden, und zugleich sein individuelles, dualistisch zwischen widerlicher Zivilisationswelt und verklärter Naturwelt verankertes, Romantikverständnis aufgezeigt. Welche Idee liegt ihm zugrunde und wie äußert es sich? Und – angesichts der Tatsache, dass zu Mahlers Zeit um die Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts mehrere Strömungen in der Musik widerstritten und die romantische Epoche weitgehend im Ausklingen begriffen war – was macht Mahlers musikalisch verarbeitetes Romantikverständnis einzigartig und bemerkenswert? Dies sind die Leitfragen, an denen sich diese Arbeit orientiert. In diesem Zusammenhang soll zudem eine zentrale These aufgestellt und überprüft werden:
Mahlers Romantikverständnis und dessen Verarbeitung sind einmalig, er stützt sich zwar auf schon Dagewesenes, drückt es aber in einer einzigartigen musikalischen Klarheit aus und gewinnt ihm dadurch neue Facetten ab.
Da sich Mahlers Schaffen über einige Jahrzehnte erstreckt und zudem inhaltlich oft disparat und kontrastierend gestaltet ist, soll diese These, diese dominante Facette mahlerschen Schaffens, speziell anhand seiner Wunderhorn-Lieder, einem Zyklus, der in seinem Liedschaffen, sowohl vom Umfang als auch vom inhaltlichen Gewicht eine zentrale Rolle einnimmt, untersucht werden. Dabei sind besonders die beiden zuletzt entstandenen Lieder, Revelge und Tamboursgsell, sowie Wo die schönen Trompeten blasen von besonderem Interesse, da sie den mahlerschen Dualismus, der sein Romantikverständnis prägt, besonders artifiziell ausarbeiten. Hinzu kommt, dass in diesen drei Soldatenliedern das Grundprinzip mahlerscher Musik komprimiert und doch umfassend wie fast nirgends sonst in seinem Werk enthalten ist, weshalb sie für die Untersuchung prägnanter Charakteristika, sprich seinem Romantikverständnis, besonders fruchtbar sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist Romantik?
2.1 Wie sieht Mahlers Romantikverständnis aus?
3. Die Entstehungsgeschichte von Wo die schönen Trompeten blasen, Revelge und Der Tamboursg’sell
3.1 Wie versteht Mahler die Textvorlage Des Knaben Wunderhorn und wie geht er damit um?
3.2 Wo die schönen Trompeten blasen
3.3 Revelge
3.4 Der Tamboursg’sell
4. Conclusio
Verzeichnis verwendeter Literatur
Primärquellen
Sekundärliteratur
1. Einleitung
In der vorliegenden Hausarbeit sollen die romantischen Elemente im Liedwerk Gustav Mahlers herausgearbeitet, der Romantiker Mahler gefunden, und zugleich sein individuelles, dualistisch zwischen widerlicher Zivilisationswelt und verklärter Naturwelt verankertes, Romantikverständnis aufgezeigt werden. Welche Idee liegt ihm zugrunde und wie äußert es sich? Und – angesichts der Tatsache, dass zu Mahlers Zeit um die Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts mehrere Strömungen in der Musik widerstritten und die romantische Epoche weitgehend im Ausklingen begriffen war – was macht Mahlers musikalisch verarbeitetes Romantikverständnis einzigartig und bemerkenswert? Dies sind die Leitfragen, an denen sich der weitere Verlauf dieser Arbeit orientieren wird. In diesem Zusammenhang soll zudem eine zentrale These aufgestellt und überprüft werden:
Mahlers Romantikverständnis und dessen Verarbeitung sind einmalig, er stützt sich zwar auf schon Dagewesenes, drückt es aber in einer einzigartigen musikalischen Klarheit aus und gewinnt ihm dadurch neue Facetten ab.
Da sich Mahlers Schaffen über einige Jahrzehnte erstreckt und zudem inhaltlich oft disparat und kontrastierend gestaltet ist, soll diese These, diese dominante Facette mahlerschen Schaffens, speziell anhand seiner Wunderhorn-Lieder, einem Zyklus, der in seinem Liedschaffen, sowohl vom Umfang als auch vom inhaltlichen Gewicht eine zentrale Rolle einnimmt, untersucht werden. Dabei sind besonders die beiden zuletzt entstandenen Lieder, Revelge und Tamboursgsell, sowie Wo die schönen Trompeten blasen von besonderem Interesse, da sie den mahlerschen Dualismus, der sein Romantikverständnis prägt, besonders artifiziell ausarbeiten. Dieser Dualismus sei hier in der Disposition der Arbeit lediglich kurz eingeführt, im weiteren Verlauf soll er noch näher charakterisiert und in besagten Liedern nachgewiesen werden. Hinzu kommt, dass in diesen drei Soldatenliedern das Grundprinzip mahlerscher Musik komprimiert und doch umfassend wie fast nirgends sonst in seinem Werk enthalten ist, weshalb sie für die Untersuchung prägnanter Charakteristika, sprich seinem Romantikverständnis, besonders fruchtbar sind.
Die Arbeit gliedert sich in insgesamt sieben Abschnitte. Im ersten soll zunächst dargelegt werden, was Romantik überhaupt ist, wie sich dieser Begriff, der sich einer abgeschlossenen Definition entzieht, fassen lässt. Damit soll das Fundament der Arbeit gelegt werden. Im zweiten Abschnitt soll – aufbauend auf dem allgemeinen Romantikbegriff – Mahlers spezifisches Romantikverständnis umrissen werden. Wo deckt es sich mit dem Ideengehalt der literarischen Romantik, wo deckt es sich mit Ausprägungen der musikalischen Epoche der Romantik? Und wo fügt er diesem Begriff oder seiner Musik – ganz allgemein gesprochen – neue „romantische“ Facetten hinzu?
Das folgende Kapitel widmet sich schließlich konkret den drei benannten Liedern. Von Interesse sind dabei einerseits rudimentäre Eigenschaften und Entstehungscharakteristika der Lieder und andererseits der Umgang Mahlers mit der Textvorlage Des Knaben Wunderhorn. Besonderes Augenmerk wird schließlich auf den musikalischen und textlichen Gehalt der Lieder gelegt – stets aus dem Wechselspiel zwischen romantischem Ideengehalt und Mahlers kompositorischem Verständnis desselben heraus betrachtet.
2. Was ist Romantik?
Was Romantik ist, lässt sich schwer definieren. Dennoch ist es für diese Arbeit unabdingbar, zunächst den inhaltlichen Raum dieses Begriffs abzustecken, um darauf aufbauend Mahlers spezielles Verständnis und seinen Umgang mit dieser Gedankenwelt analysieren zu können. „Gedankenwelt“ ist das erste Schlagwort, mit dem man sich diesem Begriff nähern kann, und das für diese Arbeit auch den Begriff der Romantik fassen soll. Das heißt, dass epochale Bestimmungen, die dem Begriff ebenfalls inhärent sind, außen vor gelassen werden. Der Grund dafür ist einfach: In der Literatur, in der „romantisches“ Denken seine Ursprünge hat, begannen sich erste Ausprägungen bereits Ende des 18. Jahrhunderts zu manifestieren. Als Anhaltspunkt kann hier das Werk Ludwig Tiecks gelten, beispielsweise Der blonde Eckbert, das von etwa 1790 bis 1848 reicht. In der Musik wird diese Epoche gemeinhin später angesiedelt, angefangen etwa bei Beethovens späten Klaviersonaten, weiterführend zu Schubert, Schumann, Mendelssohn und späteren Komponisten. Unstrittig ist jedoch, dass zum Zeitpunkt der Entstehung der hier behandelten Lieder Gustav Mahlers, um 1900 herum, nicht mehr von der Epoche der musikalischen Romantik gesprochen werden kann. Deswegen muss es hier darum gehen, den epochenunabhängigen Ideengehalt des Romantikbegriffs zu fassen, der sich selbst noch in der Musik des 20. Jahrhunderts niederschlug, etwa bei Rachmaninov.
Der geistige Nährboden der literarischen Romantik ist dort anzusiedeln, wo „die Verstädterung und Industrialisierung das Bewusstsein desillusionierten.“[1] Die zivilisatorische Wirklichkeit wird also zunehmend als etwas Negatives und gleichzeitig jeden unmittelbar Berührendes wahrgenommen. Das Bewusstsein, das dieser Welt ausgesetzt ist, schafft sich Romantisches, zum Beispiel das
„Abenteuerliche und Unwirkliche, das Märchen-, Zauber-, Traum- und Spukhafte, und in der Musik das Verschleiern der Form und der Zeitrelationen, die Entführung der Sinne in Klang- und Farbreize, die Entgrenzung der Künste zueinander hin.[2]
Dies sind jedoch lediglich äußere Ausprägungen dieser zunächst literarisch ausgearbeiteten Idee. Um dieser Idee auf den Grund zu gehen, ist es wichtig, romantische Musik, sprich komponierte Romantik, wie sie in dieser Arbeit im Liedwerk Gustav Mahlers ausfindig gemacht werden soll, und den den Romantikern eigenen Begriff von Musik zu unterscheiden. Letzterer
„ist anfänglich keine musikalische Produktions-, sondern eine Rezeptions- und Reflexionshaltung gewesen: eine bestimmte Weise […] des Denkens und Wertens der Musik […].[3]
Der Musik, die im romantischen Verständnis als höchste aller Künste galt, die wie keine andere Kunst gegenüber der tristen Wirklichkeit eine ferne Schönheit, Reinheit und Hoffnung aufzeigt. Aus diesem Musikverständnis erst entstand auch komponierte romantische Musik, die weit mehr ist, als eine Epochenerscheinung, die vielmehr eine Lebensfunktion einnahm und einnimmt und deren Prinzip sich immer wieder aufs neue niederschlägt und bis heute währt.[4]
Dieses Prinzip aber, diese romantische Grundidee ist ambivalent und vielschichtig: Schlegel sieht die Romantik als nie vollende „Dichtart im Werden“[5], schon programmatisch entzieht er sie also einer fixen Definition. Ein ihr eigenes Merkmal ist jedoch die Entgrenzung, die Überwindung der strengen klassischen Form, und somit die Aufweichung von künstlerischen Gattungsgrenzen. Der Mensch wird als komplexes und widersprüchliches Triebbündel verstanden, er hält nicht mehr nur die in der Aufklärung propagierte Ratio inne. Letztlich geht es jedoch nicht um die Ablehnung des Verstandes, sondern um eine Aussöhnung und Verknüpfung von Ratio, Phantasie und Unbewusstem.
Ein entscheidendes Merkmal der Romantik ist das Zwei-Welten-Modell. Die frühesten musikalischen Ausprägungen dieses Musikdenkens findet man bei Wilhelm Heinrich Wackenroder[6]. „Die Negation der wirklichen Welt ist der Ausgangspunkt.“[7] Als wirkliche Welt verstehen die Romantiker die Welt diesseitiger Erscheinungen, der Einbindung in industrielle Abläufe, der Unterwerfung unter eine Zweck- und Nutzenmaxime und der Ausrichtung des eigenen Strebens nach dieser Maxime. Wackenroder leitet daraus das Bedürfnis nach der Welt der Musik ab, die als Erlösung und Fluchtpunkt von der wirklichen Welt fungiert.[8]
2.1 Wie sieht Mahlers Romantikverständnis aus?
Zu Mahlers Lebzeiten lag die Entstehung der literarischen romantischen Idee bereits mehr als ein halbes Jahrhundert zurück; dennoch ist sie in Mahlers Zeit und gerade auch in seinem Werk nach wie vor sehr präsent.
„Noch bei Mahler beherrscht es [das Zwei-Welten-Modell, Anm. d. Verfassers] die Sinngebung der Musik völlig […].“[9]
Mahler selbst hat sein romantisch geprägtes Musikverständnis nicht nur komponiert, sondern auch schriftlich zum Ausdruck gebracht. Besonders klar und deutlich geschah dies in dem Jugendbrief, der die Ausgabe der Briefe Mahlers eröffnet, die Alma Mahler-Werfel 1924 herausgab. Entstanden ist er im Juni 1879.
Darin offenbart Mahler sein Verständnis einer vom Dualismus zwischen Zivilisationswelt und Naturwelt geprägten Existenz. Die Zivilisationswelt auf der einen Seite ist öde, sie ist gekennzeichnet vom Zwang zu Heuchelei und Lügenhaftigkeit, sie ist ekelhaft und selbst die Kunst ist seiner Meinung nach untrennbar mit ihr verbunden, da sie untrennbar mit den gegebenen Lebensverhältnissen verknüpft ist.[10]
Dem gegenüber steht die Naturwelt. Ein ihr eigenes Merkmal ist die Unvermitteltheit mit der sie über das Subjekt hereinbricht: „– Da lacht mich die Sonne an – und weg ist das Eis von meinem Herzen […] und mein Hohnlachen löst sich in das Weinen der Liebe auf.“[11]
Diese andere Welt, diese Naturwelt ist zudem mit einem „Hinausgehen verbunden, ist draußen – ist Welt ohne Geschichte, Stillstand der Zeit.“[12] Ein Stillstand der Zeit, der zwangsläufig eine weit reichende Ruhe mit sich bringt, eine Welt ohne Geschichte, die einfach nur ist und sich damit selbst genug ist. „Naturlaut [ist] sein Hörbares: Ruf der Unke, Schalmei und Volksweise.“[13] Bezeichnend für Mahlers Romantikverständnis ist jedoch – und da liegt er ganz auf der Linie auch des literarischen Romantikverständnisses – dass diese andere Welt und die reine Schönheit, die ihr zu eigen ist, ihren Grund in der Hässlichkeit der Zivilisationswelt haben. Ein Grund dafür lässt sich auch in Mahlers Belesenheit finden. Die Literatur und auch die theoretischen Schriften der romantischen Epoche und des romantischen Denkens sind ihm wohl vertraut.[14]
[...]
[1] Eggebrecht: Musik im Abendland. S.590
[2] Ebd. S.590
[3] Ebd. S.591
[4] Vgl. Ebd. S.592
[5] Vgl. Schanze, Helmut: Romantik und Aufklärung. Untersuchungen zu Friedrich Schlegel und Novalis. S.89
[6] Vgl. Eggebrecht: Musik im Abendland. S.592
[7] Ebd. S.595
[8] Vgl. Ebd. S.595.
[9] Ebd. S.612
[10] Vgl. Eggebrecht: Die Musik Gustav Mahlers. S.13
[11] Zitiert nach Eggebrecht: Die Musik Gustav Mahlers. S.13
[12] Eggebrecht: Die Musik Gustav Mahlers. S.18
[13] Ebd. S.18
[14] Vgl. Schnitzler, Günter: Gustav Mahler und die Romantik in Des Knaben Wunderhorn. In: Tadday, Ulrich (Hrsg.): Gustav Mahler: Lieder. S.33
- Quote paper
- Alkimos Sartoros (Author), 2009, Gustav Mahler und die Romantik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136839