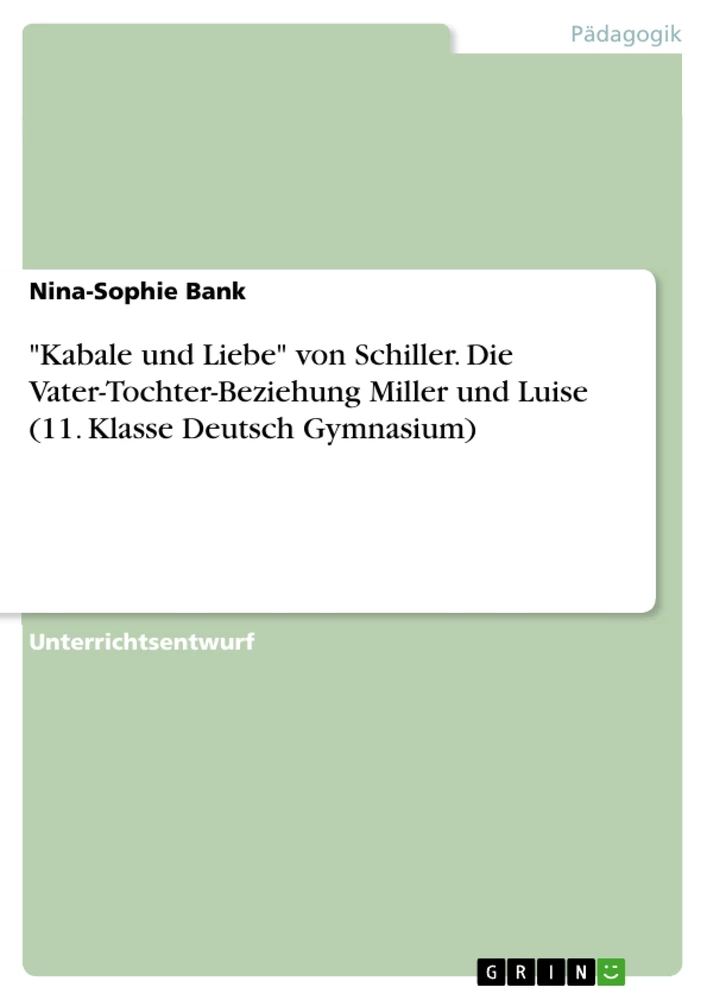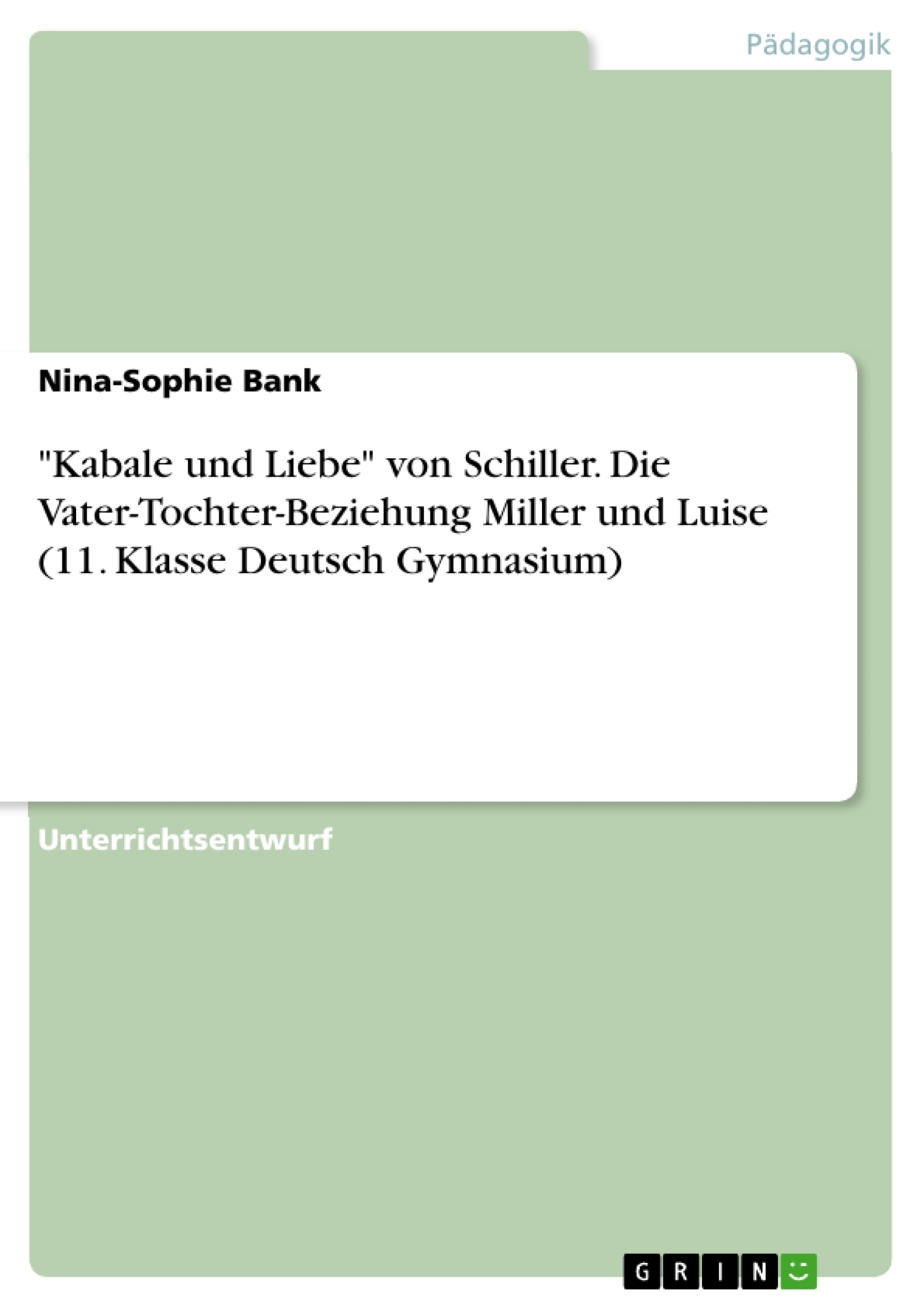Die Schülerinnen und Schüler erkennen durch die textanalytische Auseinandersetzung mit Szene 3 in Akt 1, dass Luise ihre Liebe zu Ferdinand durchsetzen möchte, Miller diese standesübergreifende Liebe aber verhindern will und sie demnach verschiedene Positionen einnehmen können.
Innerhalb dieser Stunde setzen sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit Szene 3 in Akt 1 des Bürgerlichen Trauerspiels "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller auseinander. Durch das textanalytische Vorgehen wird in dieser Stunde das Hauptaugenmerk auf den domänenspezifischen Kompetenzbereich "sich mit Texten und Medien auseinandersetzen" gelegt. Darüber hinaus werden auch die Kompetenzbereiche "Lesen", sowie "Sprechen und Zuhören" tangiert. Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Erarbeitungsphase aktiv lesen, die daraus gewonnenen Erkenntnisse mit ihrem bestehende Erfahrungswissen abgleichen und sich in den übrigen Unterrichtsphasen zudem innerhalb einer Diskussion über einen Sachverhalt mit ihren Mitschülern verständigen.
Inhaltsverzeichnis
- Lernziele und Kompetenzen
- Übergeordnetes Lernziel
- Feinlernziele
- Unterrichtsvoraussetzungen
- Allgemeine Unterrichtsvoraussetzungen
- Besondere Unterrichtsvoraussetzungen inkl. tabellarischer Reihenplanung
- Didaktische Analyse
- Methodische Planung
- Einstieg
- Erarbeitung
- Sicherung
- Transfer
- Hausaufgabe
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler in die textanalytische Auseinandersetzung mit der Szene 3 in Akt 1 des Bürgerlichen Trauerspiels „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller einzuführen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Positionen von Luise und Miller in Bezug auf die standesübergreifende Liebe zu analysieren und die Konflikte in der Vater-Tochter-Beziehung herauszustellen.
- Die Liebe zwischen Luise und Ferdinand im Kontext der standesbedingten gesellschaftlichen Normen
- Die konträren Perspektiven von Luise und Miller auf die Liebe und die Folgen der standesbedingten Ehe
- Die Rolle des patriarchalischen Gefüges und seine Auswirkungen auf Luises Handlungsspielraum
- Die Charakteristika des Bürgerlichen Trauerspiels und dessen Bedeutung für die Darstellung sozialer Konflikte
- Die Relevanz der Vater-Tochter-Beziehung im historischen und aktuellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Lernziele und Kompetenzen: Die Stunde soll den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, die unterschiedlichen Positionen von Luise und Miller in Bezug auf die Liebe zu erkennen. Dabei sollen sie textanalytische Kompetenzen entwickeln und die Bedeutung der Standeskonventionen im Kontext der Vater-Tochter-Beziehung verstehen.
- Unterrichtsvoraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler haben bereits das gesamte Werk „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller gelesen und sind mit der grundlegenden Handlung vertraut.
- Didaktische Analyse: Der Entwurf analysiert den Lehrplanbezug und die Relevanz des Themas für die Schülerinnen und Schüler. Dabei werden die verschiedenen Perspektiven auf die Liebe, die Rolle des patriarchalischen Gefüges und die Charakteristika des Bürgerlichen Trauerspiels beleuchtet.
- Methodische Planung: Die Stunde ist in fünf Phasen gegliedert: Einstieg, Erarbeitung, Sicherung, Transfer und Hausaufgabe. Es wird eine methodische Vielfalt eingesetzt, um die Lernziele zu erreichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte der Unterrichtseinheit sind: Bürgerliches Trauerspiel, Kabale und Liebe, Friedrich Schiller, Liebe, Standeskonventionen, Vater-Tochter-Beziehung, Patriarchat, Sozialer Konflikt, Textanalyse, Kommunikationsfähigkeit, Kulturkompetenz.
- Arbeit zitieren
- Nina-Sophie Bank (Autor:in), 2021, "Kabale und Liebe" von Schiller. Die Vater-Tochter-Beziehung Miller und Luise (11. Klasse Deutsch Gymnasium), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1368184