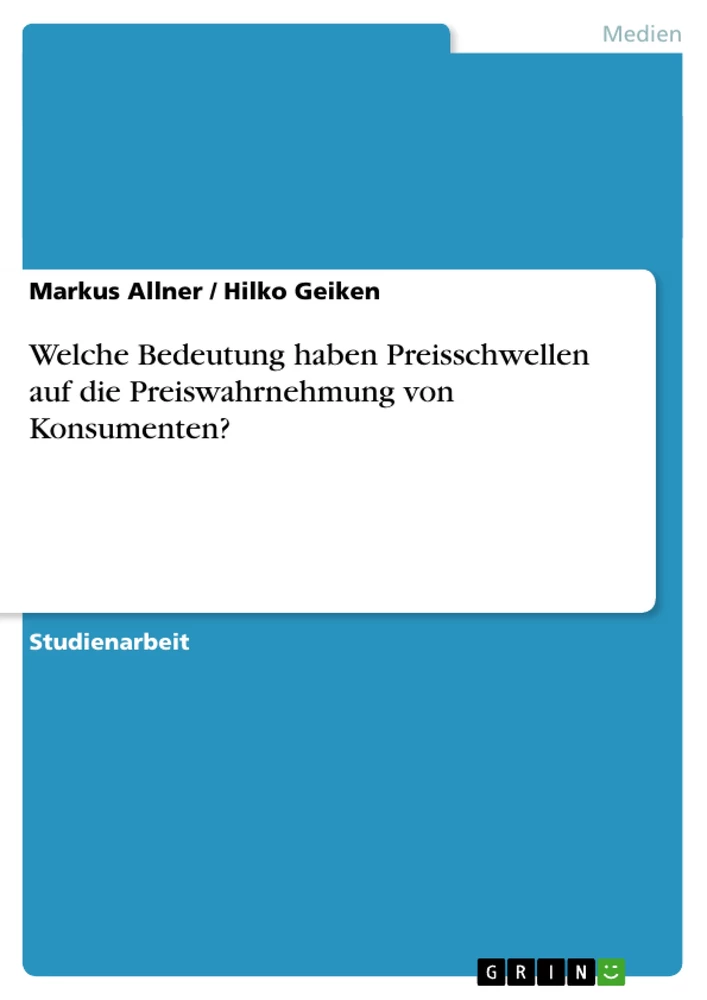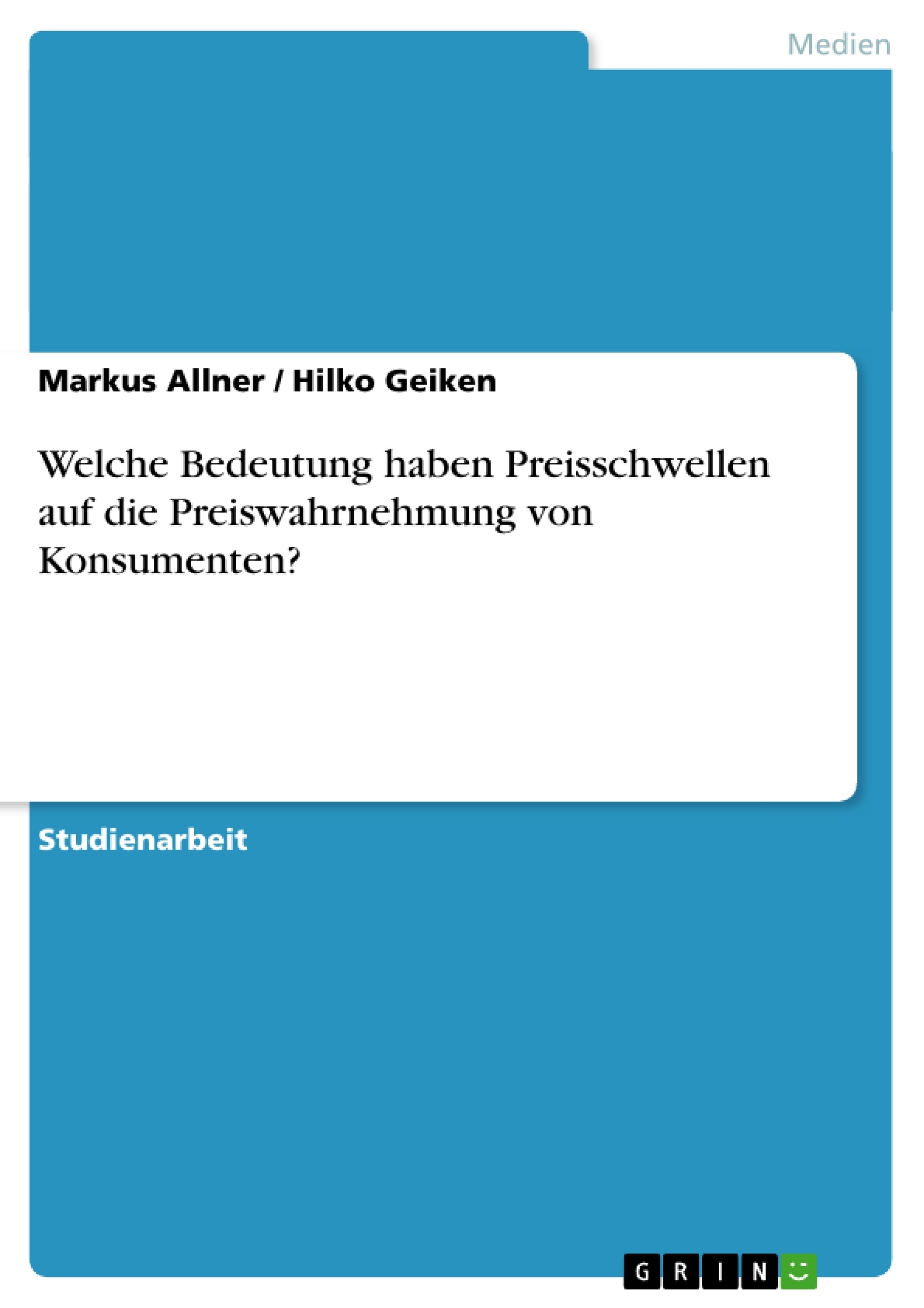Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von Preisschwellen auf die Preiswahrnehmung von Konsumenten.
Die Frage, ob ein Produkt 1,99 € oder 2,00 € kosten soll, ist in der Unternehmenspraxis nicht neu. Es existieren zahlreiche Studien, welche das Kaufverhalten der Verbraucher und deren Reaktion auf den Preis untersuchen.
Theoretisch sollte erwartet werden, dass alle Preisziffern im Einzelhandel anzutreffen sind. Doch der Handel konzentriert sich in Wirklichkeit nur auf wenige Ziffern. So haben Müller-Hagedorn und Zielke 10000 Positionen auf Kassenbons ausgewertet und anhand einer Stichprobe festgestellt, dass im Lebensmittelhandel von 1000 möglichen Preisziffern im Bereich von 0 bis 10,00 € sehr viele nur einmal oder überhaupt nicht aufgetreten sind. Im rechnerischen Durchschnitt hätte jede Ziffer jedoch rund 9 Mal auftreten müssen. Der Preis von 0,99 € lag dagegen insgesamt 951 Mal vor, also in mehr als 10% der Fälle, ein Preis von 1,99 € kam in 749 Fällen vor, was 8,4% entspricht. Mit 10 von 1000 möglichen Preisziffern wurden fast 50% der untersuchten Preise erfasst. Bei allen diesen Preisen kam in den letzten Ziffern eine 9 vor.
Auch Diller weist auf empirische Befunde zur Dominanz der 9 als letzte Ziffer hin. Er schreibt weiter, dass gerade der Lebensmitteleinzelhandel die Preissetzung mit runden Preisen scheut, da dort Preisschwellen vermutet werden.
Ziel dieser Arbeit ist es theoretische Erklärungskonzepte zur Existenz von Preisschwelleneffekten und einen Überblick der bisherigen empirischen Befunde zu diesem Forschungsthema aufzuzeigen. Hierzu wird zunächst die Bedeutung der Preiswahrnehmung in der Preispolitik betrachtet. Nach der anschließenden Begriffserklärung von Preisen und Preisschwellen werden verhaltenstheoretische Grundlagen zur Preisschwellenwahrnehmung vorgestellt. Abschnitt 5 zeigt welche Effekte verschiedene Preisziffern auf die Preiswahrnehmung von Konsumenten haben können und Abschnitt 6 befasst sich mit empirischen Studien zu Preisschwelleneffekten.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bedeutung der Preiswahrnehmung in der Preispolitik
3. Preise und Preisschwellen
3.1 Abgrenzung Gebrochene, runde und glatte Preise
3.2 Preisschwellen in der Preis- Absatz- Funktion
4. Verhaltenstheoretische Grundlagen zur Preisschwellenwahrnehmung
4.1 Preisinformationsaufnahme
4.2 Preisinformationsbeurteilung
4.2.1 Absolute Preisschwellen
4.2.2 Relative Preisschwellen
4.3 Preisinformationsspeicherung
5 Erklärungsansätze der Zifferneffekte
5.1 Wahrnehmung der Preisziffern von links
5.2 Wahrnehmung der Preisziffern von rechts
6. Empirische Studien zur Preisschwellenforschung
6.1 Studie zu Wahrnehmungsschwellen
6.2 Studie zur Preisbeurteilung
6.3 Studie zu runden Preisen
6.4 Studie zu Preisveränderungen
7. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Preisschwellen bei einer runden Zahl
Abbildung 2: Relative Preisschwellen und Kategorisierung des Preisempfindens
Abbildung 3: Objektive und subjektive Preisskalen
Abbildung 4: Price Acceptability Functions for two consumers- Body Lotion
1. Einleitung
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von Preisschwellen auf die Preiswahrnehmung von Konsumenten.
Die Frage, ob ein Produkt 1,99 € oder 2,00 € kosten soll, ist in der Unternehmenspraxis nicht neu. Es existieren zahlreiche Studien, welche das Kaufverhalten der Verbraucher und deren Reaktion auf den Preis untersuchen.[1]
Theoretisch sollte erwartet werden, dass alle Preisziffern im Einzelhandel anzutreffen sind. Doch der Handel konzentriert sich in Wirklichkeit nur auf wenige Ziffern. So haben Müller-Hagedorn und Zielke 10000 Positionen auf Kassenbons ausgewertet und anhand einer Stichprobe festgestellt, dass im Lebensmittelhandel von 1000 möglichen Preisziffern im Bereich von 0 bis 10,00 € sehr viele nur einmal oder überhaupt nicht aufgetreten sind. Im rechnerischen Durchschnitt hätte jede Ziffer jedoch rund 9 Mal auftreten müssen. Der Preis von 0,99 € lag dagegen insgesamt 951 Mal vor, also in mehr als 10% der Fälle, ein Preis von 1,99 € kam in 749 Fällen vor, was 8,4% entspricht. Mit 10 von 1000 möglichen Preisziffern wurden fast 50% der untersuchten Preise erfasst. Bei allen diesen Preisen kam in den letzten Ziffern eine 9 vor.[2]
Auch Diller weist auf empirische Befunde zur Dominanz der 9 als letzte Ziffer hin. Er schreibt weiter, dass gerade der Lebensmitteleinzelhandel die Preissetzung mit runden Preisen scheut, da dort Preisschwellen vermutet werden.[3]
Ziel dieser Arbeit ist es theoretische Erklärungskonzepte zur Existenz von Preisschwelleneffekten und einen Überblick der bisherigen empirischen Befunde zu diesem Forschungsthema aufzuzeigen. Hierzu wird zunächst die Bedeutung der Preiswahrnehmung in der Preispolitik betrachtet. Nach der anschließenden Begriffserklärung von Preisen und Preisschwellen werden verhaltenstheoretische Grundlagen zur Preisschwellenwahrnehmung vorgestellt. Abschnitt 5 zeigt welche Effekte verschiedene Preisziffern auf die Preiswahrnehmung von Konsumenten haben können und Abschnitt 6 befasst sich mit empirischen Studien zu Preisschwelleneffekten.
2. Bedeutung der Preiswahrnehmung in der Preispolitik
Laut Homburg umfasst die Preispolitik als eine Komponente des Marketingmix alle Entscheidungen, die sich im Hinblick auf das vom Kunden zu entrichtende Entgelt für ein Produkt beziehen.
Die Preispolitik hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Zum einen, weil der Preis eine Marketing-Komponente darstellt, die keine Kosten verursacht und zum anderen, weil preispolitische Entscheidungen im Gegensatz zu den meisten anderen Facetten des Marketingmix relativ schnell umzusetzen sind. Weiterhin tragen verschiedene Entwicklungen zur Bedeutungssteigerung der Preispolitik bei. So zeigen viele Märkte Sättigungstendenzen, was zu einem zunehmenden Verdrängungswettbewerb auf Preisbasis führte. Neben der Globalisierung des Wettbewerbs und der gestiegenen Preistransparenz für die Nachfrager, ist auch der ausgeprägte Preiswettbewerb im Kampf um Marktanteile auf Wachstumsmärkten wie dem der Telekommunikation zu nennen.[4]
Somit wird der Preis immer mehr zum Entscheidungskriterium der Kunden über Kauf oder Nicht-Kauf eines Produktes.
Viele Unternehmen verfolgen kostenorientierte Ansätze zur Preisbestimmung, welche sich auf Informationen aus der Kostenrechnung stützen. Basis hierfür bilden die Einkaufs- und Produktionskosten, die Deckungsbeiträge und gewünschte Gewinnmargen. So spielen zunächst die Kosten des Produktes eine zentrale Rolle, da die Profitabilität eines Produktes letztlich vom Verhältnis des Preises zu den Kosten abhängt .[5]
Durch Verwendung der Preis-Absatz-Funktion fließt die Nachfrage direkt in die Preisbestimmung ein. Die Preis-Absatz-Funktion ist das grundlegende Konzept zur Behandlung preispolitischer Entscheidungen im Sinne der klassischen Preistheorie. Diese Funktion beschreibt die funktionelle Abhängigkeit des Absatzes x vom Preis p:
x = x(p).[6]
Weiterhin stellen die Nachfrage nach dem Produkt und das Preisverhalten der Konkurrenten entscheidende Faktoren der Preisfindung dar. [7]
Jedoch wäre es besonders für Handelsunternehmen strategisch sinnvoller einen kostenbezogenen Preis nicht gleichzeitig auch als Verkaufspreis zu setzen. Denn wie sich im Folgenden zeigen wird, hat sich die Psychologie heute ähnlich viel Einfluss auf den Preisfindungsprozess wie die reine Kostenrechnung.
Entscheidend für das Kaufverhalten der Verbraucher sind nicht nur objektive Preisinformationen, sondern auch die subjektive Wahrnehmung der Preisinformation und der Preisdarstellung. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Effekte und Phänomene der Preiswahrnehmung sind für eine erfolgreiche Preispolitik unerlässlich.
Diller beschreibt die Preiswahrnehmung als eine sensorische Aufnahme von Preisinformationen bei der objektive Preise oder andere Preissignale in subjektive Preiseindrücke entschlüsselt werden. Diese Eindrücke werden somit in ein subjektives Kategoriessystem des Beurteilers eingeordnet.[8]
Des Weiteren untersucht Diller fünf Effekte: Preisschwelleneffekt, Preisrundungseffekt, Preisfigureneffekt, Eckartikeleffekt und den Preisfärbungseffekt.[9]
Gebrochene Preise spielen in den ersten 3 Effekten eine Rolle, besonders jedoch beim Preisschwelleneffekt. Sie sind damit zu einem signifikanten Kriterium in vielen Studien über die Existenz von Preisschwellen geworden.
Diesem Phänomen der gebrochenen Preise und der Preisschwelleneffekte wird im Folgenden nachgegangen.
3. Preise und Preisschwellen
3.1 Abgrenzung Gebrochene, runde und glatte Preise
Als gebrochene Preise bezeichnet man Preise, welche auf eine der Centziffern zwischen Eins und Neun enden, wie 1,99 € oder 2,43 €. Dagegen spricht man von runden Preisen, wenn der Centbetrag auf eine Null, wie 0,70 € oder 6,40. € Bei besonders großen Preisen, kann entgegen dieser Definition, auch ein Betrag von 1999,00 € als gebrochener Preis bezeichnet werden. Glattpreise hingegen sind volle Europreise, wie etwa 6 € oder 2000 €.[10]
3.2 Preisschwellen in der Preis- Absatz- Funktion
Es wird vermutet, dass zwischen glatten und gebrochenen Preisen eine Preisschwelle existiert. Diese liegt dann vor, wenn die Preisabsatzfunktion unterhalb von glatten Preisen einen Sprung aufweist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Preisschwellen bei einer runden Zahl[11]
Abbildung 1 zeigt, dass Konsumenten bei einem Preis von 0,99 € überproportional mehr kaufen als bei einem Preis von 1,00 €. Ein Preisunterschied von nur einem Cent führt zu einer großen Reaktion im Konsumentenverhalten. Eine Preisschwelle ist also der Effekt, der bewirkt, dass z.B. ein Preis von 0,99 € viel günstiger als ein Preis von 1,00 € wahrgenommen wird .[12] Bei Preisveränderungen eines Produktes bewirkt der Preisschwelleneffekt, dass eine Erhöhung des Preises von 2,99 Euro zu 3,00 Euro deutlich wahrgenommen wird,[13] während ein Preisanstieg von 0,94 Euro auf 0,96 Euro kaum Beachtung findet.[14]
4. Verhaltenstheoretische Grundlagen zur Preisschwellenwahrnehmung
Die klassische Preistheorie sieht rationale Kosten-Nutzen-Erwägungen als Basis für Kaufentscheidungen der Kunden. Dabei werden aber zusätzliche psychologische Faktoren, welche das Kaufverhalten des Kunden beeinträchtigen außer Acht gelassen. Thematisiert werden diese Faktoren in der verhaltenswissenschaftlich orientierten Preistheorie. In einer derartigen Betrachtungsweise wird untersucht in wieweit Kunden Preise tatsächlich wahrnehmen und verarbeiten.[15]
Nach Homburg lassen sich die Konzepte der verhaltenswissenschaftlichen Preisforschung vereinfacht in vier Phasen unterscheiden: Die Preisinformationsaufnahme, die Preisinformationsbeurteilung, die Preisinformationsspeicherung und das Ausgabe- und Produktnutzungsverhalten.[16]
Im Folgenden werden nun die für diese Seminararbeit relevanten Phasen 1-3 näher betrachtet.
[...]
[1] Vgl. Gedenk / Sattler (1999b), S. 1.
[2] Vgl. Müller-Hagedorn / Wierich (2005b), S. 4.
[3] Vgl. Diller (2008), S. 130.
[4] Vgl. Homburg / Krohmer (2006), S. 669.
[5] Vgl. Homburg / Krohmer (2006), S. 745.
[6] Vgl. Homburg / Krohmer (2006), S. 679.
[7] Vgl. Homburg / Krohmer (2006), S. 719.
[8] Vgl. Diller (2003), S. 128.
[9] Vgl. Diller (2008), S. 128-131
[10] Vgl. Diller / Brielmaier (1996), S.695.
[11] Müller-Hagedorn / Wierich (2005a), S. 21.
[12] Vgl. Gedenk / Sattler (1999a), S. 1.
[13] Vgl. Gedenk (2002), S. 83.
[14] Vgl. Olbrich/ Battenfeld (2007), S. 97.
[15] Vgl. Homburg / Krohmer (2006), S. 704.
[16] Vgl. Homburg / Krohmer (2006), S. 707.
- Quote paper
- Markus Allner (Author), Hilko Geiken (Author), 2008, Welche Bedeutung haben Preisschwellen auf die Preiswahrnehmung von Konsumenten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136756